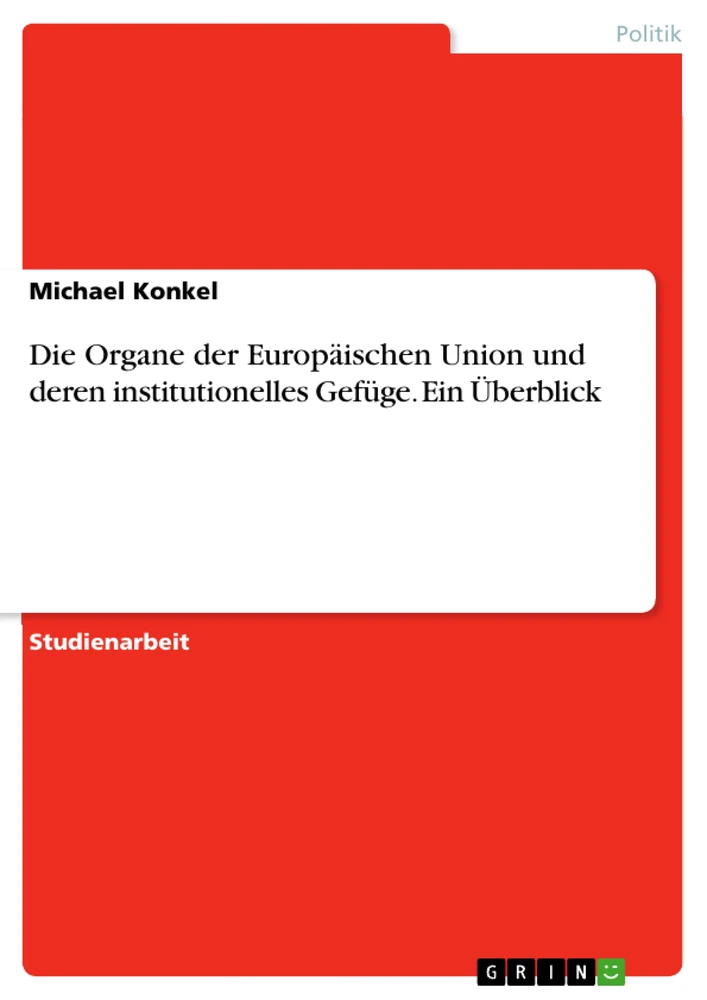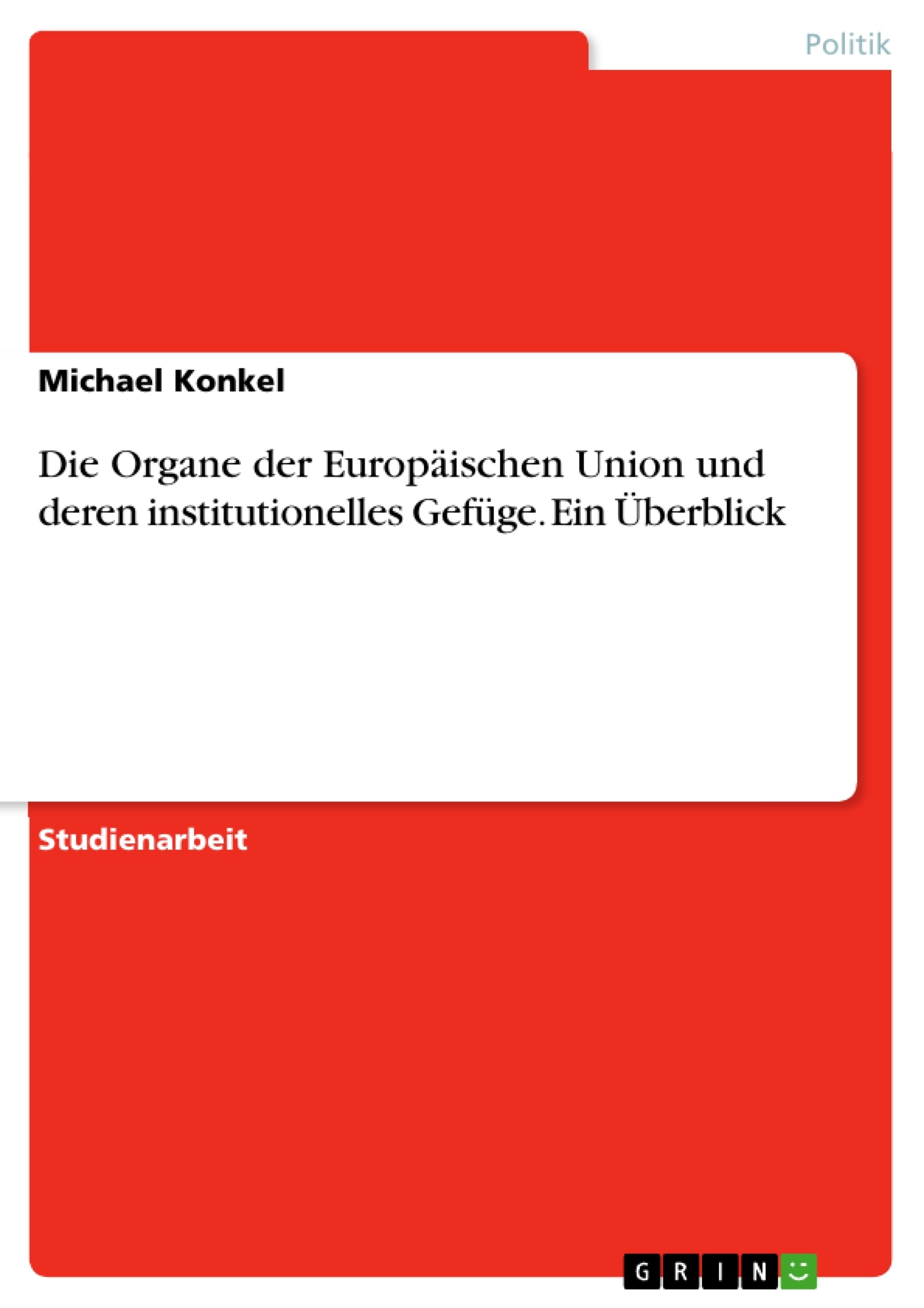Ziel dieser Arbeit ist, anhand dieser beispielhaft gewählten Struktur, auf die wesentlichen Verbindungen und Zusammenhänge sowie etwaige Wechselbeziehungen zwischen den Organen der EU einzugehen und diese zu verdeutlichen. Dies soll mit Rücksicht auf den Umfang der Arbeit in angemessener Form und vereinfachend erfolgen.
Die Europäische Union (EU) stellt eine politische und wirtschaftliche Vereinigung dar, die in dieser Form weltweit einzigartig ist. 28 souveräne Staaten wirken in einer demokratischen Arbeitsweise zusammen. Schon aufgrund der Anzahl der vertretenen Staaten entstehen Komplikationen bei der Entscheidungsfindung. Zusätzlich tragen auch das komplexe System und die Dynamik der europäischen Entwicklung zu einer Verkomplizierung bei. Umso wichtiger ist für dieses supranationale Konstrukt eine funktionierende Struktur von Organen, welche für diese agieren kann und handlungsfähig ist. Durch den Vertrag von Lissabon besitzt die EU nach Art. 47 EUV eine eigene Rechtspersönlichkeit und kann damit auf einen einheitlichen institutionellen Rahmen zurückgreifen. In Art. 13 Abs. 1 EUV werden abschließend die Organe der EU aufgezählt. Es handelt sich dabei um das Europäische Parlament (EP), den Europäischen Rat (ER), den Rat (Ministerrat, MR), die Europäische Kommission (EK), den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), die Europäische Zentralbank (EZB) und den Rechnungshof (EuRH)
Auf Basis dieser Aufzählung sollen im Verlauf der Ausarbeitung, in der erwähnten Reihenfolge, die jeweilige Zusammensetzung sowie die Aufgaben und Befugnisse dieser Organe erläutert werden. Im Anschluss wird dann ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Europäische Parlament
- 2.1. Zusammensetzung
- 2.2. Aufgaben und Befugnisse
- 3. Der Europäische Rat
- 3.1. Zusammensetzung
- 3.2. Aufgaben und Befugnisse
- 4. Rat der Europäischen Union - Ministerrat
- 4.1. Zusammensetzung
- 4.2. Aufgaben und Befugnisse
- 5. Europäische Kommission
- 5.1. Zusammensetzung
- 5.2. Aufgaben und Befugnisse
- 6. Der Europäische Gerichtshof
- 6.1. Zusammensetzung
- 6.2. Aufgaben und Befugnisse
- 7. Die Europäische Zentralbank
- 7.1. Zusammensetzung
- 7.2. Aufgaben und Befugnisse
- 8. Der Rechnungshof
- 8.1. Zusammensetzung
- 8.2. Aufgaben und Befugnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Organen der Europäischen Union (EU) und deren institutionellem Gefüge. Sie beleuchtet die Zusammensetzung und die Aufgaben der wichtigsten Organe der EU, um ein besseres Verständnis für deren Funktionsweise und deren Rolle in der europäischen Politik zu gewinnen.
- Zusammensetzung und Funktionsweise der Organe der EU
- Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den Organen
- Die Rolle der Organe in der Entscheidungsfindung und Gesetzgebung
- Die Bedeutung der EU-Organe für die europäische Integration
- Die Entwicklung der EU-Organe im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Das Europäische Parlament
Die Einleitung stellt die Europäische Union (EU) als eine einzigartige politische und wirtschaftliche Vereinigung vor. Sie beleuchtet die Komplexität der Entscheidungsfindung in der EU, insbesondere aufgrund der Anzahl der Mitgliedstaaten und der dynamischen Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer funktionierenden Struktur von Organen, die handlungsfähig ist. Die Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Organen der EU, ihren Aufgaben und Befugnissen sowie den Beziehungen zwischen ihnen.
Das Europäische Parlament ist das direkt gewählte Organ der EU und somit das einzige direkt legitimierte Organ im institutionellen Gefüge. Es wird alle fünf Jahre von den Bürgern der EU gewählt. Die Anzahl der Parlamentssitze ist auf 751 begrenzt, wobei die Sitze nach einem degressiv-proportionalen Verteilungssystem vergeben werden. Das Parlament verfügt über einen Präsidenten und gliedert sich in Fraktionen, die sich nach ihrer politischen Richtung zusammenfinden. Seine Hauptaufgaben sind Gesetzgebung, Aufsicht und Haushaltsaufgaben.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Organe, Institutionen, Europäisches Parlament, Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union, Europäische Kommission, Europäischer Gerichtshof, Europäische Zentralbank, Rechnungshof, Zusammensetzung, Aufgaben, Befugnisse, Beziehungen, Gesetzgebung, Aufsicht, Haushaltsaufgaben, Entscheidungsfindung, europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Welche sind die wichtigsten Organe der Europäischen Union?
Gemäß Art. 13 EUV sind dies das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat (Ministerrat), die Europäische Kommission, der Gerichtshof der EU, die Europäische Zentralbank und der Rechnungshof.
Wie setzt sich das Europäische Parlament zusammen?
Es besteht aus maximal 751 Abgeordneten, die alle fünf Jahre direkt von den Bürgern der EU gewählt werden. Die Sitze werden degressiv-proportional nach der Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten vergeben.
Was ist der Unterschied zwischen dem Europäischen Rat und dem Rat der EU?
Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs und gibt die politischen Impulse. Der Rat der EU (Ministerrat) ist zusammen mit dem Parlament für die Gesetzgebung und den Haushalt zuständig.
Welche Aufgaben hat die Europäische Kommission?
Die Kommission ist die „Hüterin der Verträge“. Sie hat das alleinige Initiativrecht für Gesetzesvorschläge, verwaltet den Haushalt und überwacht die Einhaltung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten.
Was ist die Aufgabe des Europäischen Rechnungshofes?
Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben der EU sowie die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.
- Quote paper
- Michael Konkel (Author), 2017, Die Organe der Europäischen Union und deren institutionelles Gefüge. Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539047