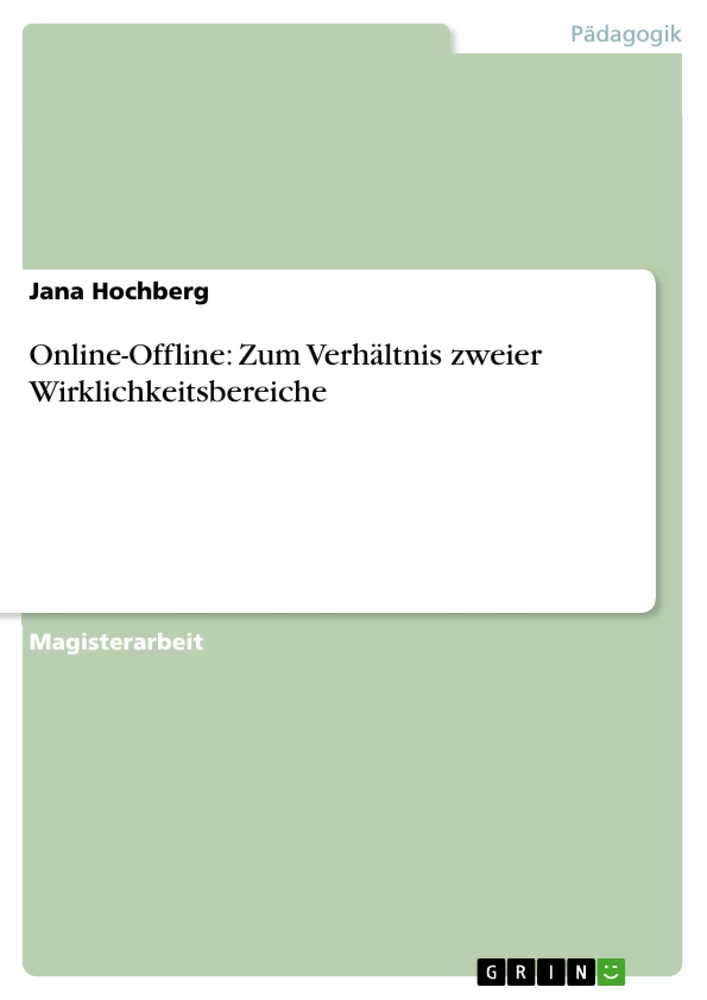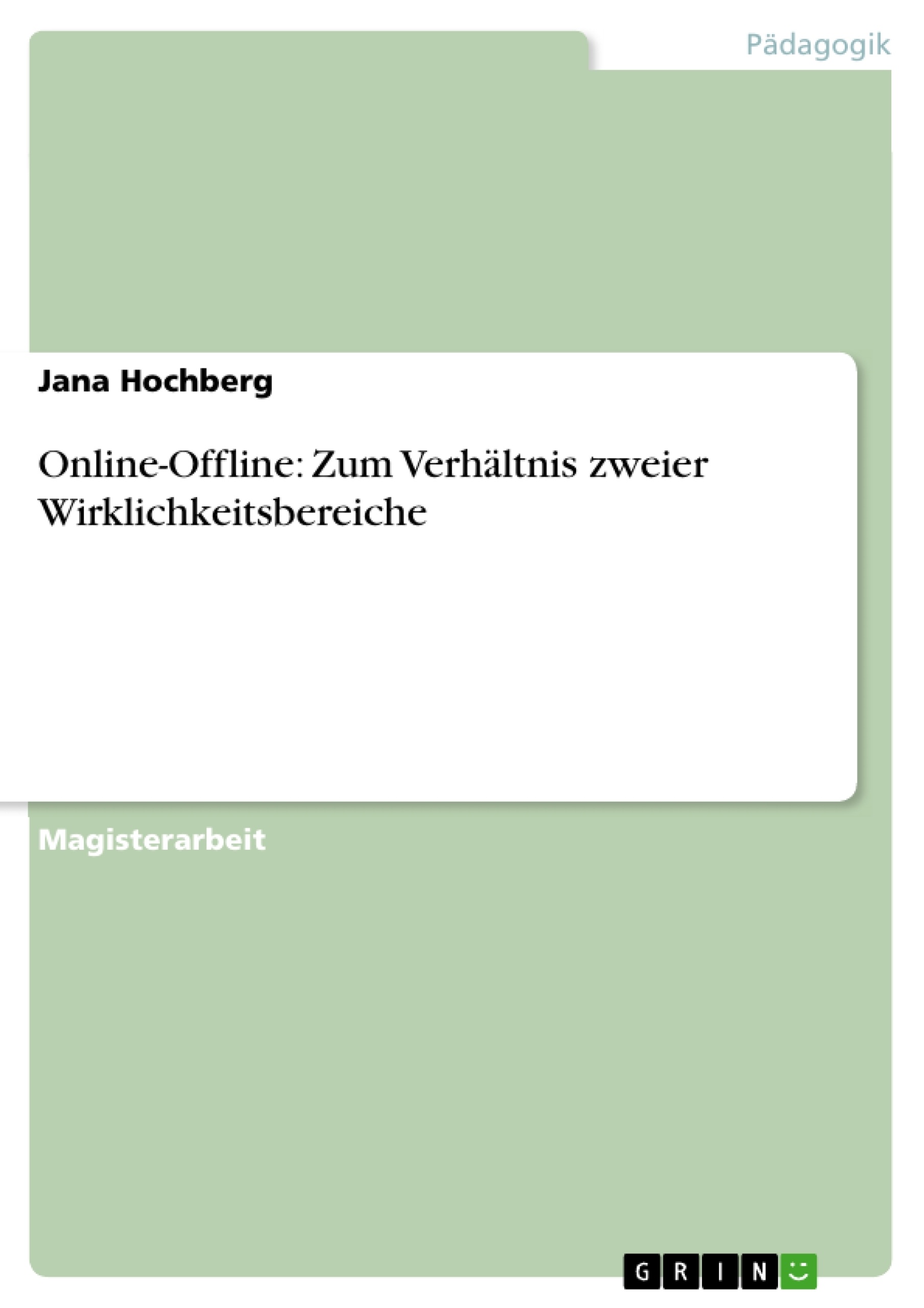„Müssenwir nun nicht gestehen, wenn jemand, der etwas sieht, bemerkt, dieses, was ich hier sehe, will zwar sein wie etwas gewisses anderes, es bleibt aber zurück und vermag nicht zu sein wie jenes, sondern ist schlechter, - daß der, welcher dies bemerkt, notwendig jenes vorher kennen muß, von dem er sagt, daß das andere ihm zwar gleiche, aber doch dahinter zurückbleibe?"
Platon weist unter anderem in diesem Zitat aus dem Phaidon darauf hin, dass das erkennende Subjekt, bei ihm ist es der Mensch, die Ideenwelt von der sichtbaren Welt unterscheiden muss. Auch andere seiner Schriften arbeiten diese klare Differenz immer wieder deutlich heraus. Besonders anschaulich stellt Platon in seinem „Höhlengleichnis“ den Unterschied zwischen der Sinnenwelt und der Ideenwelt dar. Beide Welten werden von Platon als gegensätzlich verstanden.
Für die Ideenwelt liegt in der Philosophie Platons der ontologische Wahrheitsbegriff zugrunde. Die ontologische Wahrheit ist die erkenntnistheoretische Basis in Platons Forschungen. Deutlicher wird Platons Verständnis von der Idee, als dem Wahren entsprechend, wenn als Gegensatz die Sinnenwelt zum Verständnis hinzugezogen wird. Bei der sinnlichen Wahrnehmung, die die Sinnenwelt erschließt, handelt es sich um eine subjektive Wahrnehmung durch eben die Sinne. Diese ist unzuverlässig, da sie sich ständig ändert. So kann beispielsweise die sinnliche Betrachtung eines Objektes zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aus verschiedenen Perspektiven zu verschiedenen Ergebnissen führen. Platons Idee, seine ontologische Wahrheit, ist hingegen unveränderlich und mit sich selbst jederzeit identisch. Daher ist diese Wahrheit zeitlos. Aus diesem Grunde fordert Platon den Philosophen auf, dem Leib und seinen Sinnen zu entsagen, da er sonst die reine Wahrheit niemals erblicken könne. Die Sinne dienen als Material der Erkenntnis. Wie kann aus den einzelnen Sinneswahrnehmungen nach Platon die Wahrheit geschaut werden? Platon vergleicht die Inhalte der verschiedenen Sinneswahrnehmungen miteinander und hebt ihre wesentlichen Merkmale, also Merkmale, die allen bisherigen Sinneswahrnehmungen gemeinsam waren, heraus.
Inhaltsverzeichnis
- I Vorüberlegungen
- 1 Einleitung
- 1.1 Was kann der Leser von diesem Text erwarten?
- 1.2 Darstellung einiger Ausschnitte aus der Wissenschaft, die sich unter anderem mit Communities auseinander setzen.
- 1.3 Was ist das Ziel dieser Arbeit und wie gliedert sie sich?
- II Ausgangsfragen
- 2 Mediengeschichte und der damit einhergehende Wandel von der Kommunikationsvorstellung
- 2.1 Was ist ein Medium? Wozu dient ein Medium?
- 2.2 Wie verändert sich die Vorstellung von der Welt, in der man lebt, durch den Übergang von der Oralität zur Literalität?
- 2.3 Auswirkungen des Buches während des Übergangs von der Stände- zur Industriegesellschaft
- 2.4 Der Übergang zur technologischen Revolution und die damit einhergehenden Entwicklungen von Globalisierung und Dezentralisierung
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Methodisches Vorgehen
- 3.1 Ansatz
- 3.2 Datenerhebung und Dokumentation
- 3.3 Aufbereitungsverfahren
- 3.4 Auswertungsverfahren
- III Schlüsselthemen
- 4 Virtuelle und reale Welten - Wie verschieden sind sie?
- 4.1 Vergleich von „Real Life“-Gemeinschaften und „Virtual Life“-Gemeinschaften
- 4.1.1 Wie wird man Mitglied einer Gemeinschaft?
- 4.1.2 Die Bedeutung von Regeln und Ritualen innerhalb einer Gemeinschaft
- 4.1.3 Wie gliedert sich die soziographische Struktur in Gemeinschaften?
- 4.1.4 Wie erfolgt die Selbstdarstellung in den virtuellen Gemeinschaften?
- 4.2 Zusammenfassung
- 4.1 Vergleich von „Real Life“-Gemeinschaften und „Virtual Life“-Gemeinschaften
- 5 Der Körper in der virtuellen Sozialisation
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Bedeutung von Körperlichkeit im Datenstrom und im „Real Life“
- 5.2.1 Die Wahrnehmung wird im neuen virtuellen „Spielfeld“ verändert
- 5.2.2 Existieren Momente, in denen die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt ineinander fließen?
- 5.3 Das virtuelle „Ich“ konstruiert seine digitale Umgebung
- 5.3.1 In welcher Form existiert der Körper in der virtuellen Gemeinschaft?
- 5.3.2 Der virtuelle Körper und seine sozialen Aspekte
- 5.4 Zusammenfassung
- IV Herausforderungen
- 6 Schlussfolgerungen für die Pädagogik
- 6.1 Welche Bedeutung hat die Medienkompetenz in der vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts?
- 6.2 Welchen Umgang bevorzugen häufige Besucher von virtuellen Welten?
- 6.3 Kann eine pragmatische Umgangsweise den User in seiner Erfahrung der beiden Welten unterstützen?
- V Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Verhältnis zwischen Online- und Offline-Wirklichkeitsbereichen. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten virtueller und realer Gemeinschaften zu analysieren und die pädagogischen Implikationen dieser Erkenntnisse zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf einem Vergleich verschiedener Aspekte des sozialen Lebens in beiden Bereichen.
- Der Wandel der Kommunikationsvorstellung durch die Mediengeschichte
- Vergleich von Strukturen und Interaktionen in virtuellen und realen Gemeinschaften
- Die Rolle des Körpers in der virtuellen Sozialisation
- Die Bedeutung von Medienkompetenz im 21. Jahrhundert
- Pragmatische Umgangsweisen mit virtuellen und realen Welten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und veranschaulicht anhand von Platons Philosophie den Unterschied zwischen der Ideenwelt und der Sinnenwelt. Sie dient als Ausgangspunkt für die Betrachtung der verschiedenen Wirklichkeitsbereiche (online/offline) und ihrer Interdependenzen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
2 Mediengeschichte und der damit einhergehende Wandel von der Kommunikationsvorstellung: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Medien und deren Einfluss auf unser Verständnis von Kommunikation und Wirklichkeit. Es analysiert den Wandel von der Oralität zur Literalität, die Rolle des Buches und die Auswirkungen der technologischen Revolution auf Globalisierung und Dezentralisierung, um den Kontext für die Untersuchung virtueller Gemeinschaften zu schaffen.
3 Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die methodischen Ansätze, die Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten, die für die Arbeit verwendet wurden. Es legt die Grundlage für die wissenschaftliche Validität der Ergebnisse.
4 Virtuelle und reale Welten - Wie verschieden sind sie?: Dieses Kapitel vergleicht die Gemeinschaftsstrukturen in realen und virtuellen Welten. Es untersucht die Mitgliedschaft, Regeln, Rituale, soziographische Strukturen und die Selbstdarstellung in virtuellen Gemeinschaften. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Welten.
5 Der Körper in der virtuellen Sozialisation: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Körperlichkeit im Kontext virtueller Kommunikation. Es analysiert die veränderte Wahrnehmung im virtuellen Raum und diskutiert die Frage, inwieweit virtuelle und reale Welten verschmelzen. Es untersucht die Konstruktion des virtuellen "Ich" und dessen soziale Aspekte.
Schlüsselwörter
Online-Kommunikation, Offline-Wirklichkeit, Virtuelle Gemeinschaften, Reale Gemeinschaften, Medienkompetenz, Mediengeschichte, Sozialisation, Körperlichkeit, Identität, Globalisierung, Dezentralisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Virtuelle und Reale Gemeinschaften
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Verhältnis zwischen Online- und Offline-Wirklichkeitsbereichen. Im Fokus steht der Vergleich virtueller und realer Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sowie die daraus resultierenden pädagogischen Implikationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schlüsselthemen: den Wandel der Kommunikationsvorstellung durch die Mediengeschichte, den Vergleich von Strukturen und Interaktionen in virtuellen und realen Gemeinschaften, die Rolle des Körpers in der virtuellen Sozialisation, die Bedeutung von Medienkompetenz im 21. Jahrhundert und pragmatische Umgangsweisen mit virtuellen und realen Welten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Vorüberlegungen (Einleitung und Forschungsfragen), Ausgangsfragen (Mediengeschichte und methodisches Vorgehen), Schlüsselthemen (Vergleich virtueller und realer Welten und die Rolle des Körpers in der virtuellen Sozialisation), Herausforderungen (Schlussfolgerungen für die Pädagogik) und Abschluss. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Unterpunkte, die die jeweiligen Themenbereiche umfassend beleuchten.
Welche Methode wurde in der Arbeit angewendet?
Kapitel 3 beschreibt detailliert die methodischen Ansätze, die Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten. Die Arbeit legt Wert auf die wissenschaftliche Validität der Ergebnisse.
Wie werden virtuelle und reale Gemeinschaften verglichen?
Kapitel 4 vergleicht die Gemeinschaftsstrukturen in realen und virtuellen Welten anhand von Kriterien wie Mitgliedschaft, Regeln, Rituale, soziographische Strukturen und Selbstdarstellung. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Welten.
Welche Rolle spielt der Körper in der virtuellen Sozialisation?
Kapitel 5 analysiert die Bedeutung von Körperlichkeit im Kontext virtueller Kommunikation. Es untersucht die veränderte Wahrnehmung im virtuellen Raum, die Frage der Verschmelzung virtueller und realer Welten, sowie die Konstruktion des virtuellen „Ich“ und dessen soziale Aspekte.
Welche Schlussfolgerungen werden für die Pädagogik gezogen?
Kapitel 6 befasst sich mit den pädagogischen Implikationen der Untersuchung. Es beleuchtet die Bedeutung von Medienkompetenz im 21. Jahrhundert, den Umgang häufiger Besucher virtueller Welten und die Möglichkeit einer pragmatischen Umgangsweise, die User in ihrer Erfahrung beider Welten unterstützt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Online-Kommunikation, Offline-Wirklichkeit, Virtuelle Gemeinschaften, Reale Gemeinschaften, Medienkompetenz, Mediengeschichte, Sozialisation, Körperlichkeit, Identität, Globalisierung, Dezentralisierung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und ist für die Analyse von Themen im Kontext von virtuellen und realen Gemeinschaften bestimmt.
- Quote paper
- Jana Hochberg (Author), 2005, Online-Offline: Zum Verhältnis zweier Wirklichkeitsbereiche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53906