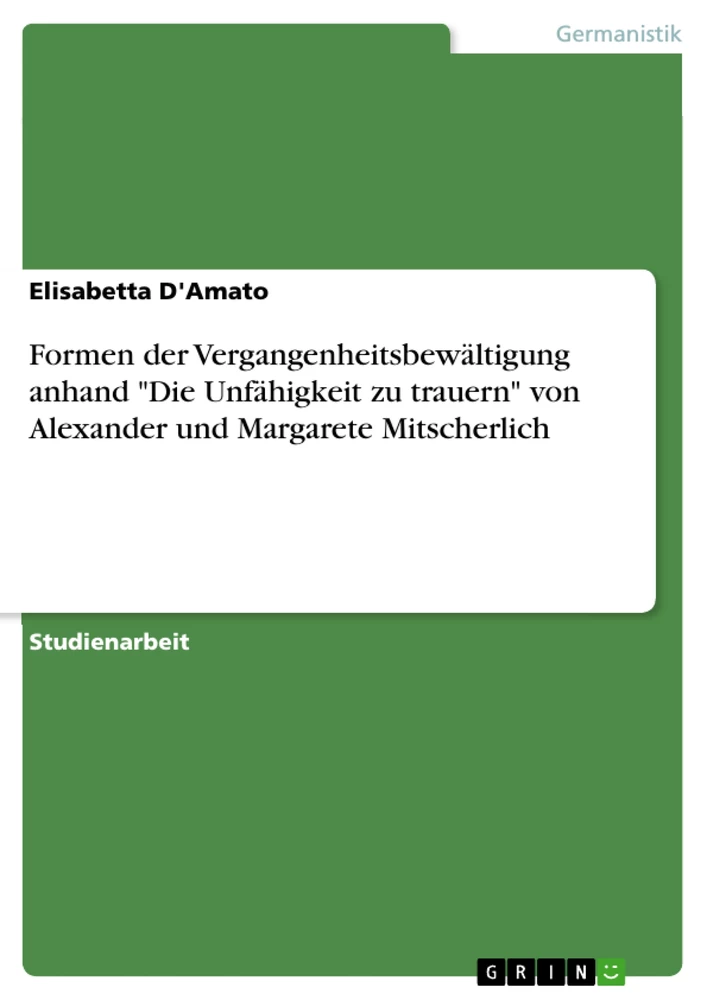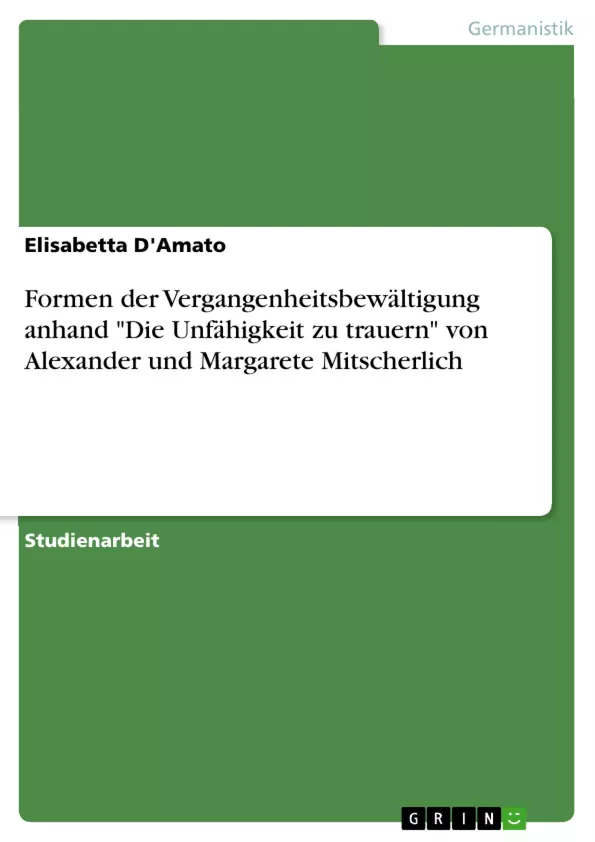In dieser Arbeit wird an Hand der Erläuterungen von Alexander und Margarete Mitscherlich in deren Werk "Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens" das Verhältnis der Deutschen zu den Geschehnissen im Nationalsozialismus, eben deren Form der Vergangenheitsbewältigung, untersucht.
Dieses Buch, ein gesellschaftsanalytisches Werk, ist im Jahre 1967 erschienen.
Es wird analysiert inwieweit beziehungsweise ob sich die Deutschen, wobei hier der Schwerpunkt auf die ehemalige BRD gelegt wird, überhaupt mit den damaligen Ereignissen und ihrer Mitschuld daran auseinandersetzen, inwiefern also eine Vergangenheitsbewältigung stattfand. In diesem Buch werden die "psychischen Prozesse in großen Gruppen, als deren Folge sich Freiheit oder Unfreiheit der Reflexion und der Einsicht ausbreiten" , näher betrachtet. Es soll der Versuch unternommen werden, mit Hilfe psychologischer Interpretation "einigen Grundlagen der Politik näherzukommen". Interpretiert werden soll also das, was Politik macht, nämlich menschliches Verhalten in großer Zahl.
Im Blickpunkt steht jene Generation, die den Nationalsozialismus im Erwachsenenalter aktiv miterlebt hat, die also eine aktive Rolle als Täter oder auch als "Dulder" (oder wie allgemein geläufig, als Mitläufer) spielte und somit als kleine oder große Rädchen im Getriebe der Realisierung der nationalsozialistischen Ideale, unbeachtet der verbrecherischen Methoden, die vorgeblich als Mittel zum Zweck dienten, verhalf.
Gefragt wird nach den unterschiedlichen Umgangsformen dieser Generation mit der NS-Vergangenheit. Die Erziehung, Werte und die Moral dieser Generation spielen eine entscheidende Rolle, um zu verstehen, was diese Generation dazu brachte sich mit den Idealen des Nationalsozialismus oder gar mit Hitler zu identifizieren und diesen Idealen bedingungslos zu dienen.
Die Autoren dieses Buches versuchten eine Antwort auf die Frage zu geben, warum die Trauer um die Millionen Opfer des Dritten Reiches nicht stattfand.
Einleitend folgt eine Biographie der beiden Autoren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Alexander Mitscherlich
- Margarete Mitscherlich
- Bewältigung der Vergangenheit
- Situation nach dem 2. Weltkrieg
- Negation der Geschichte
- Situation vor dem 2. Weltkrieg
- Moral und Wertevorstellungen
- Das Kaiserreich (1900-1914)
- Der 1. Weltkrieg (1914-1918) und der damit verbundene Versailler Vertrag
- Die Weimarer Republik (1918-1933)
- Geistige Wegbereiter des Nationalsozialismus
- Antisemitismus
- „Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens.“
- Zusammenfassung und Erläuterungen zu dem Buch
- Die direkte Konfrontation mit NS-Tätern und Mitläufern und ihre Techniken der Entwirklichung
- Ursachen für den blinden Gehorsam
- Fanatischer Patriotismus
- Politischer und sozialer Immobilismus
- Der Führer als Ich-Ideal
- Ist die Trauerarbeit noch möglich?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verhältnis der Deutschen zu den Geschehnissen im Nationalsozialismus und deren Form der Vergangenheitsbewältigung zu untersuchen. Der Fokus liegt auf den Erläuterungen von Alexander und Margarete Mitscherlich in ihrem Werk „Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens“.
- Die Unfähigkeit der Deutschen, die Vergangenheit zu bewältigen und die Trauer um die Opfer des Nationalsozialismus zuzulassen
- Die Analyse der psychologischen Prozesse in großen Gruppen und deren Einfluss auf die individuelle Freiheit und Einsicht
- Die Rolle von Erziehung, Werten und Moral bei der Identifikation mit nationalsozialistischen Idealen
- Die Untersuchung der Abwehrmechanismen, die die Konfrontation mit der NS-Vergangenheit erschwerten
- Die Darstellung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Verbrechen des Nationalsozialismus möglich machten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung und den Rahmen der Arbeit. Anschließend werden die Biografien von Alexander und Margarete Mitscherlich vorgestellt. Das dritte Kapitel beleuchtet die Situation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die Herausforderungen der Vergangenheitsbewältigung. Im vierten Kapitel wird die Situation vor dem Zweiten Weltkrieg und die Entstehung des Nationalsozialismus beleuchtet.
Das fünfte Kapitel analysiert das Werk „Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens“ und untersucht die Ursachen für die Unfähigkeit der Deutschen, die Vergangenheit zu bewältigen. Es werden die Mechanismen der Entwirklichung, der blinde Gehorsam, der fanatische Patriotismus, der politische und soziale Immobilismus sowie die Rolle des Führers als Ich-Ideal diskutiert. Abschließend wird die Frage gestellt, ob eine Trauerarbeit noch möglich ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Schwerpunkte liegen auf den psychologischen und sozialen Faktoren, die die Unfähigkeit der Deutschen zur Trauerarbeit erklären. Im Mittelpunkt stehen die Analyse des Werkes von Alexander und Margarete Mitscherlich „Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens“, die Rolle des Nationalsozialismus, die Identifikation mit autoritären Ideologien, die Abwehrmechanismen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Verbrechen des Nationalsozialismus ermöglichten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von "Die Unfähigkeit zu trauern"?
Die Mitscherlichs analysieren, dass die deutsche Nachkriegsgesellschaft Abwehrmechanismen entwickelte, um die Schuld und die Trauer über die Opfer des Nationalsozialismus zu verdrängen.
Welche Rolle spielt der "Führer als Ich-Ideal"?
Die Identifikation mit Hitler als kollektivem Ideal führte dazu, dass sein Sturz als massiver Verlust des eigenen Selbstwertgefühls erlebt wurde, was Trauerarbeit blockierte.
Was sind Techniken der "Entwirklichung"?
Es handelt sich um psychologische Mechanismen, mit denen Täter und Mitläufer die Realität ihrer Taten leugneten oder bagatellisierten, um sich der Verantwortung zu entziehen.
Warum blieb die Trauerarbeit nach 1945 aus?
Laut Mitscherlich verhinderte der Fokus auf den Wiederaufbau und die Negation der Geschichte eine tiefgreifende emotionale Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.
Ist Trauerarbeit laut den Autoren noch möglich?
Das Werk untersucht die Bedingungen, unter denen eine Reflexion und Einsicht in kollektive Verhaltensmuster doch noch zu einer echten Vergangenheitsbewältigung führen können.
- Arbeit zitieren
- Elisabetta D'Amato (Autor:in), 2002, Formen der Vergangenheitsbewältigung anhand "Die Unfähigkeit zu trauern" von Alexander und Margarete Mitscherlich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5391