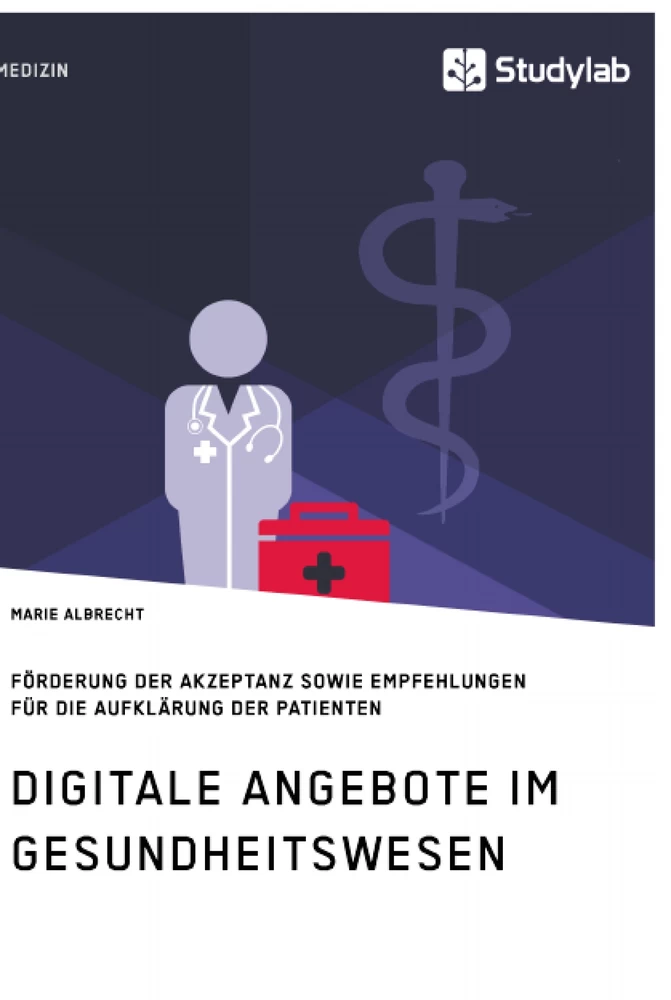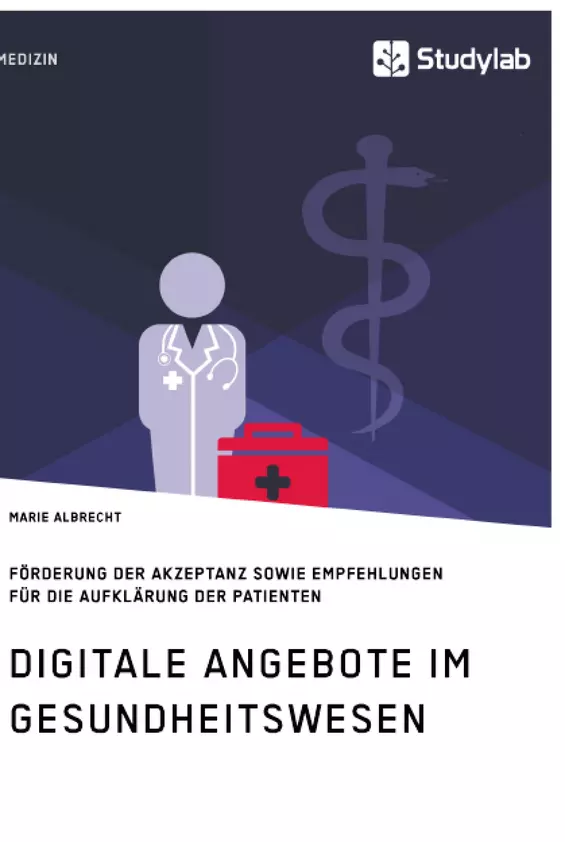Nicht alle Wirtschaftsbranchen sind mit gleicher Intensität in die Digitalisierung eingestiegen. Das Gesundheitswesen in Deutschland gilt dahingehend europaweit als Nachzügler. Das liegt zum Teil daran, dass es bislang noch keine einheitliche Aufklärungskampagne gab, die Patienten über den Einsatz digitaler Technologien informiert hat.
Nehmen Ärzte oder Patienten das derzeitige Angebot besser an? Hat die Bedienungsfreundlichkeit der Apps einen Einfluss auf die Akzeptanz? Sind die Bürger bereit, sich über das Thema zu informieren? Ist der Datenschutz ein relevanter Faktor für die Patientenakzeptanz?
Marie Albrecht untersucht, inwiefern Ärzte und Krankenversicherte in Deutschland digitale Angebote wie Gesundheits-Apps bereits annehmen. Aus den Ergebnissen entwickelt sie eine Patientenbroschüre, in der sie Vorteile und Beispiele der Digitalisierung im Gesundheitswesen verständlich zusammenfasst.
Aus dem Inhalt:
- Telematik;
- Online-Sprechstunde;
- eRezept;
- Telemedizin;
- Digitale Kompetenz;
- Technology-Acceptance-Model
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abstract
- Abbildungs‐ und Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Danksagung
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangslage – Thesis
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Digitalisierung - Definition und Historie
- 2.2 Digitalisierung im Gesundheitswesen
- 2.2.1 Digitalisierung im Gesundheitswesen Deutschland – ist Zustand
- 2.2.2 Vergleich zur Digitalisierung in Gesundheitswesen Ausland
- 2.2.3 Telematikinfrastruktur in Deutschland
- 2.2.4 Zwischenfazit
- 2.3 Digitalisierung im Gesundheitswesen – Chancen und Erwartungen
- 2.3.1 Individualisierung und Personalisierung der Medizin
- 2.3.2 Steigerung der Sicherheit und Effizienz der Leitungen, Behandlungen und Therapien
- 2.3.2.1 Digitalisierung von Prozessen
- 2.3.2.2 Digitalisierung bei Diagnostik
- 2.3.2.3 Digitalisierung bei Behandlung
- 2.3.2.4 Digitalisierung bei Vorsorge / Reha / Pflege
- 2.3.3 Digitalisierung im Gesundheitswesen – Kosten und Personal sparend
- 2.3.4 Digitalisierung im Gesundheitswesen – Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung in die Praxis
- 2.4 Literatur-Auswertung
- 2.4.1 Gesundheitssystem Deutschlands – Stakeholder Netzwerk
- 2.4.2 Digitalisierung im Gesundheitswesen - ein Gewinn für alle Teilnehmer
- 2.4.2.1 Digitalisierung im Gesundheitswesen - Gewinn für Patienten und andere Versicherte Mitglieder
- 2.4.2.2 Gewinn für Krankenhäuser
- 2.4.2.3 Gewinn für niedergelassene Ärzte
- 2.4.2.4 Digitalisierung im Gesundheitswesen - Gewinn für Apotheker vor Ort
- 2.4.2.5 Digitalisierung im Gesundheitswesen - Gewinn für Reha und Pflege
- 2.4.2.6 Digitalisierung im Gesundheitswesen - Gewinn für Krankenkassen
- 2.4.2.7 Gewinn für Pharma- und Medizintechnikindustrie
- 2.4.3 Digitale Kompetenz der Bevölkerung in der BRD
- 2.4.4 Akzeptanz der Digitalisierung im Gesundheitswesen unter der Bevölkerung in Rahmen des Technology-Acceptance-Model nach Davis (1989)
- 2.4.4.1 Akzeptanz
- 2.4.4.2 Technology-Acceptance-Model nach Davis (1989)
- 2.4.4.3 Entwicklung im Sinne des Technologieakzeptanzmodels in der Realität - Beispiel: Entwicklung einer „In-Ohr-Sensorik“
- 3 Methodik
- 3.1 Patienten / Versicherten Online-Umfrage zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
- 3.2 Studiendesign und Teilnehmer
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Ergebnisse - Häufigkeitsdaten
- 4.2 Ergebnisse – Korrelationen
- 5 Diskussion
- 5.1 Bereitschaft
- 5.2 Digitalkompetenz
- 5.3 Aufklärung
- 5.4 Technology-Acceptance-Model nach Davis (1989)
- 5.5 Datenschutz
- 6 Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Der Patientenaufklärungsflyer
- Akzeptanz der Digitalisierung im Gesundheitswesen
- Aufklärung von Patienten und anderen Versicherungsmitgliedern
- Digitalkompetenz der Bevölkerung
- Datenschutz und Datensicherheit
- Technology-Acceptance-Model nach Davis (1989)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Akzeptanz der Digitalisierung im Gesundheitswesen unter den Stakeholdern des Gesundheitssystems in Deutschland. Ziel der empirischen Untersuchung ist die Analyse des Status Quo der Akzeptanz der Digitalisierung im Gesundheitswesen unter der Bevölkerung. Aus den Ergebnissen der Forschung soll eine optimale, gezielte Strategie zur Verbesserung der Aufklärung von Patienten und anderen Versicherungsmitgliedern zu diesem Thema entwickelt werden.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Ausgangslage und die Thesis der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Digitalisierung im Gesundheitswesen, einschließlich Definitionen, Historie, Chancen und Herausforderungen. Es werden wichtige Akteure des Gesundheitssystems (Stakeholder) vorgestellt und die aktuelle Situation der Digitalisierung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern betrachtet. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die in Form einer quantitativen Online-Umfrage unter Patienten und Versicherten durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Umfrage werden in Kapitel 4 präsentiert und in zwei Kategorien gegliedert: deskriptive Statistik und Korrelationen. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse und stellt die Bedeutung von Aufklärung, Digitalkompetenz und Datenschutz für die Akzeptanz der Digitalisierung im Gesundheitswesen heraus. Das Fazit der Arbeit findet sich in Kapitel 6.
Schlüsselwörter (Keywords)
Digitalisierung, Gesundheitswesen, Akzeptanz, Aufklärung, Patienten, Digitalkompetenz, Datenschutz, Datensicherheit, Telematikinfrastruktur, ePatientenakte, Telemedizin, Technology-Acceptance-Model, Online-Umfrage.
Häufig gestellte Fragen
Wie steht es um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen?
Deutschland gilt im europäischen Vergleich oft als Nachzügler, da einheitliche Aufklärungskampagnen und Akzeptanz bei Patienten und Ärzten noch ausbaufähig sind.
Was ist das Technology-Acceptance-Model (TAM)?
Es ist ein Modell von Davis (1989), das erklärt, warum Nutzer neue Technologien annehmen – entscheidend sind die wahrgenommene Nützlichkeit und die Bedienungsfreundlichkeit.
Welche digitalen Angebote gibt es bereits für Patienten?
Dazu gehören Gesundheits-Apps, die Online-Sprechstunde, das eRezept, die elektronische Patientenakte und telemedizinische Anwendungen.
Spielt der Datenschutz eine Rolle bei der Akzeptanz?
Ja, Datenschutz und Datensicherheit sind für Patienten zentrale Faktoren, um Vertrauen in digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln.
Wie kann die Akzeptanz digitaler Angebote gesteigert werden?
Durch gezielte Aufklärung (z.B. Patientenbroschüren), die Förderung digitaler Kompetenz und den Nachweis eines echten Mehrwerts für die Behandlung.
- Quote paper
- Marie Albrecht (Author), 2020, Digitale Angebote im Gesundheitswesen. Förderung der Akzeptanz sowie Empfehlungen für die Aufklärung der Patienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539251