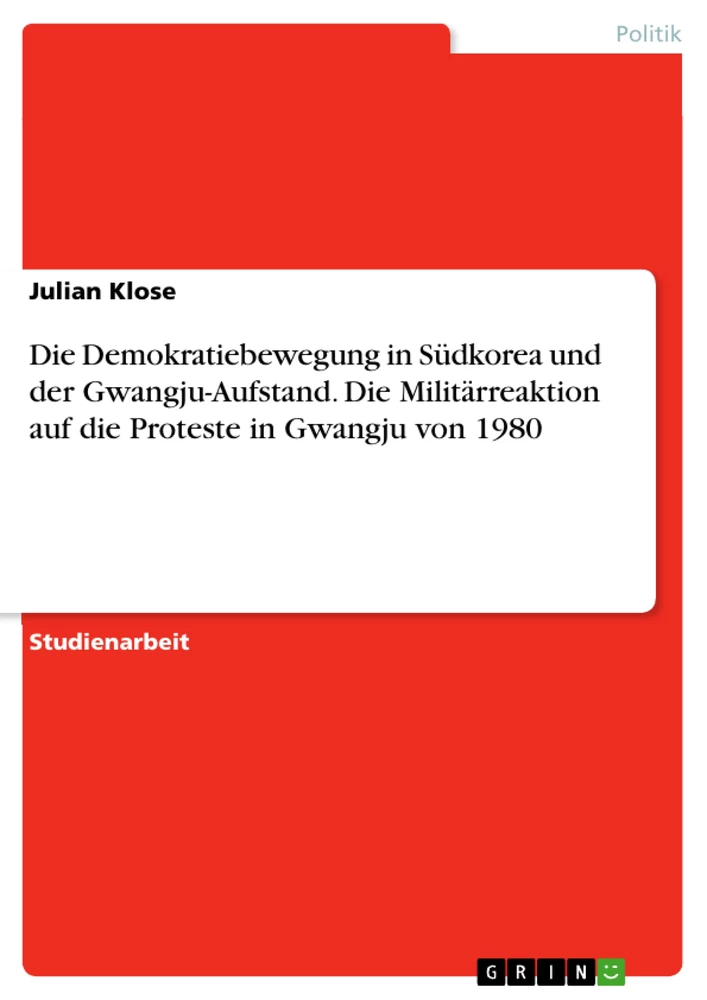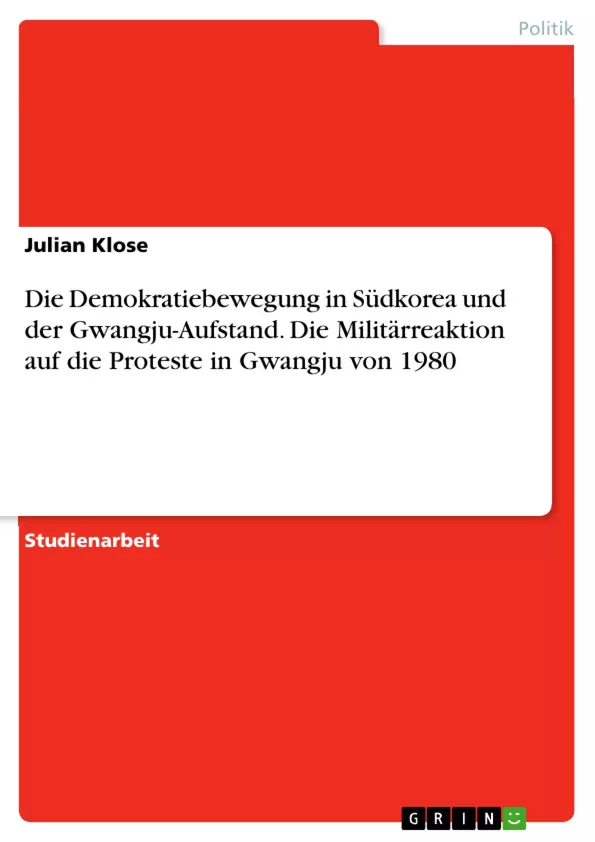Im Rahmen dieser Arbeit soll die Frage untersucht werden, warum das Chun-Regime die Aufstände in Gwangju brutal niederschlug. Dabei wird zunächst untersucht, warum das Militär geschlossen hinter dem Chun-Regime stand. Dabei wird in Anlehnung an das Modell von Terence Lee zur Erklärung von Militärreaktionen auf Massenproteste argumentiert, dass das Chun-Regime das südkoreanische Militär über einen power-sharing-Mechanismus kontrollierte, der ein Überlaufen von Militärs unwahrscheinlich machte, die Hanahoe. Mit Blick auf andere Proteste unter Chun, insbesondere 1987, die letztlich zum Regimewechsel führten, wird jedoch argumentiert, dass power-sharing allein nicht ausreichend ist, um die konkrete Form der Niederschlagung zu erklären. Vielmehr war die Zusammensetzung der Gwangju-Proteste und eine mögliche Bedrohung durch die Demokratische Volksrepublik Korea (im folgenden Nordkorea) ein weiterer Faktor für den konkreten Outcome.
Nach Darlegung der Kernannahmen Lees wird die Methodik erläutert. Anschließend folgt eine Darstellung der Gwangju-Proteste bevor der power sharing-Mechanismus der Hanahoe dargelegt wird. Danach wird analysiert, warum die Charakteristika des Gwangju-Aufstands ebenfalls als notwendige Bedingungen erachtet werden.
Südkorea gilt als Musterbeispiel einer weitgehend gelungenen Demokratisierung im Rahmen der sogenannten Dritten Welle der Demokratisierung. Kehrseite dieser wirtschaftlichen Entwicklung war ein oft autoritärer bis autokratischer Charakter der südkoreanischen Regime. Zwischen 1945 und 1987 entwickelte sich das Land unter Präsident Park Chung-hee zunehmend zur vom Militär geführten Entwicklungsdiktatur. Nach der Ermordung Parks 1979 putschte ein Teil des südkoreanischen Militärs unter Führung des Generalmajors Chun Doo-hwan gegen die demokratische Übergangsregierung unter Choe Kyu-ha. In der Folge brachen erneut landesweite Proteste aus. Besonders heftig waren die Proteste im Mai 1980 in der Stadt Gwangju in der südwestlichen Jeollanam-Provinz aus. Das Chun-Regime entsandte Militär und ließ die anfangs friedlichen Proteste blutig niederschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. FORSCHUNGSDESIGN
- 2.1 METHODIK
- 2.2 THEORETISCHES MODELL NACH LEE (2015)
- 2.3 FALLAUSWAHL
- 3. EMPIRISCHE ANALYSE
- 3.1 DIE GWANGJU-PROTESTE 1980
- 3.2 POWER-SHARING: DIE HANAHOE
- 3.3 DIE CHARAKTERISTIKA DES GWANGJU-AUFSTANDS
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Gwangju im Jahr 1980 durch das südkoreanische Chun-Regime. Sie will die Gründe für diese brutale Reaktion des Militärs beleuchten, wobei der Fokus auf dem Machtteilungssystem ("power-sharing") innerhalb des Militärs liegt.
- Die Rolle des "power-sharing"-Mechanismus im südkoreanischen Militär
- Die Bedeutung der Hanahoe bei der Kontrolle des Militärs
- Die Charakteristika des Gwangju-Aufstands und deren Einfluss auf die Reaktion des Regimes
- Die mögliche Bedrohung durch Nordkorea als Faktor für die Eskalation der Situation
- Die Legitimationskrise des Chun-Regimes im Kontext der Gwangju-Proteste
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung und beleuchtet die historische Entwicklung Südkoreas im Kontext der Demokratisierung und des Wirtschaftswachstums. Dabei wird die Bedeutung des Militärs im südkoreanischen politischen System hervorgehoben. Die zweite Kapitel befasst sich mit dem Forschungsdesign der Arbeit. Es erläutert die Methode der Prozess- und Kongruenzanalyse, die zur Analyse der Militärreaktion auf die Gwangju-Proteste eingesetzt wird. Im dritten Kapitel wird eine detaillierte Darstellung der Proteste in Gwangju 1980 präsentiert, wobei die Besonderheiten dieser Proteste im Vergleich zu anderen Demonstrationen in Südkorea hervorgehoben werden. Anschließend wird der "power-sharing"-Mechanismus der Hanahoe analysiert, der die Loyalität des Militärs gegenüber dem Chun-Regime sicherstellte. Abschließend wird erläutert, welche Besonderheiten des Gwangju-Aufstands die Gewaltbereitschaft des Regimes zusätzlich verstärkten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Militärreaktion auf Massenproteste im Kontext des südkoreanischen Chun-Regimes. Schwerpunkte sind die Analyse des "power-sharing"-Mechanismus der Hanahoe, die Charakteristika des Gwangju-Aufstands und die Bedeutung der Bedrohung durch Nordkorea. Weitere wichtige Begriffe sind Demokratisierung, Entwicklungsdiktatur, Legitimationskrise, Gewalt und Massenproteste.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde der Gwangju-Aufstand 1980 blutig niedergeschlagen?
Das Chun-Regime nutzte militärische Gewalt, um seine Macht zu sichern, wobei Faktoren wie interne Militärkontrolle und die Angst vor Nordkorea eine Rolle spielten.
Was war die "Hanahoe"?
Die Hanahoe war ein geheimer Machtteilungs-Mechanismus ("power-sharing") innerhalb des Militärs, der die Loyalität der Offiziere gegenüber Chun Doo-hwan sicherte.
Welches theoretische Modell wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Modell von Terence Lee zur Erklärung von Militärreaktionen auf Massenproteste.
Welche Rolle spielte Nordkorea bei der Eskalation?
Die mögliche Bedrohung durch Nordkorea wurde vom Regime als Rechtfertigung für die brutale Niederschlagung der Proteste angeführt.
Gilt Südkorea heute als demokratisch?
Ja, Südkorea gilt als Musterbeispiel einer gelungenen Demokratisierung, die jedoch eine Phase autoritärer Militärdiktaturen durchlaufen hat.
- Citation du texte
- Julian Klose (Auteur), 2019, Die Demokratiebewegung in Südkorea und der Gwangju-Aufstand. Die Militärreaktion auf die Proteste in Gwangju von 1980, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539326