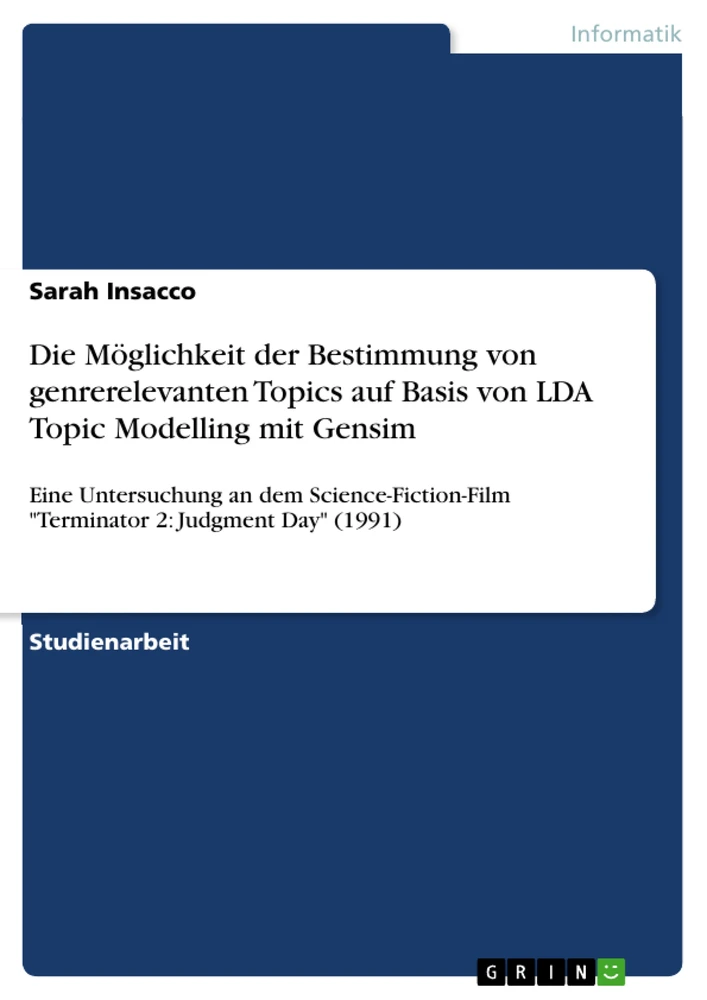Das Science-Fiction-Filmgenre ist etwa seit den 1970er Jahren beständig im öffentlichen Bewusstsein der Mainstream-Popkultur etabliert; es macht sich bemerkbar in Form von popkulturellen Referenzen in unterschiedlichen Medienerzeugnissen, wird aufgrund seines Blockbuster-Potenzials in der Filmindustrie zelebriert und wartet selbst mit einem breiten Spektrum an Produktionen auf, die von vergleichsweise simpel bis komplex und vielschichtig reichen – und dennoch ist es um den aktuellen Forschungsstand um ebendieses Genre in den Film- und Geisteswissenschaften z. T. dürftig bestellt: Während zu einzelnen Science-Fiction-Filmen – oftmals zu den sogenannten Klassikern – eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen existiert, lässt sich für das Filmgenre als solches eine vergleichsweise große Forschungslücke feststellen. Wenngleich sich die Situation zuletzt diesbezüglich leicht gebessert hat, so stellt sich nach wie vor die mitunter drängende – und schwierige – Frage danach, wie sich die narrativen und ästhetischen Aspekte des Science-Fiction-Filmgenres insgesamt gestalten.
Von diesem dargelegten Sachverhalt ist die vorliegende Projektarbeit inspiriert in ihrer zentralen Fragestellung danach, ob die Möglichkeit besteht, mithilfe eines digitalen Verfahrens der quantitativen Textanalyse – Topic Modelling – Topics in Filmskripten bzw. -untertiteln zu identifizieren, die mindestens einen aufschlussreichen Hinweis darauf geben können, wie sich Filme aus einem bestimmten Genre insbesondere auf einer narrativen Ebene zusammensetzen. Für diese Projektarbeit ist ein Film ausgesucht worden – Terminator 2: Judgment Day –, an dem die o.g. Fragestellung im Hinblick auf das ihm zugeordnete Filmgenre – Science-Fiction – auf einer basalen Ebene getestet werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Über das allgemeine Wesen von Filmgenres
- 2.2. Entwicklung eines Profils für das Science-Fiction-Filmgenre
- 3. Methodische Grundlagen: LDA Topic Modelling und Gensim
- 4. Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes Terminator 2: Judgment Day (1991)
- 4.1. Aufschlüsselung des verwendeten Codes für LDA Topic Modelling mit Gensim
- 4.2. Gesammelte Beobachtungen
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Projektarbeit befasst sich mit der Frage, ob es mithilfe des LDA-Topic-Modelling-Verfahrens möglich ist, Topics in Filmskripten bzw. -untertiteln zu identifizieren, die Aufschluss über die narrative Struktur von Filmen aus einem bestimmten Genre geben können. Anhand des Science-Fiction-Films Terminator 2: Judgment Day wird die Fragestellung im Hinblick auf das Genre Science-Fiction auf einer basalen Ebene getestet.
- Das Wesen von Filmgenres und die Entwicklung eines Genreprofils für Science-Fiction-Filme
- Die methodischen Grundlagen des LDA-Topic-Modelling mit Gensim
- Die Anwendung des LDA-Topic-Modelling auf Terminator 2: Judgment Day
- Die Analyse der Ergebnisse und ihre Interpretation
- Die Relevanz der Ergebnisse für die Film- und Genretheorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Projektarbeit ein und erläutert die Forschungslücke im Bereich der Science-Fiction-Filmgenres. Die zentrale Fragestellung wird vorgestellt, die sich mit der Möglichkeit befasst, mithilfe von Topic Modelling Genrerelevante Topics in Filmskripten zu identifizieren.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen Hier werden zunächst die Grundlagen des Genrebegriffs im Allgemeinen beleuchtet, bevor ein detailliertes Profil für das Science-Fiction-Filmgenre entwickelt wird. Dieses Genreprofil dient als Fundament für die LDA-Topic-Modelling-Analyse, die in Kapitel 4 durchgeführt wird.
- Kapitel 3: Methodische Grundlagen Dieses Kapitel widmet sich der Explikation des LDA-Topic-Modelling-Verfahrens und der Verwendung des Tools Gensim für die Analyse von Textdaten. Die theoretischen Grundlagen des Verfahrens werden erläutert, um die praktische Anwendung in Kapitel 4 zu kontextualisieren.
- Kapitel 4: Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes In diesem Kapitel wird der Film Terminator 2: Judgment Day vorgestellt. Der Code für das LDA-Topic-Modelling mit Gensim wird detailliert aufgeschlüsselt. Die im Zuge der Analyse gewonnenen Beobachtungen werden präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Filmgenres, Science-Fiction, LDA-Topic-Modelling, Gensim, quantitative Textanalyse, narrative Struktur, Filmskript, Terminator 2: Judgment Day.
Häufig gestellte Fragen
Was ist LDA Topic Modelling?
LDA (Latent Dirichlet Allocation) ist ein digitales Verfahren der quantitativen Textanalyse, mit dem verborgene Themenstrukturen (Topics) in großen Textmengen automatisiert identifiziert werden können.
Kann man Filmgenres mithilfe von Topic Modelling bestimmen?
Die Projektarbeit untersucht genau diese Möglichkeit und testet, ob sich durch die Analyse von Filmskripten oder Untertiteln genrerelevante Themen finden lassen.
Warum wurde "Terminator 2" als Untersuchungsgegenstand gewählt?
Der Film gilt als Klassiker des Science-Fiction-Genres und bietet eine ideale Basis, um das Verfahren auf narrativer Ebene für dieses spezifische Genre zu testen.
Welche Rolle spielt das Tool "Gensim"?
Gensim ist eine spezialisierte Python-Bibliothek, die in dieser Arbeit verwendet wird, um das Topic Modelling technisch umzusetzen und die Textdaten des Films zu verarbeiten.
Welche Forschungslücke wird in der Arbeit adressiert?
Obwohl zu einzelnen Filmen viel Forschung existiert, gibt es Lücken bei der systematischen Analyse narrativer und ästhetischer Aspekte ganzer Filmgenres durch digitale Methoden.
- Quote paper
- Sarah Insacco (Author), 2017, Die Möglichkeit der Bestimmung von genrerelevanten Topics auf Basis von LDA Topic Modelling mit Gensim, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539421