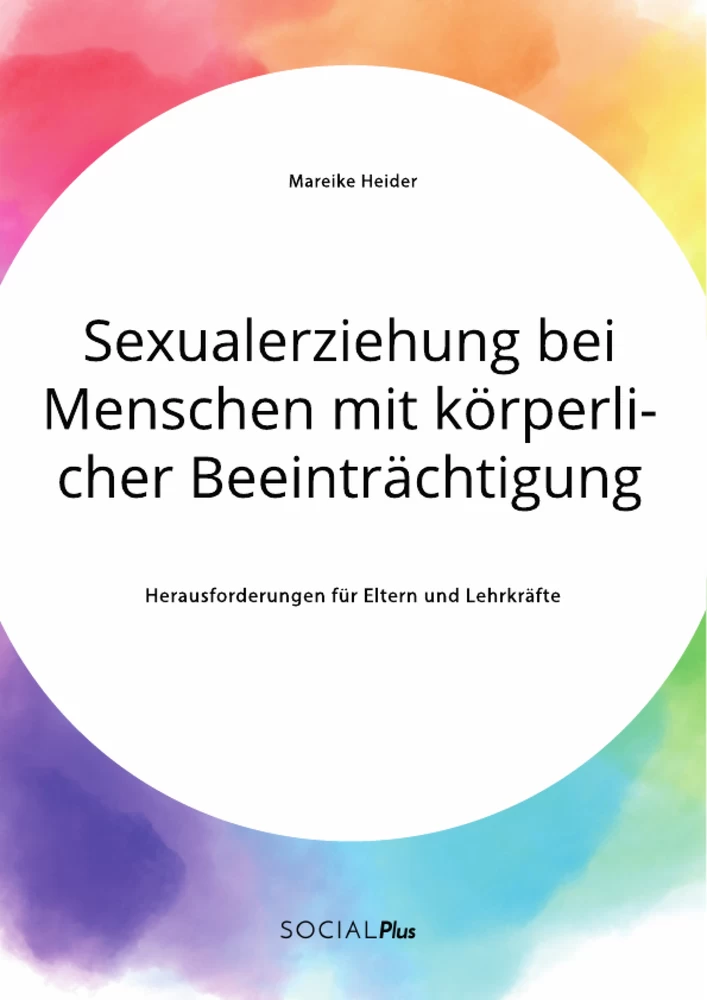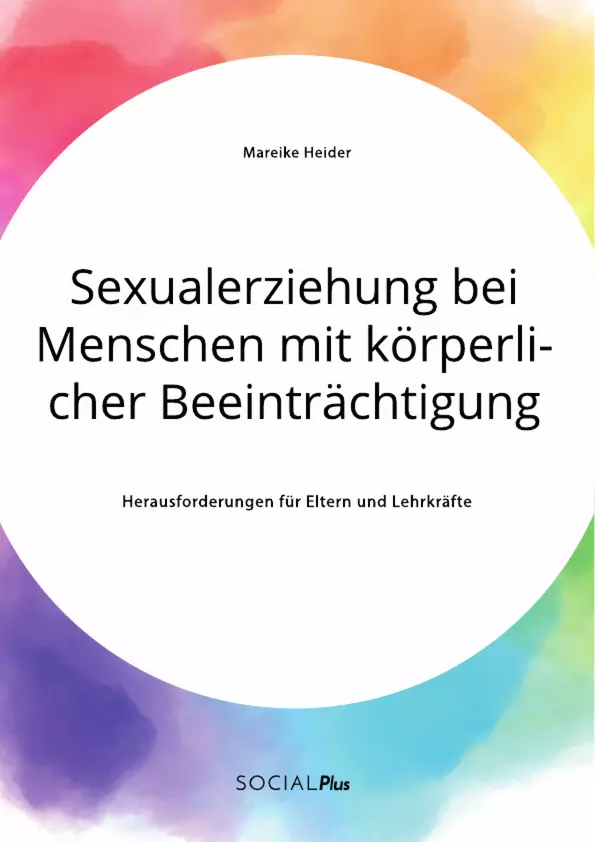Die Debatte um die Anerkennung und Gleichberechtigung verschiedener Sexualitäten ist in den Medien sehr präsent. Sexualität im Zusammenhang mit einer körperlichen Behinderung steht dabei eher im Hintergrund, ist aber ein ebenso wichtiges und brisantes Thema.
Die Inklusion stellt ein vordergründiges Anliegen dar, doch beinhaltet diese Einstellung auch die Sexualität von Menschen mit Behinderung? Wie reagiert die Gesellschaft auf dieses Thema und welche Herausforderungen bringt Sexualität bei Menschen mit einer Körperbehinderung mit sich? Wie stehen sonderpädagogische Lehrkräfte zur Sexualerziehung bei Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung?
Mareike Heider untersucht die Bedeutung der Sexualerziehung als Grundlage für eine gelingende Sexualität bei Menschen mit Körperbehinderung. Dabei erläutert sie verschiedene Einflussfaktoren auf die Sexualität und Sexualerziehung bei den Betroffenen. Besonderes Augenmerk legt sie auf die Rolle der Eltern und sonderpädagogischen Lehrkräfte, denen sie die Teilnahme an Beratungen empfiehlt, um eventuelle Unsicherheiten abzulegen.
Aus dem Inhalt:
- Sexualentwicklung;
- Sexuelles Erleben;
- Aufklärung;
- Sexualpädagogik;
- Inklusion;
- Elternarbeit
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Was bedeutet Sexualität? - Eine Betrachtung aus drei verschiedenen Perspektiven
- Die Biosexuelle Perspektive
- Die Psychoanalytische Perspektive
- Die Soziologische Perspektive
- ,,Behinderte Sexualität“- Einflüsse auf die Sexualität von Menschen mit (Körper-)Behinderung
- Die Entwicklung der Sexualität mit und ohne Behinderung
- Einflüsse auf das Sexuelle Erleben bei Menschen mit Behinderung
- Personale und Soziale Einflüsse auf die Sexualität von Menschen mit Behinderung
- Sexualpädagogik ist nicht gleich Aufklärung
- Definition: Sexualpädagogik in Abgrenzung zur Sexualerziehung und Aufklärung
- Geschichtlicher Exkurs: Sexualpädagogik früher und heute
- Sexualpädagogik und Schule
- Sexualpädagogik in der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung - Forschungsergebnisse zur aktuellen Situation
- Lehrer*innenbefragung zu aktuellen Problemlagen in der Sexualerziehung an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung
- Elterneinstellungen zu Sexualität bei Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Behinderungen und die Erwartungen an die Sexualerziehung in der Schule
- KiSS-Ein Konzept zur kompetenten, integrierenden Sexualpädagogik von Menschen mit körperlichen Schädigungen an Förderschulen
- Zwischenfazit
- Was bedeutet Sexualität? - Eine Betrachtung aus drei verschiedenen Perspektiven
- Methodisches Vorgehen
- Forschungsdesign
- Forschungsmethodisches Vorgehen
- Stichprobe
- Erhebungsinstrumente
- Durchführung
- Vorgehensweise bei der Auswertung
- Empirischer Teil
- Vorstellung der empirischen Ergebnisse
- Darstellung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Methodendiskussion
- Diskussion der empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund des vorgestellten Forschungsstandes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Sexualerziehung bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, insbesondere für Eltern und Lehrkräfte. Sie befasst sich mit der Entwicklung von Sexualität im Kontext von Behinderung, den Einflüssen auf das sexuelle Erleben und den spezifischen Bedürfnissen von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen in der Sexualpädagogik.
- Definition von Sexualität aus verschiedenen Perspektiven
- Einflüsse von Behinderung auf die Entwicklung und das Erleben von Sexualität
- Spezifische Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen in der Sexualpädagogik
- Herausforderungen für Eltern und Lehrkräfte in der Sexualerziehung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen
- Konzepte und Ansätze für eine inklusive Sexualpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beschreibt die Relevanz der Sexualerziehung für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.
- Was bedeutet Sexualität? - Eine Betrachtung aus drei verschiedenen Perspektiven: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition von Sexualität aus biologischer, psychoanalytischer und soziologischer Sichtweise.
- ,,Behinderte Sexualität“- Einflüsse auf die Sexualität von Menschen mit (Körper-)Behinderung: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von Behinderung auf die Entwicklung und das Erleben von Sexualität.
- Sexualpädagogik ist nicht gleich Aufklärung: Dieses Kapitel definiert den Unterschied zwischen Sexualpädagogik und Sexualerziehung und beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Sexualpädagogik.
- Sexualpädagogik in der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung - Forschungsergebnisse zur aktuellen Situation: Dieses Kapitel präsentiert Forschungsergebnisse zu aktuellen Problemlagen in der Sexualerziehung an Förderschulen und stellt verschiedene Konzepte zur integrierenden Sexualpädagogik vor.
- Zwischenfazit: Das Zwischenfazit fasst die wichtigsten Ergebnisse des theoretischen Teils zusammen.
- Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign der Arbeit.
- Forschungsmethodisches Vorgehen: Dieses Kapitel erläutert die gewählte Forschungsmethodik, die Stichprobe, die Erhebungsinstrumente und die Durchführung der Studie.
- Vorstellung der empirischen Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und interpretiert diese im Kontext des bisherigen Forschungsstandes.
Schlüsselwörter
Sexualerziehung, körperliche Beeinträchtigung, Inklusion, Sexualität, Behinderung, Förderschule, Sexualpädagogik, Elternschaft, Lehrkraft, Forschung, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen bietet Sexualerziehung bei Körperbehinderung?
Herausforderungen bestehen oft in gesellschaftlichen Tabus, Unsicherheiten bei Eltern und Lehrkräften sowie spezifischen körperlichen Einschränkungen in der Sexualentwicklung.
Was ist der Unterschied zwischen Sexualpädagogik und Aufklärung?
Sexualpädagogik ist ein umfassenderer Ansatz, der über die reine biologische Information (Aufklärung) hinausgeht und emotionale sowie soziale Aspekte einbezieht.
Welche Rolle spielen sonderpädagogische Lehrkräfte?
Lehrkräfte an Förderschulen sind wichtige Ansprechpartner, stehen jedoch oft vor dem Problem fehlender Konzepte oder Unsicherheiten im Umgang mit dem Thema.
Wie reagieren Eltern auf die Sexualität ihrer behinderten Kinder?
Die Arbeit untersucht Elterneinstellungen und empfiehlt Beratungsangebote, um Ängste abzubauen und eine gesunde Sexualentwicklung zu fördern.
Was ist das KiSS-Konzept?
KiSS ist ein Konzept zur kompetenten, integrierenden Sexualpädagogik für Menschen mit körperlichen Schädigungen an Förderschulen.
- Vorstellung der empirischen Ergebnisse
- Quote paper
- Mareike Heider (Author), 2020, Sexualerziehung bei Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Herausforderungen für Eltern und Lehrkräfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539786