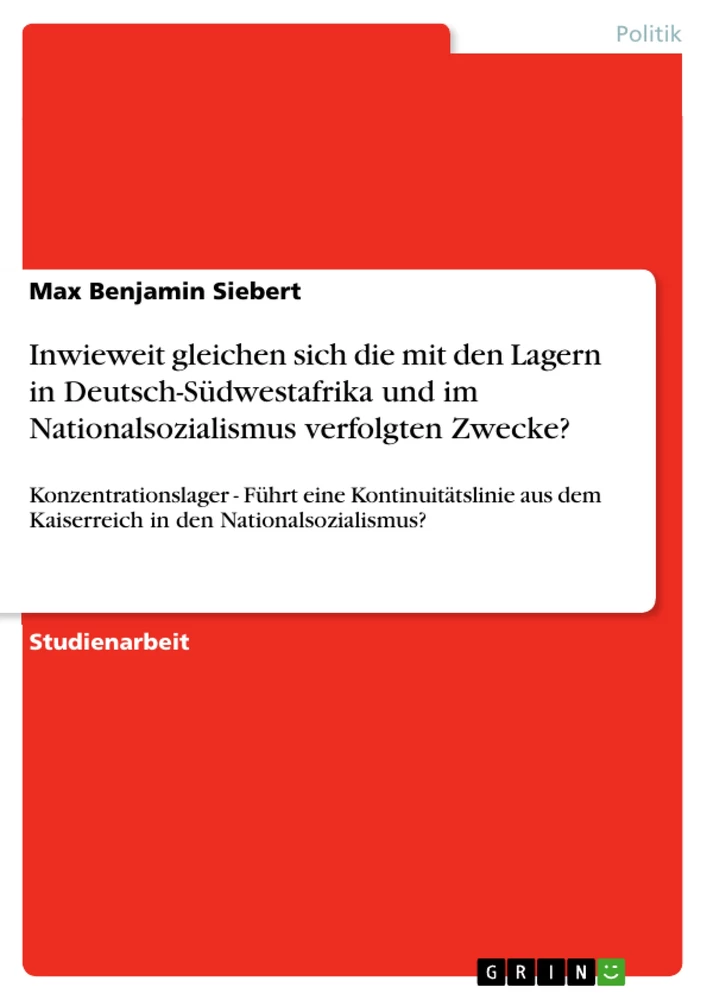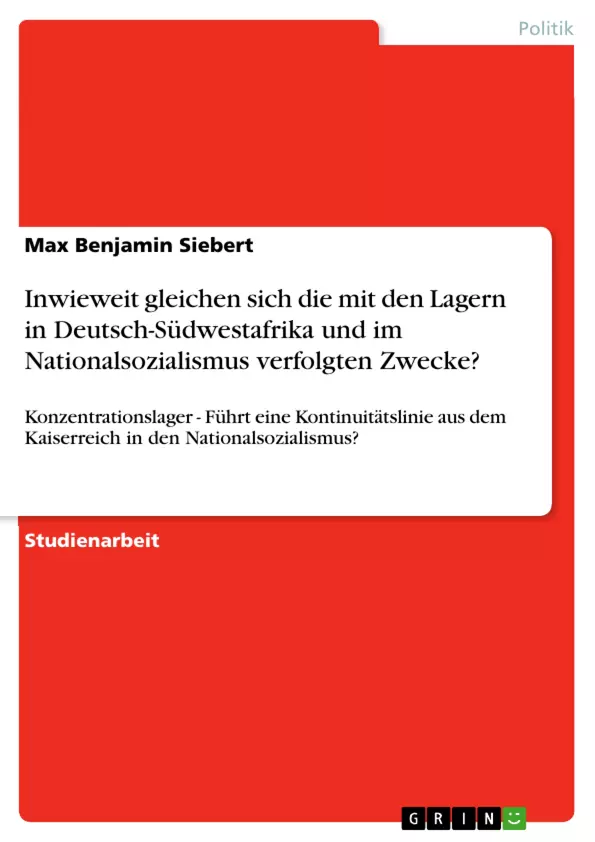Der Nationalsozialismus (im Folgenden mit NS abgekürzt) und seine Verbrechen besitzen nach wie vor Präsenz im kollektiven Gedächtnis der deutschen Gesellschaft. Als die Institution des Staatsterrors wurden die Konzentrationslager in der Zeit von 1933 bis 1945 zu einem regelrechten Netz ausgebildet. So blieb kaum eine Region im deutschen Herrschaftsgebiet von einem dem KZ-System zugehörigen Lager verschont. Unter den Bezeichnungen wie Arbeitserziehungslager, Sonderlager, Polizeihaftlager, Zwangsarbeitslager, Jugendschutzlager, Ghetto oder eben Konzentrationslager geführt, verband sie dieselbe Funktionslogik und stehen stellvertretend für die „Unterdrückung, Misshandlung, Ausbeutung und Vernichtung“ unter nationalsozialistischer Herrschaft. Doch sind die Konzentrationslager keine „Erfindung“ der Nationalsozialisten gewesen. Vielmehr entstammen sie einer weitverbreiteten Praxis kolonialer Kriegsführung. Nicht einmal drei Jahrzehnte vor der Machtergreifung Hitlers wurden Konzentrationslager im deutschen „Schutzgebiet“ Deutsch-Südwestafrika (im Folgenden mit DSWA abgekürzt) errichtet. Die im Kontext des Herero-Aufstandes von 1904 entstandenen und unter selbigem Namen geführten Lager werfen die Frage auf, inwieweit die beiden Lagersysteme ähnliche Zwecke verfolgten und ob sich hinsichtlich dieser, eine Kontinuitätslinie aus dem
kaiserlichen Konzentrations-Lagersystem in der „Schutzzone“ Deutsch-Südwestafrika kurz nach der Jahrhundertwende in den Nationalsozialismus hineinführen lässt beziehungsweise welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszumachen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsherleitung und -klärung - „Konzentrationslager“
- Kontexte der kolonialen und nationalsozialistischen Lager
- Der Krieg in Deutsch-Südwestafrika (1904 bis 1908)
- Kontext und grundlegender Wandel der Lager im Nationalsozialismus (1933-1945)
- Die Zwecke der Lager im Vergleich
- Militärischer Zweck der Lager
- Verhältnis von Erziehung und Arbeit
- Ökonomischer Zweck der Zwangsarbeit
- Vernichtungsintention in den Lagerkontexten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen und Unterschiede zwischen den Konzentrationslagern im deutschen Kolonialgebiet Deutsch-Südwestafrika (DSWA) und den Konzentrationslagern im Nationalsozialismus. Ziel ist es, die Zweckmäßigkeit der Lager in beiden Kontexten zu analysieren und die Kontinuitätslinie von DSWA nach Auschwitz kritisch zu hinterfragen.
- Die Entstehung und Entwicklung der Konzentrationslager in DSWA und im Nationalsozialismus
- Die verschiedenen Zwecke der Lager in beiden Kontexten, insbesondere der militärische Zweck, das Verhältnis von Erziehung und Arbeit, der ökonomische Zweck der Zwangsarbeit und die Vernichtungsintention
- Die Rolle der „Konzentrationslager“ als Instrument der Unterdrückung, Misshandlung, Ausbeutung und Vernichtung
- Die Frage der Kontinuität zwischen den kolonialen und den nationalsozialistischen Lagersystemen
- Die methodische Reduktion des Begriffs „Konzentrationslager“ auf seine wörtliche Bedeutung, um eine suggestive Gleichsetzung der beiden Lagersysteme zu vermeiden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beleuchtet die Bedeutung der Konzentrationslager in der deutschen Geschichte, sowohl im Kontext des Kolonialismus als auch im Nationalsozialismus. Er stellt die These auf, dass die Konzentrationslager in DSWA zwar nicht identisch, aber in ihrer Funktionslogik vergleichbar mit den nationalsozialistischen Lagern sind. Die Arbeit untersucht die Zweckmäßigkeit der Lager in beiden Kontexten und analysiert, ob eine direkte Kontinuitätslinie „von Windhuk nach Auschwitz“ besteht.
Begriffsherleitung und -klärung - „Konzentrationslager“
Der Text stellt die unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „Konzentrationslager“ dar, die sowohl in der Kolonialzeit als auch im Nationalsozialismus verwendet wurden. Er beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und erklärt, wie er in beiden Kontexten verwendet und verstanden wurde.
Kontexte der kolonialen und nationalsozialistischen Lager
Der Krieg in Deutsch-Südwestafrika (1904 bis 1908)
Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext des Herero-Aufstands in DSWA und die Entstehung der ersten Konzentrationslager. Es wird gezeigt, wie die Lager in DSWA dazu dienten, die Herero und Nama zu kontrollieren und zu vernichten.
Kontext und grundlegender Wandel der Lager im Nationalsozialismus (1933-1945)
Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Begriffs „Konzentrationslager“ im Nationalsozialismus. Es wird dargestellt, wie die Lager zur Unterdrückung, Misshandlung, Ausbeutung und Vernichtung von politischen Gegnern, Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und anderen Minderheiten eingesetzt wurden.
Die Zwecke der Lager im Vergleich
Dieses Kapitel vergleicht die verschiedenen Zwecke der Lager in DSWA und im Nationalsozialismus. Es untersucht die militärische Funktion der Lager, das Verhältnis von Erziehung und Arbeit, den ökonomischen Zweck der Zwangsarbeit und die Vernichtungsintention.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Konzentrationslager, Kolonialismus, Nationalsozialismus, DSWA, Herero-Aufstand, Vernichtungsintention, Zwangsarbeit, Erziehung, Militär, Unterdrückung, Misshandlung, Ausbeutung, Kontinuität.
Häufig gestellte Fragen
Waren Konzentrationslager eine Erfindung der Nationalsozialisten?
Nein, die Institution entstammt der kolonialen Kriegsführung. Deutschland errichtete bereits 1904 im heutigen Namibia (Deutsch-Südwestafrika) Konzentrationslager.
Was war der Zweck der Lager in Deutsch-Südwestafrika?
Sie dienten im Kontext des Herero-Aufstandes der militärischen Kontrolle, der Zwangsarbeit und letztlich auch der Vernichtung der indigenen Bevölkerung (Herero und Nama).
Gibt es eine Kontinuitätslinie von DSWA zum Nationalsozialismus?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob eine direkte Linie „von Windhuk nach Auschwitz“ besteht, indem sie Funktionslogiken wie Ausbeutung, Misshandlung und Vernichtungsintention vergleicht.
Wie unterschied sich der Begriff „Konzentrationslager“ in beiden Epochen?
Während er in der Kolonialzeit primär militärisch zur Internierung genutzt wurde, entwickelte er sich im NS-Staat zu einem umfassenden System des Staatsterrors und der industriellen Vernichtung.
Welche Rolle spielte Zwangsarbeit in den kolonialen Lagern?
Zwangsarbeit hatte in DSWA einen starken ökonomischen Zweck, war aber gleichzeitig eng mit der Vernichtungsintention durch unmenschliche Bedingungen verknüpft.
- Arbeit zitieren
- Max Benjamin Siebert (Autor:in), 2020, Inwieweit gleichen sich die mit den Lagern in Deutsch-Südwestafrika und im Nationalsozialismus verfolgten Zwecke?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540050