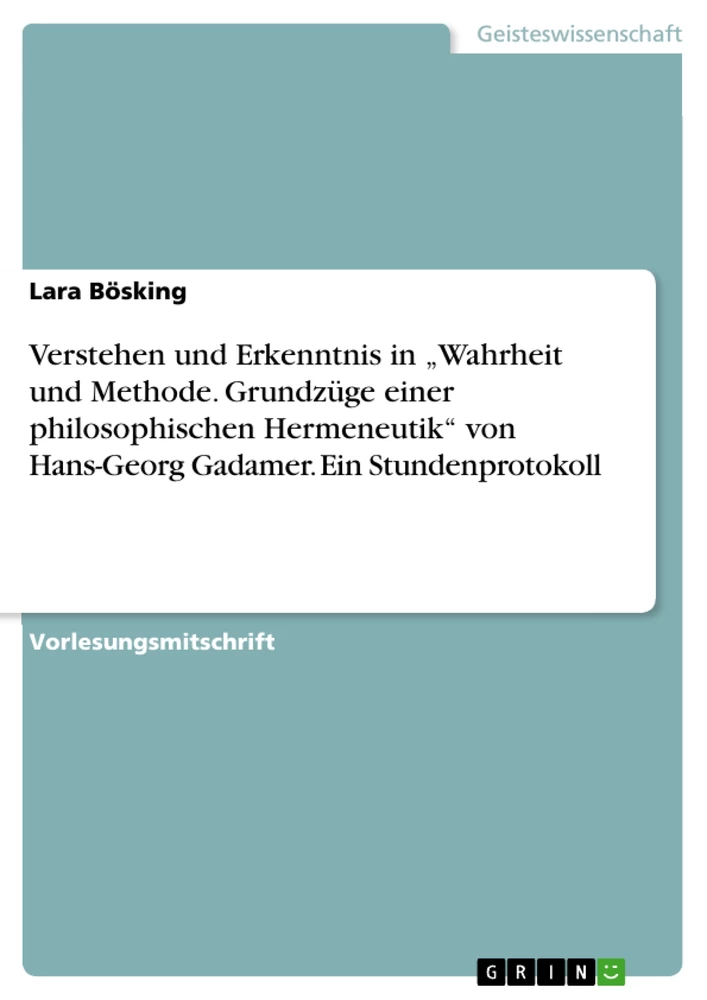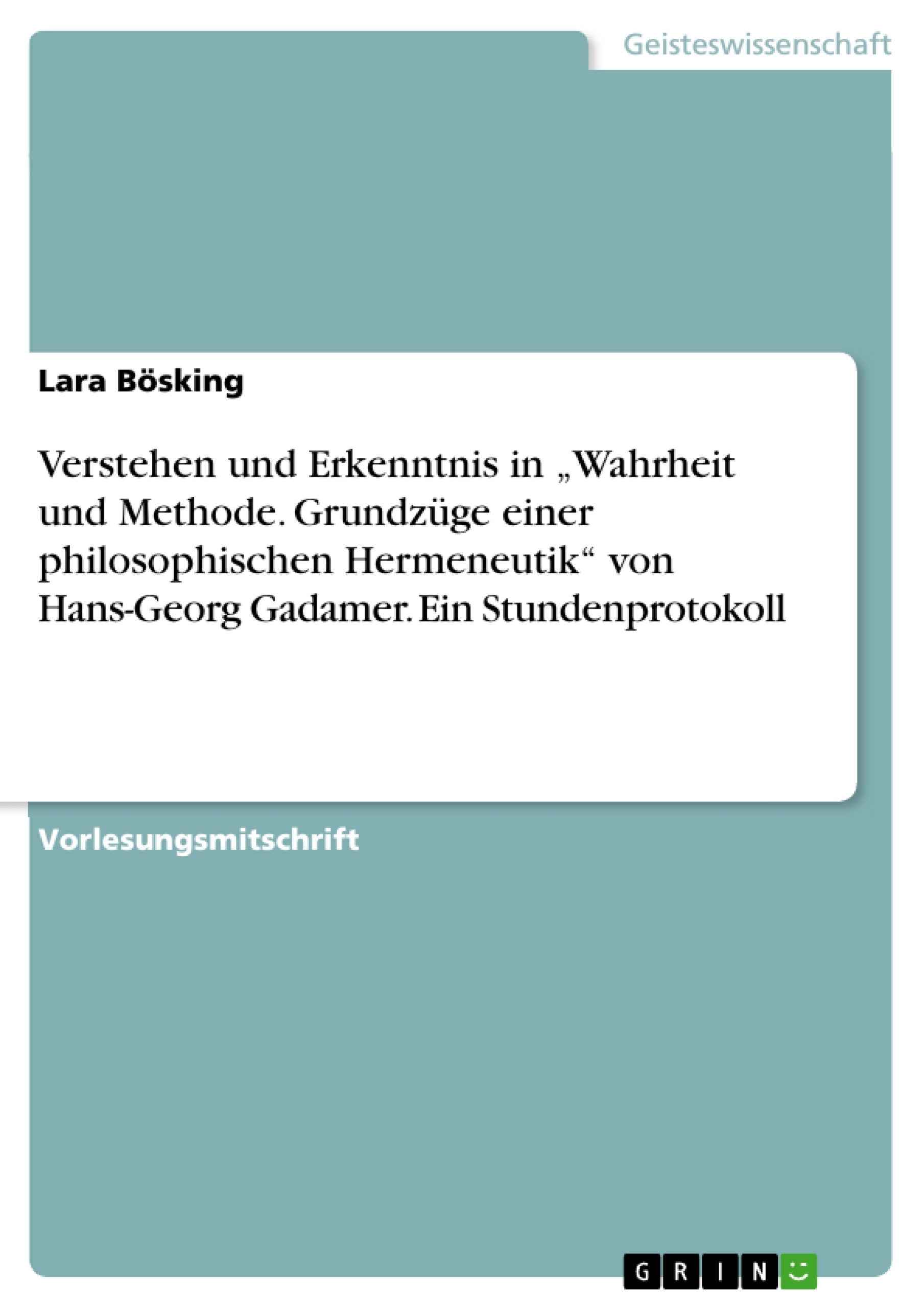In dieser Vorlesungsmitschrift werden insbesondere drei Textabschnitte aus Hans-Georg Gadamers Werk „Wahrheit und Methode - Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“ näher betrachtet und diskutiert. Denn was meint Gadamer mit dem „sachlichen Zutreffen als solches“, das jenseits der methodischen Art der Geltung eines Urteils eine andere Weise darstellen soll? Gibt es ein sachliches Zutreffen als Teil der Erkenntnis oder existiert gar kein sachliches Zutreffen?
Das Ziel der Sitzung ist es noch nicht, diese Fragen beantworten zu können, sondern sich der Beantwortung dieser zu nähern.
Inhaltsverzeichnis
- Einstieg
- Diskussion zum Textabschnitt 1
- Diskussion zum Textabschnitt 2
- Diskussion zum Textabschnitt 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar behandelt die philosophische Hermeneutik von Hans-Georg Gadamer anhand seiner Schrift „Wahrheit und Methode“. Ziel ist es, Gadamers Kritik an der Aufklärung und dem Historismus zu verstehen und seine eigene Hermeneutik als alternative Herangehensweise an das Verstehen zu erforschen.
- Kritik an der Aufklärung und ihrer Interpretation des Vorurteils
- Die Rolle des Historismus bei der Deutung der Vergangenheit
- Gadamers Kritik an der Reprivatisierung der Geschichte durch Dilthey
- Die Begrenzung der menschlichen Vernunft und das Verhältnis zur Geschichte
- Der ontologische hermeneutische Zirkel und die Verschmelzung von Interpret und Interpretandum
Zusammenfassung der Kapitel
Einstieg
Der Einstieg in das Seminar wiederholt die zentrale These der letzten Sitzung: Gadamer rehabilitiert den Begriff des Vorurteils und kritisiert die aufklärerische Tendenz, nur methodisch begründete Urteile als gültig anzuerkennen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es ein „sachliches Zutreffen als solches“ gibt und wie sich dieses mit dem Erkenntnisprozess verbindet.
Diskussion zum Textabschnitt 1
Gadamer analysiert die Bibelkritik der Aufklärung, die die Bibel als historisches Dokument betrachtet und den Geltungsanspruch ihrer Dogmen in Frage stellt. Die Kritik der Aufklärung richtete sich vor allem gegen das Christentum, da es die dominierende Religion der Zeit war. Der Dozent führt aus, dass die Bibelkritik zwei Ebenen umfasst: eine Kontextualisierung der Aussagen und eine Prüfung ihres Geltungsanspruchs. Der Text lässt offen, welchen Aspekt der Aufklärung Gadamer kritisiert.
Diskussion zum Textabschnitt 2
Gadamer beleuchtet die Romantik, die die Ideen der Aufklärung übernimmt und kritisch hinterfragt. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit führt zur Entstehung des Historismus, der eine Verbindung zwischen Aufklärung und Romantik darstellt. Der Historismus betrachtet alle Formen des menschlichen Bewusstseins als historisch bedingt und relativiert den Anspruch auf eine objektive, vernunftbasierte Deutung der Vergangenheit.
Diskussion zum Textabschnitt 3
Gadamer kritisiert Diltheys Hermeneutik, die die Geschichte durch die Rekonstruktion der Lebensgeschichte des Autors verstehen will. Er argumentiert, dass der Interpret nicht die Lebenswelt des Autors nacherleben muss, sondern die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigen sollte, die zur Entstehung eines Textes geführt haben. Gadamer stellt die aufklärerische Idee einer absoluten Vernunft infrage und argumentiert, dass die menschliche Vernunft stets von der Geschichte geprägt ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe des Textes sind: Hermeneutik, Vorurteil, Aufklärung, Historismus, Vernunft, Geschichte, Selbstbestimmung, ontologischer Zirkel, Verstehen, Interpret, Interpretandum.
Häufig gestellte Fragen
Welches Werk von Hans-Georg Gadamer wird hier analysiert?
Die Vorlesungsmitschrift befasst sich mit Gadamers Hauptwerk „Wahrheit und Methode – Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“.
Warum rehabilitiert Gadamer den Begriff des Vorurteils?
Gadamer kritisiert die Aufklärung dafür, nur methodisch begründete Urteile als gültig anzuerkennen. Er argumentiert, dass Vorurteile notwendige Bedingungen des Verstehens sind.
Was kritisiert Gadamer am Historismus?
Er kritisiert, dass der Historismus den Anspruch auf eine objektive Deutung der Vergangenheit erhebt, während menschliche Vernunft tatsächlich immer historisch bedingt und begrenzt ist.
Was ist der „ontologische hermeneutische Zirkel“?
Es beschreibt den Prozess des Verstehens als eine Verschmelzung von Interpret und Interpretandum, bei dem der Ausleger stets Teil der Geschichte bleibt, die er deutet.
Wie steht Gadamer zur Hermeneutik von Wilhelm Dilthey?
Gadamer lehnt Diltheys Ansatz ab, die Lebenswelt eines Autors nacherleben zu wollen. Stattdessen sollten die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Textentstehung im Fokus stehen.
- Quote paper
- Lara Bösking (Author), 2019, Verstehen und Erkenntnis in „Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“ von Hans-Georg Gadamer. Ein Stundenprotokoll, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540073