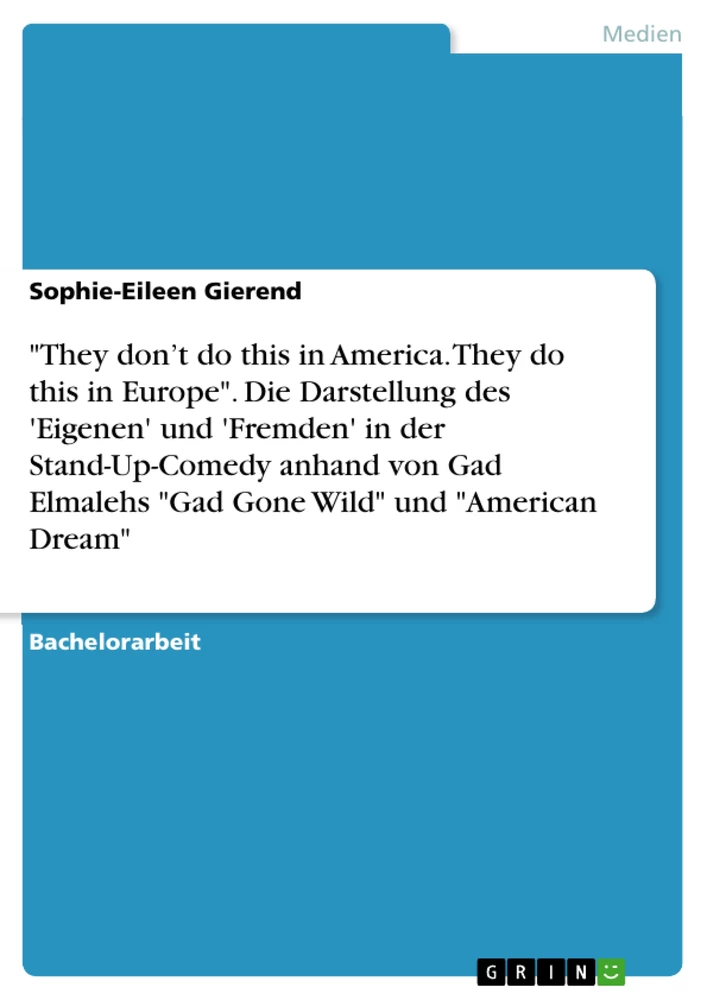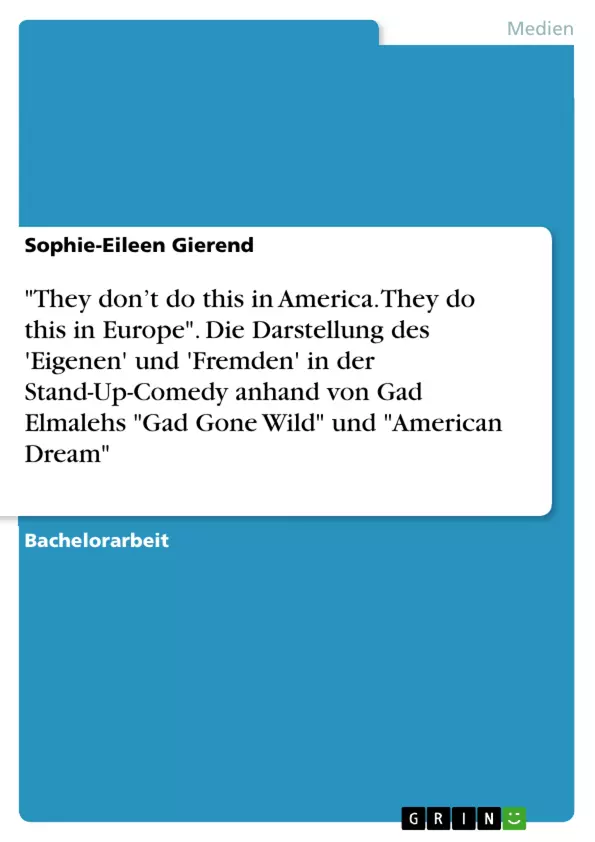Es sollen zunächst die Besonderheiten der Stand-Up-Comedy im Vergleich zu anderen Comedy-Formaten wie Theater- oder Filmkomödien erläutert werden sowie die besondere Beziehung zwischen dem Stand-Up-Comedian und seinem Publikum. Daraufhin folgt der Hauptteil der Untersuchung, der in zwei Kapitel untergliedert ist. Das erste dieser beiden Kapitel umfasst die Betrachtung der Mittel und Vorgehensweise Gad Elmalehs zur Konstruktion des ‚Eigenen‘ und ‚Fremden‘. Dabei stehen die Verfahren der ‚Abgrenzung‘ und ‚Zuschreibung‘ im Vordergrund. Im zweiten Kapitel werden darauf aufbauend die Funktionen von Komik, Humor und Lachen anhand bekannter Humortheorien sowie weiterer Ansätze der Humorforschung bei der Konstruktion analysiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- BESONDERHEITEN DER STAND-UP-COMEDY
- ZUM GENRE
- STAND-UP ALS INTERAKTION
- KONSTRUKTION DES ‚EIGENEN‘ UND ‚FREMDEN‘
- „C’EST TELLEMENT DIFFERENT DE CE QUI SE PASSE EN EUROPE“
ABGRENZUNG DES ‘FREMDEN’ VOM ‘EIGENEN’
- VERBALE, PARAVERBALE UND NONVERBALE ABGRENZUNG
- KULTURELLE BEZUGSGRÖSSEN
- „AMERICANS ARE LIKE… AND FRENCH ARE LIKE…” ZUSCHREIBUNG
VON EIGENSCHAFTEN
- ZUSCHREIBUNGEN
- VORURTEILE ODER REALE UNTERSCHIEDE?
- „C’EST TELLEMENT DIFFERENT DE CE QUI SE PASSE EN EUROPE“
ABGRENZUNG DES ‘FREMDEN’ VOM ‘EIGENEN’
- FUNKTION VON HUMOR, KOMIK UND LACHEN IN DER DARSTELLUNG
DES ‚EIGENEN‘ UND ‚FREMDEN‘
- LACHEN ÜBER DAS ‚EIGENE‘
- LACHEN ÜBER DAS ‚FREMDE‘
- GEMEINSAMES LACHEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit untersucht die Konfrontation des ‚Eigenen‘ und des ‚Fremden‘ in Gad Elmalehs Stand-Up-Shows Gad Gone Wild und American Dream. Dabei soll aufgezeigt werden, wie der Comedian mittels sprachlicher Mittel und nonverbaler Darstellungsweisen die beiden Seiten voneinander abgrenzt und unterschiedliche Charakteristika zuschreibt. Des Weiteren werden die Funktionen von Humor, Komik und Lachen bei der Konstruktion und Darstellung des ‚Eigenen‘ und des ‚Fremden‘ betrachtet.
- Die Konstruktion des ‚Eigenen‘ und des ‚Fremden‘ in Gad Elmalehs Stand-Up-Shows
- Die Verwendung sprachlicher und nonverbaler Mittel zur Abgrenzung der ‚eigenen‘ und ‚fremden‘ Gruppen
- Die Zuschreibung von Eigenschaften an ‚eigene‘ und ‚fremde‘ Gruppen und die Analyse deren Stereotypisierung
- Die Rolle von Humor, Komik und Lachen bei der Verarbeitung von interkulturellen Erfahrungen
- Die Funktionen von Humor im Hinblick auf die Ausübung von Macht und die Stärkung von Gruppenkohäsion
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das zweite Kapitel beleuchtet die Besonderheiten der Stand-Up-Comedy als Genre und die Interaktion zwischen Comedian und Publikum. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Konstruktion des ‚Eigenen‘ und des ‚Fremden‘ in Gad Elmalehs Shows. Dabei werden die Abgrenzung mittels sprachlicher Mittel wie Gruppenbezeichnungen und Pronomina sowie die Verwendung nonverbaler Mittel wie Gestik und Mimik analysiert. Außerdem werden die Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften an ‚eigene‘ und ‚fremde‘ Gruppen betrachtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Funktionen von Humor, Komik und Lachen bei der Darstellung des ‚Eigenen‘ und des ‚Fremden‘. Es beleuchtet die verschiedenen Humortheorien und deren Anwendung im Kontext von Gad Elmalehs Shows. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Funktionen von Humor im Hinblick auf die Verarbeitung von interkulturellen Erfahrungen, die Ausübung von Macht und die Stärkung von Gruppenkohäsion gelegt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Stand-Up-Comedy, interkulturelle Kommunikation, Humor, Komik, Lachen, Abgrenzung, Zuschreibung, Stereotypisierung, Fremdheit, Identität, Alterität, Gad Elmaleh, Gad Gone Wild, American Dream.
Häufig gestellte Fragen
Wie konstruiert Gad Elmaleh das „Eigene“ und das „Fremde“?
Er nutzt Verfahren der Abgrenzung und Zuschreibung, indem er kulturelle Unterschiede zwischen Europa (Frankreich) und den USA durch verbale und nonverbale Mittel überspitzt darstellt.
Was sind die Besonderheiten der Stand-Up-Comedy als Genre?
Im Gegensatz zu Theaterkomödien basiert Stand-Up auf einer direkten Interaktion zwischen dem Comedian und dem Publikum, wobei oft persönliche Erfahrungen als authentische Quelle dienen.
Welche Rolle spielen Stereotype in Gad Elmalehs Shows?
Stereotype dienen als humoristische Bezugsgrößen. Elmaleh spielt mit Vorurteilen (z.B. „Franzosen sind so, Amerikaner sind so“), um komische Effekte durch Wiedererkennung zu erzielen.
Welche Funktion hat das Lachen über das „Eigene“?
Selbstironie und das Lachen über die eigene Kultur wirken oft sympathieerzeugend und bauen Barrieren zum Publikum ab, während gleichzeitig Gruppenkohäsion gestärkt wird.
Wie nutzt Elmaleh nonverbale Mittel zur Abgrenzung?
Durch Mimik und Gestik imitiert er typische Verhaltensweisen der jeweiligen Kulturen, was die verbalen Zuschreibungen verstärkt und das „Fremde“ plastisch erfahrbar macht.
- Arbeit zitieren
- Sophie-Eileen Gierend (Autor:in), 2019, "They don’t do this in America. They do this in Europe". Die Darstellung des 'Eigenen' und 'Fremden' in der Stand-Up-Comedy anhand von Gad Elmalehs "Gad Gone Wild" und "American Dream", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540120