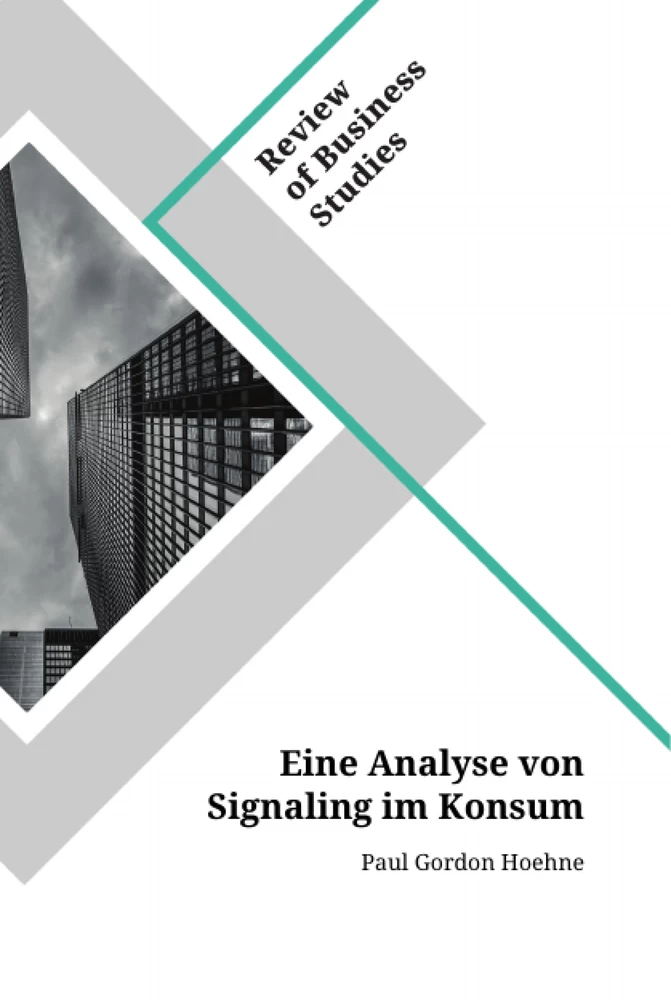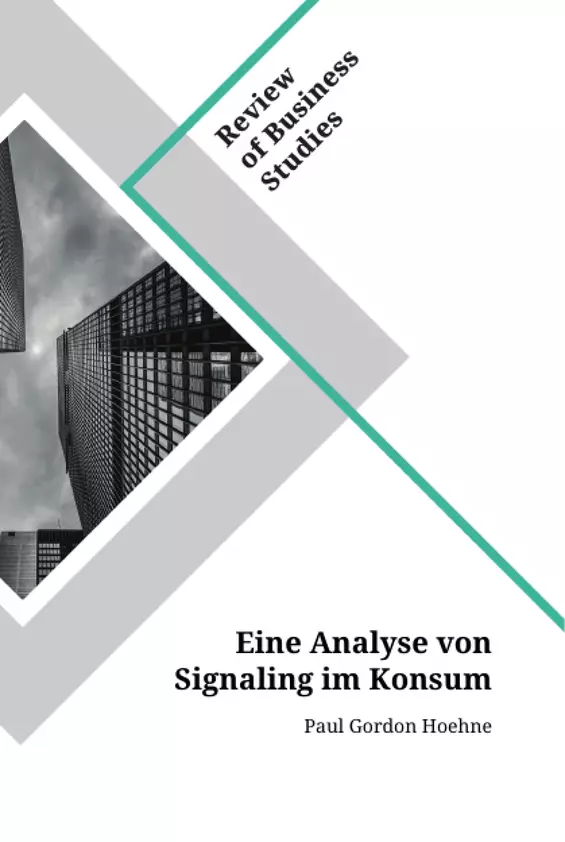Menschen kaufen Produkte nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie ausdrücken. Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung von identitäts- und selbstbildbezogenen Motiven im Kontext eines symbolisch und eben nicht rein funktional bzw. rational geprägten Konsumverhaltens. Das Verstehen und gezielte Adressieren dieser Motive ist längst zu einem entscheidenden wirtschaftlichen Erfolgsfaktor avanciert und somit von Interesse für Wirtschaft und Forschung. Ein Konzept, welches diese Motive der Identitätsexpression bzw. Selbstbildbestätigung aufgreift und deren Auswirkungen insbesondere auf konsumbezogenes Entscheidungsverhalten berücksichtigt, ist jenes des Signalings.
Dabei beleuchtet diese Arbeit, welche Bereiche und Phänomene von Signaling im Konsum bisher erforscht sind, welche Methodiken diesen Untersuchungen zu Grunde liegen und welche Ergebnisse sie hinsichtlich der Treiber, Mechanismen und Auswirkungen von konsumbezogenem Signaling hervorbringen. Der Konsumbegriff wird hierbei als das Begehren, Erwerben sowie auch Genießen von Produkten und Dienstleistungen im Zuge einer Kaufhandlung definiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Verknüpfung der Kaufhandlung mit einem wohltätigen Zweck als konform zur vorgenannten Konsumdefinition erachtet, sofern der Kerngedanke ökonomischer Tauschakte („Ware gegen Geld“) hiervon unberührt bleibt. Dies inkludiert insbesondere den Fall des anteiligen Spendens gezahlter Kaufpreise.
Diese Arbeit leistet drei Beiträge: Sie fasst die bestehende Literatur zum Thema Signaling im Konsum zusammen, systematisiert und kategorisiert die bisherigen Forschungsergebnisse und leitet theoretische wie praktische Implikationen ab.
Zunächst wird hierbei der Begriff des Signalings definiert sowie über seine verschiedenen Konzeptionierungen reflektiert. Dies bildet das terminologische wie theoretische Fundament der vorliegenden Arbeit und liefert die Grundlage ihrer Struktur. So werden Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des konsumbezogenen Signalings anschließend nach den Adressaten der jeweiligen Signaling-Entscheidungen kategorisiert und analysiert. Eine zusätzliche Untergliederung der Ergebnisse nach den Produkteigenschaften, welche für konsumrelevantes Signaling-Verhalten genutzt werden, ermöglicht dabei einen besseren Vergleich der aufgezeigten Erkenntnisse. Abschließend werden theoretische wie praktische Implikationen der Arbeit abgeleitet sowie deren Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Konzeptionen von Signaling
- Adressaten von Signaling
- Konsumentscheidungen zum Signaling gegenüber dem Selbst
- Entscheidungen über Produktkategorie und -typ
- Markenentscheidungen
- Preisentscheidungen
- Konsumentscheidungen zum Signaling gegenüber anderen
- Entscheidungen über Produktkategorie und -typ
- Markenentscheidungen
- Preisentscheidungen
- Konsumentscheidungen zum Signaling gegenüber dem Selbst
- Implikationen für Theorie und Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Phänomen des Signaling im Konsum, indem sie die relevanten Bereiche und Phänomene der bisherigen Forschung beleuchtet. Dabei untersucht sie die Methoden und Ergebnisse der Studien zu den Triebkräften, Mechanismen und Auswirkungen von konsumbezogenem Signaling. Die Arbeit zielt darauf ab, die bestehende Literatur zu diesem Thema zusammenzufassen, die Forschungsergebnisse zu systematisieren und zu kategorisieren sowie theoretische und praktische Implikationen abzuleiten.
- Definition und Konzeptionen des Signaling-Begriffs
- Analyse von Signaling-Entscheidungen im Konsum in Bezug auf die Adressaten
- Kategorisierung von Forschungsergebnissen nach den für Signaling-Verhalten relevanten Produkteigenschaften
- Ableitung theoretischer und praktischer Implikationen
- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Signaling im Konsum ein und unterstreicht die Bedeutung von Identitätsexpression und Selbstbild im Konsumverhalten. Es definiert den Begriff des Konsums und skizziert die drei zentralen Beiträge der Arbeit.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition und den Konzeptionen von Signaling. Es analysiert verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs, insbesondere die Theorien von Prelec und Bodner (2003) und Bem (1964) sowie die Erkenntnisse von Bénabou und Tirole (2004) und Dunning (2007). Der Begriff des Selbst-Signalings wird vorgestellt und in Beziehung zu den genannten Theorien gesetzt.
Kapitel 3 untersucht die Adressaten von Signaling-Entscheidungen im Konsum. Es differenziert zwischen Signaling gegenüber dem Selbst und gegenüber anderen und analysiert die jeweiligen Entscheidungen in Bezug auf Produktkategorie, -typ, Markenwahl und Preisgestaltung.
Schlüsselwörter
Signaling im Konsum, Selbst-Signaling, Identitätsexpression, Konsumverhalten, Entscheidungsverhalten, Produktkategorie, -typ, Markenentscheidungen, Preisentscheidungen, Theorie und Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Signaling im Konsumverhalten?
Signaling beschreibt das Phänomen, dass Menschen Produkte kaufen, um bestimmte Informationen über sich selbst (Identität, Status) an andere oder sich selbst zu senden.
Was ist der Unterschied zwischen Selbst-Signaling und Fremd-Signaling?
Selbst-Signaling dient der Bestätigung des eigenen Selbstbildes, während Fremd-Signaling darauf abzielt, einen bestimmten Eindruck bei Mitmenschen zu hinterlassen.
Wie beeinflussen Markenentscheidungen das Signaling?
Marken fungieren als Symbole für Werte oder sozialen Status; durch ihre Wahl signalisiert der Konsument seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.
Welche Rolle spielt der Preis beim Signaling?
Ein hoher Preis kann als Signal für Exklusivität und Wohlstand dienen, während Rabatte oder Spendenanteile moralische Werte signalisieren können.
Warum kaufen Menschen Produkte nicht nur für ihren Nutzen?
Weil Produkte oft eine symbolische Bedeutung haben, die für die Identitätsausprägung und soziale Kommunikation wichtiger ist als die reine Funktion.
- Arbeit zitieren
- Paul Gordon Hoehne (Autor:in), 2019, Eine Analyse von Signaling im Konsum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540366