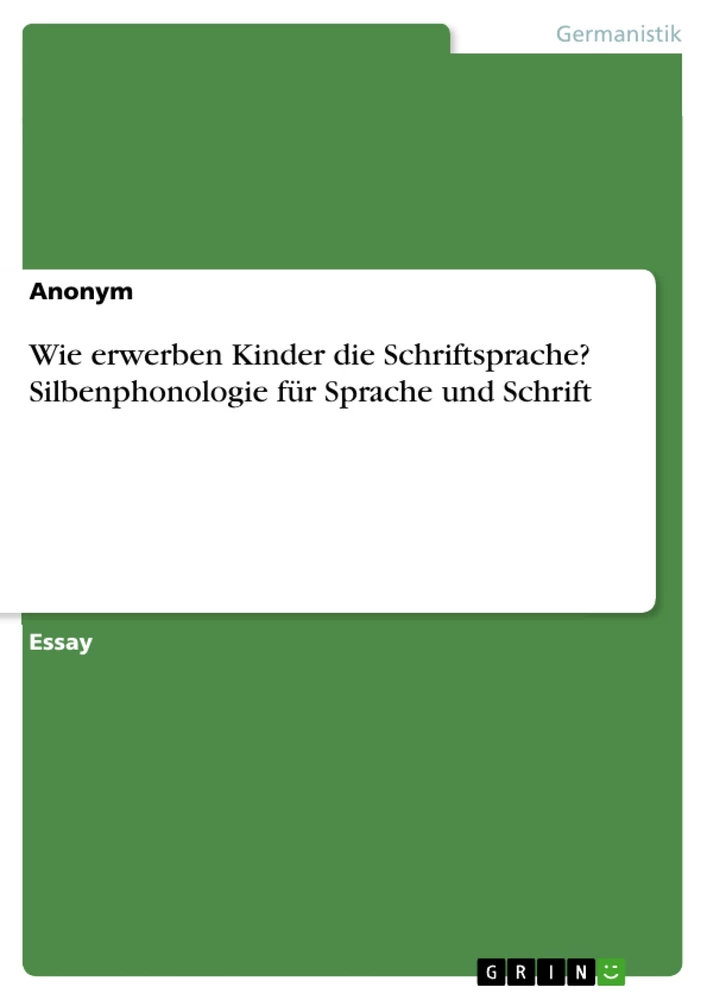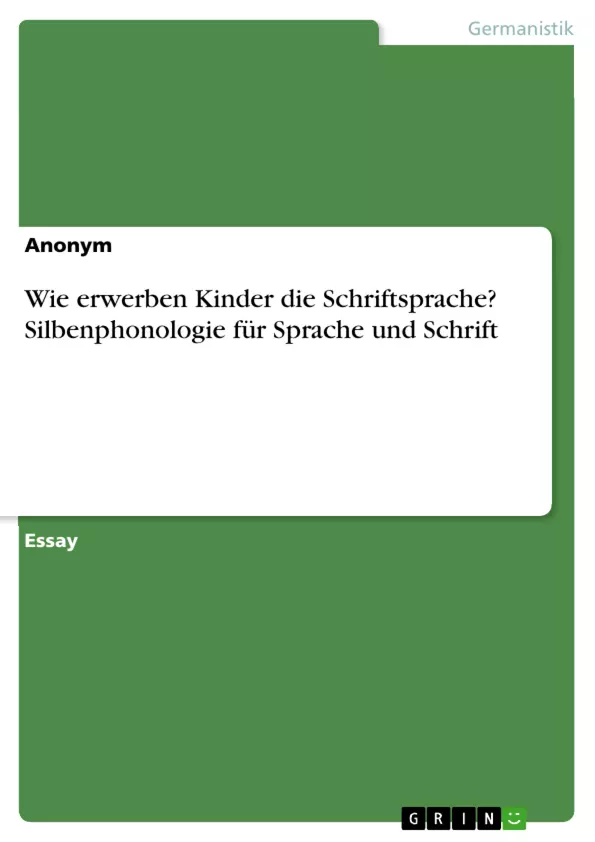Die Arbeit hat das Ziel, die Bedeutung der Silbe als prosodische Grundeinheit zu verdeutlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Silbe in der geschriebenen Sprache. Hierfür thematisiert der Autor, wie Kinder die Schriftsprache erwerben und erläutert verschiedene didaktische Modelle dazu.
Um die Sprachverarbeitung zu verstehen, ist es sinnvoll, zu erwähnen, dass es im Gehirn zwei wichtige Zentren gibt: das Broca-Zentrum und das Wernicke-Zentrum. Im Broca-Zentrum findet die Sprachproduktion (die motorischen Funktionen) statt, im Wernicke-Zentrum hingegen die Sprachrezeption (die sensorischen Funktionen). Die Sprachverarbeitung setzt sich also aus der Inputverarbeitung, der Outputverarbeitung und Speicherprozessen zusammen.
Unter der Inputverarbeitung versteht man die Aufnahme und Wahrnehmung sprachlicher Äußerungen. Bei der Outputverarbeitung hingegen geht es um das Formulieren sprachlicher Äußerungen, also um den Wortabruf und die Artikulation. Die Speicherprozesse laufen im mentalen Lexikon ab, das aus etwa 15000 Wörtern besteht, auf die im Bruchteil einer Sekunde zugegriffen werden kann. Im gesamten Sprachverarbeitungsprozess hat die Silbe eine relevante Bedeutung für die Speicherung phonologischer und orthografischer Einträge.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Zur Thematik des Seminars
- 2. Sprachverarbeitung
- 3. Prosodie
- 4. Spracherwerb bei Kindern
- 5. Die Silbe in der geschriebenen Sprache
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Proseminar „Silbenphonologie für Sprache und Schrift“ zielte darauf ab, die Bedeutung der Silbe als prosodische Grundeinheit zu verdeutlichen. Dabei wurden sowohl ihre Rolle in der Phonetik und Phonologie als auch ihre grundlegende Bedeutung im Sprach- und Schriftspracherwerb beleuchtet. Das Seminar vermittelt wichtige Methoden zur sprachwissenschaftlichen Analyse von Sprachdaten und setzt sich kritisch mit relevanten Studien auseinander.
- Die Rolle der Silbe in der Phonetik und Phonologie
- Die Bedeutung der Silbe im Sprach- und Schriftspracherwerb
- Methoden zur sprachwissenschaftlichen Analyse von Sprachdaten
- Kritische Reflexion relevanter Studien
- Die Silbe als prosodische Grundeinheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Zur Thematik des Seminars
Dieses Kapitel führt in das Thema des Seminars „Silbenphonologie für Sprache und Schrift“ ein und beleuchtet die Bedeutung der Silbe als prosodische Grundeinheit. Es wird auf ihre Rolle in der Phonetik und Phonologie sowie auf ihre grundlegende Bedeutung im Sprach- und Schriftspracherwerb eingegangen.
2. Sprachverarbeitung
Das Kapitel befasst sich mit der Sprachverarbeitung und ihren zentralen Komponenten, dem Broca- und Wernicke-Zentrum. Es erläutert die Inputverarbeitung, Outputverarbeitung und Speicherprozesse und hebt die Bedeutung der Silbe im gesamten Prozess hervor.
3. Prosodie
Dieses Kapitel behandelt die Prosodie und die Definition der Silbe. Es beleuchtet das Sonoritätsprinzip und das Silbenstrukturmodell, die wichtige Ansätze zur Analyse der Silbenstruktur bieten.
4. Spracherwerb bei Kindern
Das Kapitel konzentriert sich auf den Spracherwerb bei Kindern und betrachtet verschiedene didaktische Modelle, die den Schriftspracherwerb unterstützen.
5. Die Silbe in der geschriebenen Sprache
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Silbe in der geschriebenen Sprache. Es betrachtet die Rolle der Silbe in der Orthografie und im Schriftspracherwerb.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen des Textes sind: Silbenphonologie, Prosodie, Sprachverarbeitung, Spracherwerb, Schriftspracherwerb, Phonetik, Phonologie, Sprachdatenanalyse, didaktische Modelle.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Silbe beim Schriftspracherwerb?
Die Silbe fungiert als prosodische Grundeinheit, die Kindern hilft, phonologische und orthografische Einträge im mentalen Lexikon zu speichern und abzurufen.
Was sind das Broca- und das Wernicke-Zentrum?
Das Broca-Zentrum ist für die Sprachproduktion (Motorik) zuständig, während im Wernicke-Zentrum die Sprachrezeption (Sensorik/Verständnis) stattfindet.
Was versteht man unter Input- und Outputverarbeitung?
Inputverarbeitung ist die Wahrnehmung sprachlicher Äußerungen. Outputverarbeitung umfasst den Wortabruf, die Formulierung und die Artikulation von Sprache.
Was ist das Sonoritätsprinzip?
Es ist ein Prinzip der Silbenphonologie, das die Anordnung von Lauten innerhalb einer Silbe nach ihrer Schallfülle beschreibt und so die Silbenstruktur definiert.
Warum ist Prosodie für den Spracherwerb wichtig?
Prosodische Merkmale wie Rhythmus und Silbenstruktur geben Kindern wichtige Hinweise auf Wortgrenzen und grammatikalische Strukturen einer Sprache.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Wie erwerben Kinder die Schriftsprache? Silbenphonologie für Sprache und Schrift, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540426