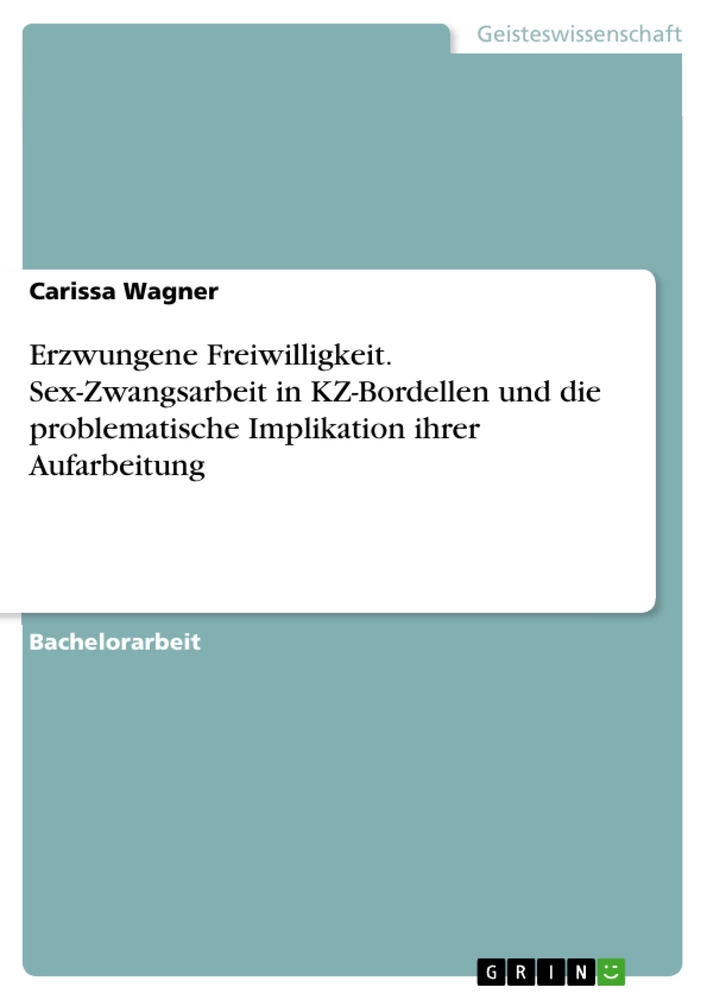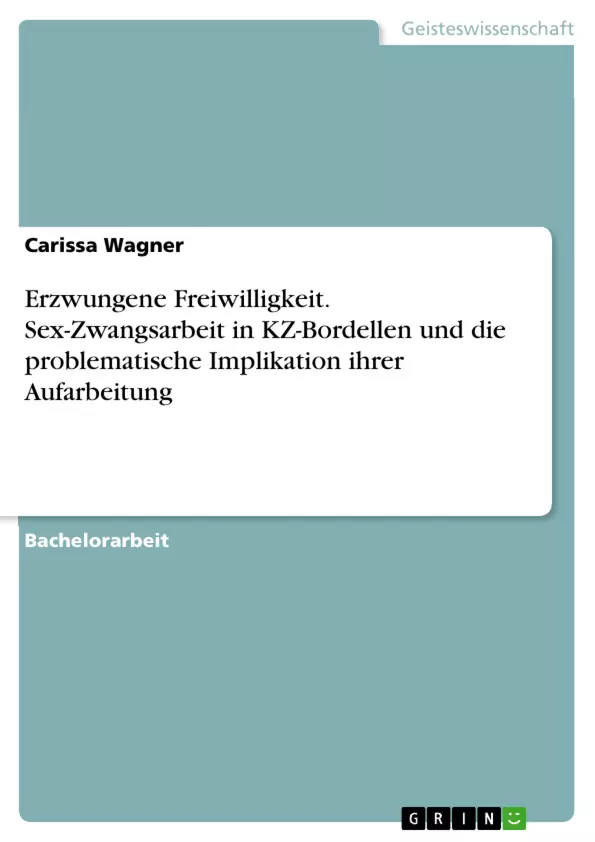Frauen, die während des Nationalsozialismus Zwangsarbeit in KZ-Bordellen verrichten mussten, waren vielen Stigmatisierungen ausgesetzt. Dieser Teil des Lagerlebens wurde tabuisiert und auch nach 1945 weitergetragen. Ehemalige Häftlinge sprachen kaum über die KZ-Bordelle, versuchten sogar diese zu vertuschen. Auch die Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager arbeiteten das Thema zuerst nicht auf und es dauerte eine lange Zeit, bis sich die Forschung der Thematik annahm. Bis heute gibt es keine staatliche und gesellschaftliche Anerkennung des Opferstatus – und somit auch keine Entschädigung für die Frauen, welche in den KZ-Bordellen Zwangsarbeit verrichten mussten.
Ein Aspekt, der die Aufarbeitung im Zusammenhang der Entschädigungsdebatte ausmacht, liegt auf der Ebene der Semantik, also der inhaltlichen Aufladung zentraler Begriffe. Lange wurde von „Prostitution“ und herabwürdigend über die Frauen gesprochen, welche als sogenannte „Asoziale“ von den Nationalsozialisten kategorisiert wurden. Die sprachliche Ebene untermauert die Stigmatisierung und Tabuisierung und wurde nicht klar aufgearbeitet und benannt.
Mit den Hilfsmitteln heutiger Sozialwissenschaften lassen sich die (Rück-)Wirkungen von Sprache und Begriffen auf die Realität und ihre Verarbeitung unter die Lupe nehmen. In dieser Arbeit soll dies, wie oben beschrieben, in Bezug auf die Aufarbeitung der Sex-Zwangsarbeit in Lagerbordellen des NS-Regimes geschehen. Die Arbeit fragt sich und will untersuchen, inwieweit der Begriff „Prostitution“, der nachweislich im Zusammenhang mit den Lagerbordellen während und nach des NS verwendet wurde, die Aufarbeitung – und damit auch Entschädigung – der weiblichen Opfer der NS-Bordelle belastete.
Auf Basis eines deskriptiv-analytischen Vorgehens soll in dieser Arbeit gezeigt werden, dass die Verwendung des Begriffs „Prostitution“ jeglicher sachlicher Grundlage entbehrt, aber politisch folgenreich zu sein scheint. Denn gerade aus der offen normativ eingestandenen Zielrichtung einer lückenlosen Aufarbeitung und entsprechenden Entschädigung der Opfer des NS muss angenommen werden, dass es – neben anderem – auch der dominante und negativ konnotierte Begriff „Prostitution“ war und ist, der diesem Ziel im Wege stand.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodisches Vorgehen und Theorie: Semantik und Framing
- Einführung: Semantik/Begriffsgeschichte
- Einführung: Framing (Elisabeth Wehling)
- Zwischenfazit: Untersuchungsdesign
- Die Sexual- und Prostitutionspolitik des Nationalsozialismus und ihre direkten Folgen mit Schwerpunkt auf Frame und Semantik
- (Sozial)wissenschaftliche Definition der Prostitution
- Frame und Semantik der Prostitution im Nationalsozialismus verdeutlicht an Hitlers Aussagen
- Prostitutionspolitik des Nationalsozialismus
- Prostitution in Kriegszeiten
- Semantik und aktivierte Frames der NS-Prostitutionspolitik
- Öffentliche Diffamierung und Folgen der Prostitutionspolitik
- Etablierung der KZ-Bordelle
- Soziale Struktur der „Prostitution\"/Sexarbeit in KZ-Bordellen
- Definition der Prostitution und Bezug zu KZ-Bordellen
- Aspekt der Freiwilligkeit anhand des Modells von Norbert Campagna
- Zwischenfazit: Mythos der „freiwilligen Meldungen“
- Problematische Implikationen der NS-Sexzwangsarbeit in KZs und die Aufarbeitung nach 1945
- Die doppelte Ordnung der „Prostitution“ im Nationalsozialismus
- Dimensionen und Muster der doppelten NS-Sexualordnung
- Autoritäre Sexualordnung der NS-Mehrheitsgesellschaft
- Autoritäre Sexualordnung der NS-Konzentrationslager
- Aufarbeitung der Lagerbordelle aus Sicht der Häftlinge
- Die betroffenen Frauen
- Entschädigung
- Forschung bringt Licht ins Dunkle
- Ein von Männern geführter Diskurs
- Die doppelte Ordnung der „Prostitution“ im Nationalsozialismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der erzwungenen Freiwilligkeit in KZ-Bordellen und der problematischen Implikation dieser Tatsache für die Aufarbeitung der Sex-Zwangsarbeit nach 1945. Sie analysiert die Lücken in der Erinnerungsarbeit, die durch die fälschlich angenommene Freiwilligkeit der Sex-Zwangsarbeit und das daraus resultierende Bild regulärer Prostitution entstanden sind. Die Arbeit basiert auf Fachliteratur und Primärquellen und zielt auf eine lückenlose Aufarbeitung und entsprechende Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus.
- Die erzwungene Freiwilligkeit als gewollter Bestandteil der NS-Sexualordnung
- Die Verwendung von Semantik und Framing in der NS-Prostitutionspolitik
- Die Auswirkungen der NS-Sexualpolitik auf die Aufarbeitung nach 1945
- Die fehlende Anerkennung der Perspektiven, des Schicksals und des Opferstatus der in KZ-Bordellen sexuell ausgebeuteten Frauen
- Die problematische Implikation der NS-Sexualpolitik, die bis heute nachwirkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und die Fragestellung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Begriffsgeschichte und den politischen Framing-Konzepten, die für die Analyse der (Rück-)Wirkungen von Sprache und Begriffen auf die soziale Realität und ihre Verarbeitung relevant sind. Kapitel 3 beleuchtet die Sexual- und Prostitutionspolitik des Nationalsozialismus und analysiert die verwendeten Frames und die Semantik, die die Stigmatisierung gegenüber (vermeintlicher) Prostitution widerspiegeln. Kapitel 4 fokussiert auf den Aspekt der „freiwilligen Meldungen“ und untersucht, wie sich die Sex-Zwangsarbeit in den KZ-Bordellen von der Prostitution in der Sexualordnung des Nationalsozialismus unterscheidet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Sex-Zwangsarbeit, KZ-Bordelle, erzwungene Freiwilligkeit, Semantik, Framing, NS-Sexualpolitik, Aufarbeitung, Erinnerungsarbeit, Entschädigung, Opferstatus, Stigmatisierung, Prostitution.
- Citation du texte
- Carissa Wagner (Auteur), 2019, Erzwungene Freiwilligkeit. Sex-Zwangsarbeit in KZ-Bordellen und die problematische Implikation ihrer Aufarbeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540542