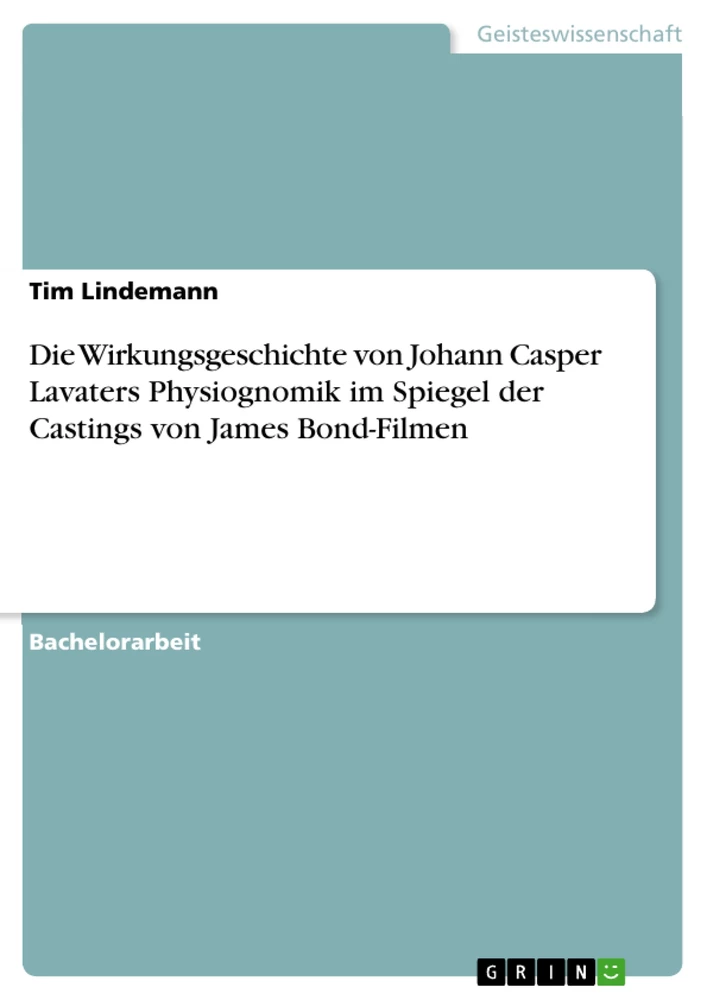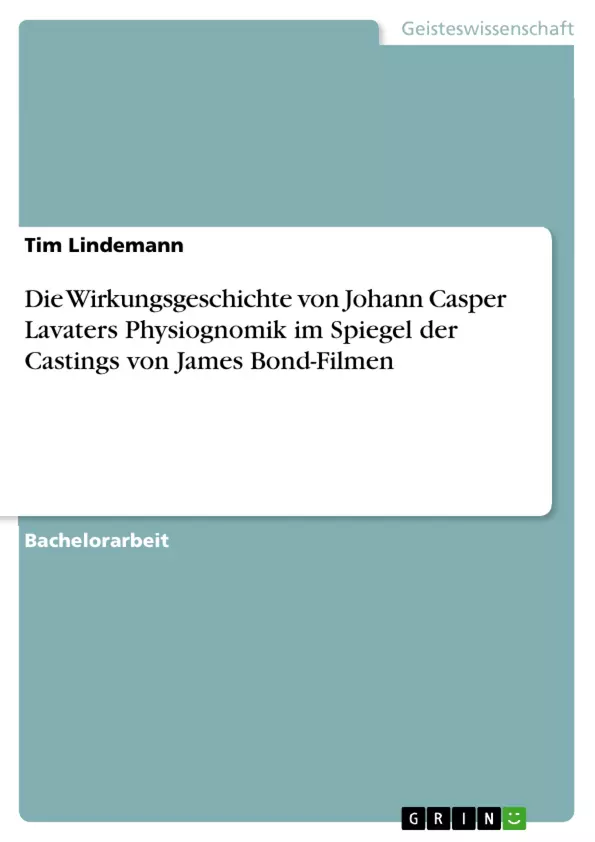Diese Bachelorthesis untersucht die Wirkungsgeschichte von Lavaters Physiognomik im Spiegel der Castings von James Bond-Filmen. Johann Casper Lavater versuchte im 18. Jahrhundert von äußeren Merkmalen auf den Charakter eines Menschen zu schließen. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird dieser fast 250 Jahre zurückliegende Versuch Lavaters mit den Castingprozessen der längsten Filmreihe der Geschichte verglichen, wodurch geprüft wird, ob Lavaters Physiognomik noch Relevanz besitzt. Der erste Film "James Bond 007- jagt Dr. No" erschien 1962. Der aktuellste Film "James Bond 007 – Spectre" erschien 2015. Folglich erstreckt sich die Filmreihe bereits über sechs Dekaden. Für 2020 ist bereits ein weiterer Film mit dem Titel "James Bond 007- No Time to Die" bestätigt. In dieser Zeitspanne spielten die Bond-Filme bis heute über 15 Milliarden Euro ein.
Als Grundlage der Filme dienen die Romane von Ian Fleming. Die Prozesse des Castings lassen sich zwischen Literatur und Film verorten. Da über die Castings der James Bond-Filme keine Aufzeichnungen einzusehen sind, bleibt als Analyse nur der Vergleich des Ergebnisses, die Besetzung des Films, und der Grundlage, der Romane Ian Flemings. Zu den einzelnen Themen der Physiognomik und der James Bond-Filme gibt es jeweils unzählige Veröffentlichungen. Jedoch gibt es keine Literatur, die konkret Lavaters Physiognomik aus dem 18. Jahrhundert mit der James Bond-Filmreihe des 20. und 21. Jahrhunderts vergleicht und in Bezug setzt. Als Primärquellen dieser Arbeit dienen die Physiognomische[n] Fragmente von Johann Casper Lavater, die Romane Casino Royale und Dr. No von Ian Fleming und die entsprechenden zwei James Bond-Filme. Als wichtigste Sekundärliteratur bezüglich der Castingprozesse dienen Texte von Jörg Schweinitz über Stereotypen und von Umberto Eco über die Erzählstruktur der Bond-Romane. Als Literatur bezüglich Lavaters Physiognomik werden Texte von Georg Christoph Lichtenberg und Roland Barthes verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lavaters Physiognomik
- Definition Physiognomik
- Lavaters Idealphysiognomik
- Castingprozesse im Film
- Das Casting
- Definition Stereotypen
- Stereotypen im Film
- Technischer Fortschritt im Film
- James Bond
- Historie der James Bond-Reihe
- Personenkonstellation der James Bond-Filme
- Narrative Strukturen der James Bond-Romane
- Physiognomik in Casino Royale und Dr. No
- Casino Royale
- James Bond
- Bondgirl
- Bösewicht
- Dr. No
- James Bond
- Bondgirl
- Bösewicht
- Casino Royale
- Einordnung der Typen in Lavaters Physiognomik
- Kritik an Lavaters Physiognomik
- Georg Christoph Lichtenberg
- Mythen des Alltags nach Roland Barthes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis untersucht die Wirkungsgeschichte von Lavaters Physiognomik im Spiegel der Castings von James Bond-Filmen. Die Arbeit vergleicht Lavaters Theorien aus dem 18. Jahrhundert mit den Castingprozessen der längsten Filmreihe der Geschichte und prüft, ob Lavaters Physiognomik in der heutigen Zeit noch Relevanz besitzt.
- Die Definition und wichtigsten Thesen der Physiognomik nach Lavater
- Die Analyse von Castingprozessen im Film und die Rolle von Stereotypen
- Die Geschichte, Charaktere und narrative Strukturen der James Bond-Reihe
- Die physiognomischen Beschreibungen in den Romanen Casino Royale und Dr. No im Vergleich zu den filmischen Adaptionen
- Die Kritik an Lavaters Physiognomik durch Georg Christoph Lichtenberg und Roland Barthes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Fragestellung sowie den wissenschaftlichen Ansatz dar. Kapitel 2 definiert Lavaters Physiognomik und erläutert seine wichtigsten Thesen. Kapitel 3 behandelt Castingprozesse im Film und die Rolle von Stereotypen. Kapitel 4 stellt die James Bond-Reihe vor, inklusive ihrer Geschichte, Charaktere und narrativen Strukturen. Kapitel 5 analysiert die physiognomischen Beschreibungen in den Romanen Casino Royale und Dr. No sowie deren filmische Adaptionen. Kapitel 6 ordnet die Ergebnisse der Analyse in Lavaters Theorie der Physiognomik ein. Kapitel 7 präsentiert die Kritik an Lavaters Physiognomik durch Georg Christoph Lichtenberg und Roland Barthes.
Schlüsselwörter
Physiognomik, Lavater, James Bond, Casting, Stereotypen, Film, Roman, Casino Royale, Dr. No, Lichtenberg, Barthes
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Lavaters Physiognomik?
Lavater versuchte im 18. Jahrhundert, von äußeren körperlichen Merkmalen auf den Charakter und die Seele eines Menschen zu schließen.
Wie wird Lavaters Theorie auf James Bond angewandt?
Die Arbeit vergleicht die physiognomischen Beschreibungen in Ian Flemings Romanen mit der tatsächlichen Besetzung (Casting) in den Filmen.
Welche Rolle spielen Stereotypen beim Casting?
Stereotypen helfen dabei, Charaktere wie Bond-Girls oder Bösewichte visuell sofort für das Publikum erkennbar und einordbar zu machen.
Welche Kritik gibt es an der Physiognomik?
Die Thesis thematisiert die Kritik von Georg Christoph Lichtenberg und Roland Barthes, die physiognomische Schlüsse als unwissenschaftlich oder mythisch ablehnten.
Welche Filme werden im Detail analysiert?
Die Analyse konzentriert sich primär auf die Werke „Casino Royale“ und „Dr. No“.
- Arbeit zitieren
- Tim Lindemann (Autor:in), 2019, Die Wirkungsgeschichte von Johann Casper Lavaters Physiognomik im Spiegel der Castings von James Bond-Filmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540684