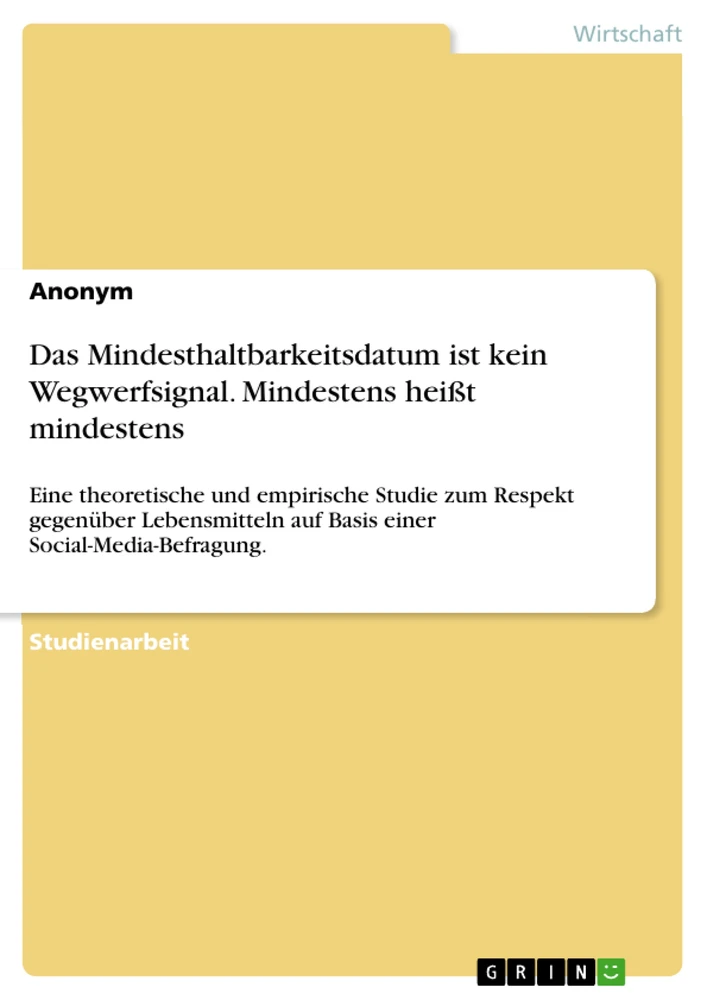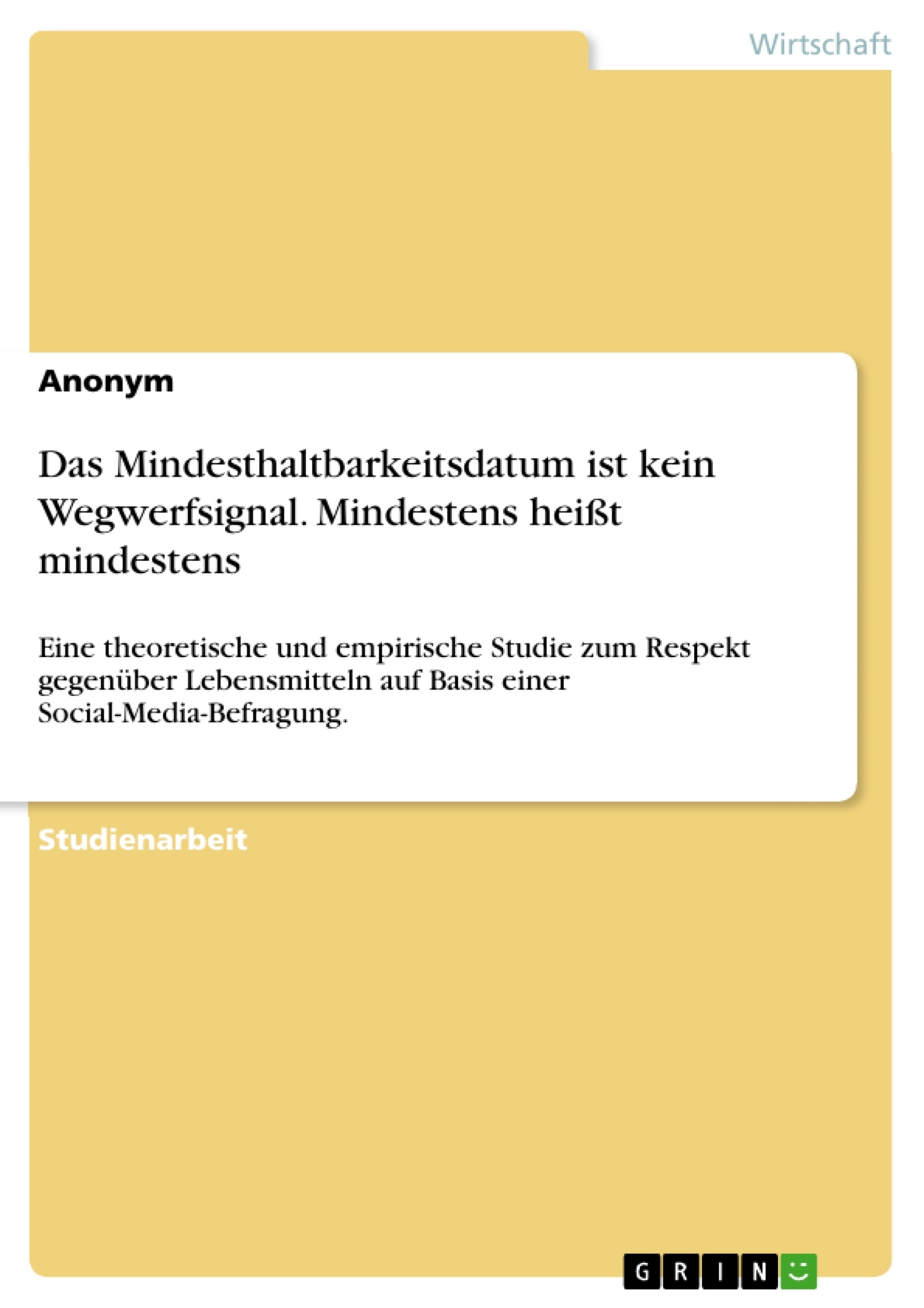Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik des Mindesthaltbarkeitsdatums und Möglichkeiten, sogenannten Food Waste zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) garantiert, wie lange der Inhalt einer ungeöffneten Packung keinen Qualitätsverlust erleidet. Wird die Ware länger gelagert, hängt es von äußeren Umständen ab, ob sie weiterhin zu konsumieren ist. Somit ist das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht automatisch ein Wegwerfsignal. Viele Menschen haben jedoch scheinbar verlernt, ihre Sinne zu nutzen, um zu entscheiden, welche Lebensmittel noch zum Verzehr geeignet sind.
In der heutigen Zeit ist angesichts von landwirtschaftlicher Massenproduktion und ständiger Verfügbarkeit von Nahrung der Respekt vor Lebensmitteln und ihrem Wert abhandengekommen. Auch das Bewusstsein, Nahrung für den Winter oder karge Zeiten lagern zu müssen, ist in Zeiten des Supermarkts fast vollständig verloren. Eine Studie für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat 2012 festgestellt, dass jedes achte Lebensmittel - meist noch in Originalverpackung - entsorgt wird. Das bedeutet pro Kopf und Jahr etwa zwei volle Einkaufswagen im Wert von 235 €. Um Lebensmittel herzustellen, werden aber viel Energie und andere Ressourcen verbraucht. Hier ist vor allem die Verschwendung zu kritisieren, da Nahrungsmittel weggeworfen werden, obwohl sie noch gegessen werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemdefinition
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Methodik
- 2.1 Forschungsleitende Fragen
- 2.2 Methodische Vorgehensweise
- 2.2.1 Literaturrecherche
- 2.2.2 Dokumenten- und Rechtsquellenanalyse
- 2.2.4 Befragung
- 2.2.5 Beobachtung
- 3. Theorie
- 3.1 Einordnung in die Wissenschaftsgebiete
- 3.2 Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit
- 3.3 Rechtswissenschaftliche Aspekte des Mindesthaltbarkeitsdatums
- 3.4 Beschaffung als betriebswirtschaftliche Aufgabe
- 3.5 Abfallwirtschaft
- 4. Empirie
- 4.1 Erkenntnisse zu Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit
- 4.2 Erkenntnisse zu rechtlichen Aspekten
- 4.3 Erkenntnisse zur Beschaffung und zum Einkaufsverhalten
- 4.4 Erkenntnisse zur Abfallwirtschaft
- 5. Fazit
- 5.1 Zusammenfassung
- 5.2 Diskussion und Fazit
- 5.3 Ausblick und Forschungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln im Kontext des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) und Möglichkeiten zur Reduktion von Lebensmittelabfällen (Food Waste). Die Studie analysiert Verbraucherstrategien beim Einkauf und der Verwendung von Lebensmitteln, um das Bewusstsein für nachhaltige Ressourcenschonung zu erforschen. Ein weiterer Fokus liegt auf der praktischen Wahrnehmung und Anwendung des MHDs.
- Verbraucherverhalten im Umgang mit Lebensmitteln und dem MHD
- Bewusstsein für nachhaltige Ressourcenschonung im Kontext von Lebensmitteln
- Rechtswissenschaftliche Aspekte des Mindesthaltbarkeitsdatums
- Ökologische und ökonomische Implikationen von Lebensmittelabfällen
- Möglichkeiten zur Reduktion von Food Waste
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der Lebensmittelverschwendung im Kontext von Überfluss und mangelndem Respekt vor Nahrungsmitteln dar. Sie verweist auf Statistiken über weggeworfene Lebensmittel und die damit verbundene Ressourcenverschwendung. Die Arbeit konzentriert sich auf das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) als zentralen Aspekt und die Möglichkeiten, Food Waste zu reduzieren. Das MHD wird als kein automatisches Wegwerfsignal definiert, sondern als Indikator für die mögliche Qualitätsminderung, dessen Überschreitung jedoch nicht zwangsläufig den Verzehr ausschließt. Die Zielsetzung der Arbeit ist die Analyse von Verbraucherstrategien im Umgang mit Lebensmitteln und dem MHD, um das Bewusstsein für nachhaltige Ressourcenschonung zu untersuchen und Handlungsbedarf in verschiedenen Fachbereichen aufzuzeigen.
2. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie. Es werden die Forschungsfragen definiert und die angewandten Methoden erläutert, darunter Literaturrecherche, Dokumenten- und Rechtsquellenanalyse, Befragungen (Onlinebefragung) und Beobachtungen (Vor-Ort-Beobachtung). Die Methodik legt den Grundstein für die Datenerhebung und -auswertung in der empirischen Untersuchung. Die detaillierte Beschreibung der Methoden ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Beurteilung der Ergebnisse.
3. Theorie: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Studie. Es ordnet die Thematik in verschiedene Wissenschaftsgebiete ein und behandelt ökologische, umweltbezogene und nachhaltigkeitsrelevante Aspekte. Die rechtswissenschaftlichen Aspekte des MHDs werden beleuchtet, ebenso wie die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Beschaffung und die Rolle der Abfallwirtschaft im Kontext von Lebensmittelabfällen. Dieser Abschnitt bildet die wissenschaftliche Grundlage für die Interpretation der empirischen Ergebnisse.
4. Empirie: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Erkenntnisse zu Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit, zu rechtlichen Aspekten, zum Beschaffungs- und Einkaufsverhalten sowie zur Abfallwirtschaft dargelegt. Die Ergebnisse der Online-Befragung und der Vor-Ort-Beobachtungen werden analysiert und interpretiert im Hinblick auf die Forschungsfragen. Die Darstellung der Ergebnisse ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit und liefert die Grundlage für die Schlussfolgerungen im Fazit.
Schlüsselwörter
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), Food Waste, Lebensmittelverschwendung, Nachhaltigkeit, Verbraucherverhalten, Ressourcenschonung, Ökologie, Umwelt, Rechtsaspekte, Beschaffung, Abfallwirtschaft, Onlinebefragung, Beobachtung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Respektvoller Umgang mit Lebensmitteln im Kontext des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD)
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln im Kontext des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) und Möglichkeiten zur Reduktion von Lebensmittelabfällen (Food Waste). Sie analysiert Verbraucherstrategien beim Einkauf und der Verwendung von Lebensmitteln und beleuchtet die praktische Wahrnehmung und Anwendung des MHDs.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Verbraucherverhalten im Umgang mit Lebensmitteln und dem MHD, das Bewusstsein für nachhaltige Ressourcenschonung, rechtswissenschaftliche Aspekte des MHDs, ökologische und ökonomische Implikationen von Lebensmittelabfällen sowie Möglichkeiten zur Reduktion von Food Waste.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Studie verwendet eine gemischte Methodik. Es wurden Literaturrecherchen, Dokumenten- und Rechtsquellenanalysen, Onlinebefragungen und Vor-Ort-Beobachtungen durchgeführt. Die detaillierte Beschreibung der Methoden ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Beurteilung der Ergebnisse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Methodik, ein Kapitel zur Theorie, ein empirisches Kapitel und ein Fazit. Die Einleitung stellt das Problem der Lebensmittelverschwendung dar und definiert die Zielsetzung. Die Methodik beschreibt die Vorgehensweise. Das Theoriekapitel liefert den wissenschaftlichen Hintergrund. Das Empirie-Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Datenerhebung und -auswertung. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, diskutiert sie und gibt einen Ausblick.
Welche theoretischen Aspekte werden behandelt?
Das Theoriekapitel behandelt die Einordnung der Thematik in verschiedene Wissenschaftsgebiete, ökologische, umweltbezogene und nachhaltigkeitsrelevante Aspekte, rechtswissenschaftliche Aspekte des MHDs, betriebswirtschaftliche Aspekte der Beschaffung und die Rolle der Abfallwirtschaft im Kontext von Lebensmittelabfällen.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Das Empirie-Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Online-Befragung und der Vor-Ort-Beobachtungen zu Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit, zu rechtlichen Aspekten, zum Beschaffungs- und Einkaufsverhalten sowie zur Abfallwirtschaft. Diese Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfragen analysiert und interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, diskutiert sie und gibt einen Ausblick auf zukünftigen Forschungsbedarf. Es werden Handlungsbedarfe in verschiedenen Fachbereichen aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), Food Waste, Lebensmittelverschwendung, Nachhaltigkeit, Verbraucherverhalten, Ressourcenschonung, Ökologie, Umwelt, Rechtsaspekte, Beschaffung, Abfallwirtschaft, Onlinebefragung, Beobachtung.
Wie wird das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) in der Arbeit betrachtet?
Das MHD wird nicht als automatisches Wegwerfsignal definiert, sondern als Indikator für die mögliche Qualitätsminderung. Die Überschreitung des MHDs schließt den Verzehr nicht zwangsläufig aus.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Wegwerfsignal. Mindestens heißt mindestens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540825