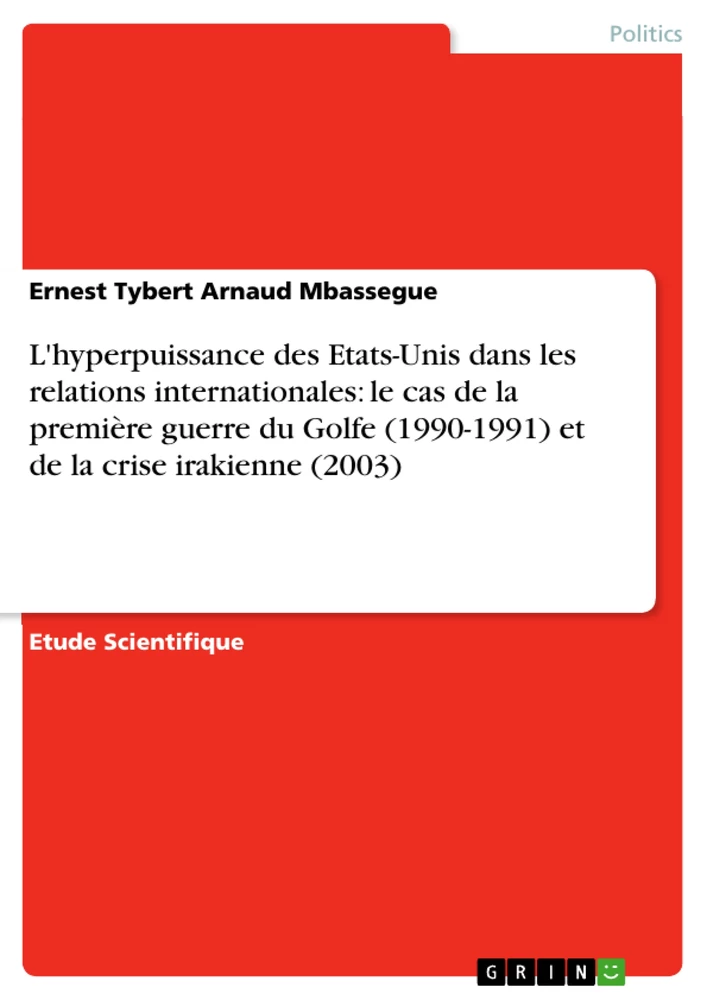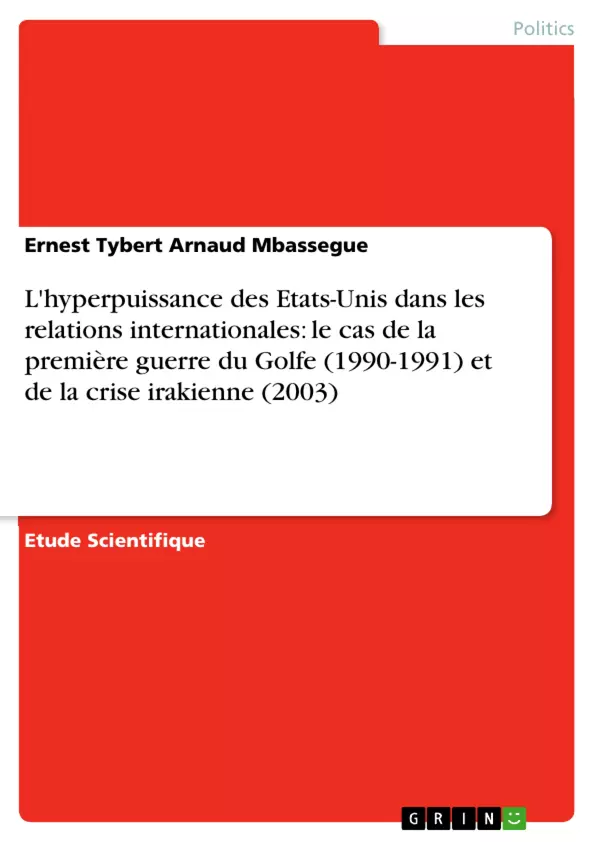La première guerre du Golfe et la crise irakienne sont une illustration parfaite des intérêts des enjeux et des rapports de force qui existent dans les rapports entre les États malgré la présence de l' ONU, institution internationale chargée de réguler les conflits dans le monde et qui considère tous les États égaux. Mais nous observons avec beaucoup d'inquiétude que la force prévaut au détriment du droit international à travers le comportement unilatéral des États-Unis qui vont soigneusement élaborer un processus de déstabilisation juridico-politique qui va mettre en exergue la volte face américaine dans la guerre Irak-Iran, mais précisément dans la guerre Irak-Koweit et Irak-coalition internationale.
La supposée menace que constitue l'Irak selon les États-Unis est plutôt un prétexte pour rappeler l'unique monopole américain dans la région du Golfe. Mais ce prétexte de détention d'armes de destruction massive est savamment déconstruit par des responsables de l'AIEA, ce qui n’empêche l'Amérique de se poser comme faiseuse et défaiseuse du droit international, d'où l'avenir inquiétant de ce droit.
Inhaltsverzeichnis
- Erste Teil: Die Hypermacht der Vereinigten Staaten in den internationalen Normen während des Ersten Golfkriegs (1990-1991)
- Kapitel Eins: Das Monopol der Vereinigten Staaten in der Regulierung der Golfkrise
- Abschnitt I: Die rechtliche Grundlage des amerikanischen Vorgehens
- Abschnitt II: Die Annahme bindender Entscheidungen gegen die irakische Aggression
- Kapitel Zwei: Die militärische Intervention der UNO-Koalition in Kuwait unter dem Kommando der Vereinigten Staaten
- Abschnitt I: Die Analyse der Resolutionen, die die militärische Intervention rechtfertigen
- Abschnitt II: Die Strategie der UNO-Koalition der Vereinigten Staaten
- Zweiter Teil: Hypermacht der Vereinigten Staaten und Ohnmacht der UNO bei der militärischen Intervention im Irak (2003)
- Kapitel Eins: Infragestellung der UNO-Instanz
- Abschnitt I: Kritik an den Entscheidungen des Sicherheitsrates
- Abschnitt II: Vorschlag zur Annahme eines neuen Resolutionsentwurfs für eine bewaffnete Intervention im Irak
- Kapitel Zwei: Amerikanische bewaffnete Intervention im Irak ohne die Billigung der Vereinten Nationen
- Abschnitt I: Die Gründe für die militärische Intervention
- Abschnitt II: Die amerikanische Militärstrategie im Irak
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Vereinigten Staaten als Hypermacht in internationalen Beziehungen, indem sie zwei Fallstudien analysiert: den Ersten Golfkrieg (1990-1991) und die irakische Krise (2003). Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Vorgehensweisen der USA und die Rolle der Vereinten Nationen in beiden Konflikten.
- Das Monopol der USA in der Regulierung internationaler Krisen
- Die rechtlichen Grundlagen der amerikanischen Interventionen
- Die Wirksamkeit der UNO-Resolutionen
- Die Anwendung des humanitären Völkerrechts
- Die unterschiedlichen Strategien der USA in beiden Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel Eins: Das Monopol der Vereinigten Staaten in der Regulierung der Golfkrise: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen der amerikanischen Intervention im Ersten Golfkrieg. Es untersucht die Interpretation des Kapitels VII der UN-Charta durch die USA und die Annahme von Resolutionen des Sicherheitsrats, die Sanktionen gegen den Irak verhängten. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, inwieweit die Aktionen der USA durch internationales Recht gedeckt waren und wie die USA das Monopol der Entscheidungsfindung in der Krise erlangten. Die Rolle der UN-Resolutionen, insbesondere der Resolution 661 (1990), die Wirtschaftssanktionen verhängte, und der darauf folgenden Resolutionen, die ein militärisches Eingreifen rechtfertigten, wird im Detail untersucht. Die Argumentation der USA, die irakische Invasion als Verstoß gegen das Völkerrecht zu definieren, wird ebenfalls betrachtet.
Kapitel Zwei: Die militärische Intervention der UNO-Koalition in Kuwait unter dem Kommando der Vereinigten Staaten: Dieses Kapitel befasst sich mit der militärischen Intervention der von den USA geführten Koalition im Ersten Golfkrieg. Es analysiert die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die die Intervention rechtfertigten, und untersucht die militärische Strategie der Koalition. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die Intervention im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stand und ob die Anwendung des Rechts von Haag und Genf eingehalten wurde. Die Untersuchung umfasst die Analyse der eingesetzten Waffen und der Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die Rolle der USA als Führungsmacht innerhalb der Koalition und die Auswirkungen ihrer militärischen Entscheidungen werden kritisch betrachtet.
Kapitel Eins: Infragestellung der UNO-Instanz: Dieses Kapitel analysiert die Kritik an der Rolle der Vereinten Nationen während der irakischen Krise 2003. Es untersucht die Gründe für die amerikanische Entscheidung, ohne UN-Mandat in den Irak einzumarschieren, und bewertet die unterschiedlichen Meinungen über die Notwendigkeit einer neuen UN-Resolution. Die Auseinandersetzung mit relevanten Resolutionen, wie der Resolution 1441 (2002), und deren Interpretation durch die USA sowie die Auseinandersetzung mit dem Kosovo-Konflikt und deren rechtliche Relevanz für den Irak-Krieg werden detailliert beleuchtet. Dabei wird die Argumentation der Befürworter und Gegner einer neuen Resolution sorgfältig gewürdigt.
Kapitel Zwei: Amerikanische bewaffnete Intervention im Irak ohne die Billigung der Vereinten Nationen: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für die amerikanische Intervention im Irak im Jahr 2003, ohne ein Mandat der Vereinten Nationen zu besitzen. Es untersucht sowohl die offiziell angegebenen Gründe (wie die angeblichen Massenvernichtungswaffen) als auch die vermuteten, latenten Motive (wie regionale Hegemonie und die Kontrolle über Ölressourcen). Die Analyse umfasst eine detaillierte Betrachtung der militärischen Strategie der USA, einschließlich der Luftangriffe und der Bodenoffensive, und bewertet den Grad, in dem die Operationen den Regeln des humanitären Völkerrechts entsprachen. Der Fokus liegt auf der Bewertung der amerikanischen Entscheidungen und ihrer langfristigen Folgen.
Schlüsselwörter
Hypermacht, Vereinigte Staaten, Golfkrieg, Irak-Krieg, Internationale Beziehungen, Völkerrecht, UN-Sicherheitsrat, UN-Resolutionen, Humanitäres Völkerrecht, Interventionismus, Hegemonie, Massenvernichtungswaffen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hypermacht der Vereinigten Staaten in internationalen Konflikten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Rolle der Vereinigten Staaten als Hypermacht im internationalen Kontext anhand zweier Fallstudien: des Ersten Golfkriegs (1990-1991) und der irakischen Intervention (2003). Der Fokus liegt auf dem Vorgehen der USA und der Rolle der Vereinten Nationen in beiden Konflikten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht das US-amerikanische Monopol bei der Regulierung internationaler Krisen, die rechtlichen Grundlagen der Interventionen, die Wirksamkeit von UNO-Resolutionen, die Anwendung des humanitären Völkerrechts, sowie die unterschiedlichen Strategien der USA in beiden Konflikten. Insbesondere wird die Frage nach der Legitimität der US-amerikanischen Handlungen im Lichte des Völkerrechts beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Teil eins behandelt den Ersten Golfkrieg, unterteilt in Kapitel zur US-amerikanischen Monopolstellung bei der Regulierung der Golfkrise und zur militärischen Intervention der UNO-Koalition unter US-Führung. Teil zwei befasst sich mit der irakischen Intervention 2003, analysiert die Infragestellung der UNO-Instanz und die US-amerikanische Intervention ohne UN-Mandat.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel Eins (Teil 1): Analysiert die rechtlichen Grundlagen der US-Intervention im Ersten Golfkrieg, insbesondere die Interpretation von Kapitel VII der UN-Charta und die Rolle von UNO-Resolutionen.
Kapitel Zwei (Teil 1): Untersucht die militärische Intervention der UNO-Koalition unter US-Führung, die Rechtfertigung durch UNO-Resolutionen, die militärische Strategie und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts.
Kapitel Eins (Teil 2): Analysiert die Kritik an der UNO während der irakischen Krise 2003, die Gründe für die US-Intervention ohne UN-Mandat und die Diskussion um einen neuen Resolutionsentwurf.
Kapitel Zwei (Teil 2): Untersucht die Gründe für die US-Intervention im Irak 2003 ohne UN-Mandat, die militärische Strategie und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Hypermacht, Vereinigte Staaten, Golfkrieg, Irak-Krieg, Internationale Beziehungen, Völkerrecht, UN-Sicherheitsrat, UN-Resolutionen, Humanitäres Völkerrecht, Interventionismus, Hegemonie, Massenvernichtungswaffen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit internationalen Beziehungen, Völkerrecht und den politischen und militärischen Aspekten der US-amerikanischen Außenpolitik auseinandersetzen.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Link zur vollständigen Arbeit einfügen, falls verfügbar].
- Arbeit zitieren
- Ernest Tybert Arnaud Mbassegue (Autor:in), 2016, L'hyperpuissance des Etats-Unis dans les relations internationales: le cas de la première guerre du Golfe (1990-1991) et de la crise irakienne (2003), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540843