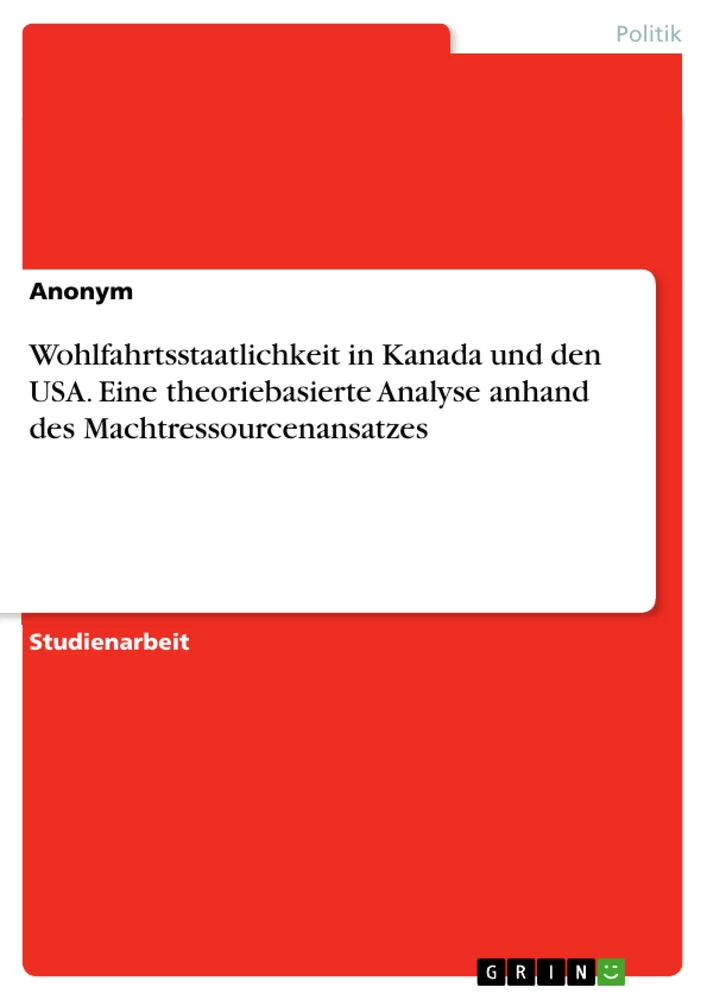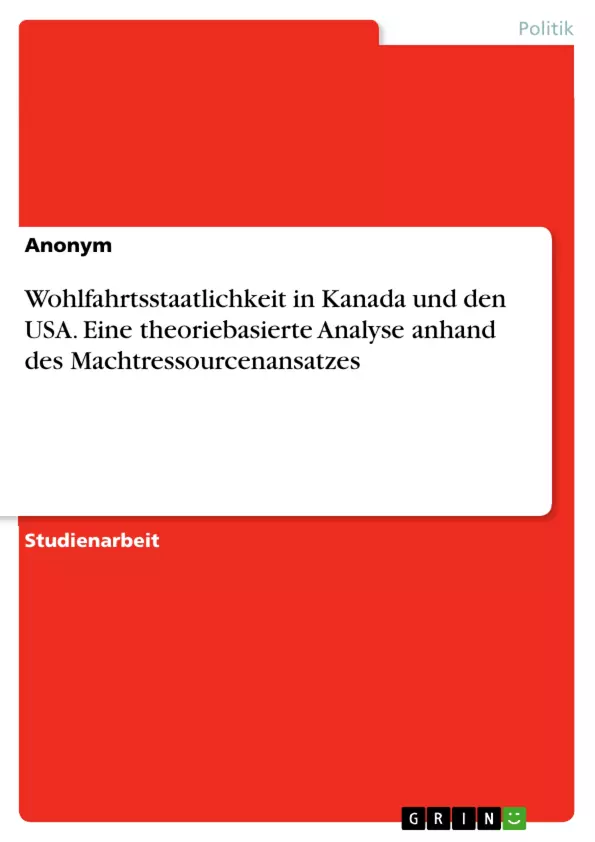Auf Basis der Arbeiten von Gøsta-Esping Andersen vergleicht die Hauptseminararbeit die wohlfahrtsstaatlichen Kennzahlen der USA und Kanadas und versucht auf theoretischer Basis des Machtressourcenansatzes mögliche Ursachen für Unterschiede innerhalb des sogenannten wirtschaftsliberalen angelsächsichen Wirtschaftsregime aufzuzeigen.
Der im März 2010 vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnete „Patient Protection and Afforable Care Act“ markierte in der über 200-jährigen Geschichte der USA einen Wendepunkt und ein äußerst bedeutendes Ziel der der Regierung unter Barack Obama. Eine Grundversicherung für alle Bürger Amerikas wurde durch das Gesetzesvorhaben des ersten afroamerikanischen US-Präsidenten erstmals zu einer Pflicht. Bei näherer Betrachtung erscheint in diesem Zusammenhang die Tatsache verwunderlich, dass bis dato circa 30 Millionen US-amerikanische Staatsbürger ohne jegliche Krankenversicherung auskommen mussten, und das in einem der fortschrittlichsten Industrieländer. Vor dem Hintergrund der bismarckschen Sozialgesetzgebung im späten 19. Jahrhundert in Deutschland bzw. dem damaligen Deutschen Reich, in dem eine solche Reform bereits mehr als 120 Jahre zurückliegt, werden die unterschiedlichen nationalen Denkweisen, woran sich die staatliche Wohlfahrt orientieren sollte, bewusst. Ein Land, das einen solchen Schritt hingegen mit universalistischer Leistungsgewährung bereits früher eingeschlagen hatte, ist der Nachbarstaat Kanada. Der „Canada Assistance Plan“ reformierte ab den 1960er Jahren die bestehenden Wohlfahrtsprogramme auf Basis universalistischer, staatlicher Leistungen. Diese Programme wurden jedoch in der Folgezeit wieder eingeschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Wohlfahrt und Sozialpolitik in Kanada und den USA
- 1.2 Fragestellung und Methodik
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Regimetypologie von Gøsta Esping-Andersen
- 2.2 Das wirtschaftsliberale angelsächsische Wirtschaftsregime
- 2.3 Der Machtressourcenansatz
- 3. Vergleich und Erklärung der Wohlfahrtsperformanz Kanadas und der USA
- 3.1 Unterschiede in der Wohlfahrtsperformanz
- 3.1.1 Vergleich des Performanzprofils Kanadas und der USA
- 3.1.2 De-Kommodifizierung und Stratifizierung in Kanada und den USA
- 3.2 Erklärung der Performanz der USA
- 3.2.1 Geringer Einfluss der Gewerkschaften
- 3.2.2 Konservative politische Hegemonie in der Sozialpolitik der USA
- 3.3 Erklärung der Performanz Kanadas
- 3.3.1 Rolle der Gewerkschaften
- 3.3.2 Sozial-liberale Hegemonie in der Sozialpolitik Kanadas
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wohlfahrtsperformanz der USA und Kanadas anhand des Machtressourcenansatzes. Sie zielt darauf ab, die Unterschiede in der Wohlfahrtspolitik beider Länder zu erklären, obwohl beide als wirtschaftsliberale Wohlfahrtsregime kategorisiert werden. Die Arbeit nutzt die Methode des Vergleichs möglichst ähnlicher Systeme (MSDO), um die relevanten erklärenden Variablen zu identifizieren.
- Vergleich der Wohlfahrtspolitik in Kanada und den USA
- Anwendung des Machtressourcenansatzes zur Erklärung von Unterschieden
- Analyse der Rolle von Gewerkschaften und politischer Hegemonie
- Untersuchung der Konzepte De-Kommodifizierung und Stratifizierung
- Verwendung der MSDO-Methode im Vergleich der beiden Länder
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Wohlfahrtsstaatlichkeit in Kanada und den USA ein. Es beleuchtet den "Patient Protection and Affordable Care Act" in den USA als einen Wendepunkt in der amerikanischen Gesundheitspolitik und vergleicht ihn mit dem "Canada Assistance Plan" in Kanada. Der Begriff "Wohlfahrt" wird anhand unterschiedlicher Definitionen diskutiert, wobei eine breitere Definition, die acht gesellschaftlich relevante Ziele umfasst, bevorzugt wird. Das Kapitel legt die Fragestellung der Arbeit fest und beschreibt die gewählte Methodik, den Vergleich möglichst ähnlicher Systeme (MSDO), um die Unterschiede in der Wohlfahrtsperformanz beider Länder zu erklären.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt die Regimetypologie von Gøsta Esping-Andersen, fokussiert auf das wirtschaftsliberale Regime, in dem sowohl die USA als auch Kanada eingeordnet werden. Der Machtressourcenansatz wird als zentrale analytische Perspektive vorgestellt, um die unterschiedlichen Wohlfahrtsleistungen in ähnlichen Systemen zu erklären. Dieses Kapitel liefert somit das theoretische Instrumentarium für die anschließende empirische Analyse.
3. Vergleich und Erklärung der Wohlfahrtsperformanz Kanadas und der USA: Dieses Kapitel vergleicht die Wohlfahrtsperformanz von Kanada und den USA und erklärt die beobachteten Unterschiede. Es analysiert das Performanzprofil beider Länder, betrachtet die De-Kommodifizierung und Stratifizierung und untersucht die Rolle der Gewerkschaften sowie die konservative bzw. sozial-liberale politische Hegemonie in der Sozialpolitik beider Staaten. Durch den Vergleich werden die Unterschiede in den Wohlfahrtssystemen beider Länder herausgearbeitet und mit Hilfe des Machtressourcenansatzes erklärt.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Kanada, USA, Machtressourcenansatz, Wirtschaftsliberales Regime, De-Kommodifizierung, Stratifizierung, Gewerkschaften, Politische Hegemonie, Vergleichende Politikwissenschaft, MSDO-Methode, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vergleich der Wohlfahrtsperformanz Kanadas und der USA
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Wohlfahrtsperformanz der USA und Kanadas und erklärt die Unterschiede in ihren Wohlfahrtspolitiken, obwohl beide Länder als wirtschaftsliberale Wohlfahrtsregime kategorisiert werden. Sie nutzt den Machtressourcenansatz und die Methode des Vergleichs möglichst ähnlicher Systeme (MSDO).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet den Vergleich möglichst ähnlicher Systeme (MSDO) als Methode, um die Unterschiede in der Wohlfahrtsperformanz zu erklären. Der Machtressourcenansatz dient als zentrale analytische Perspektive.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Regimetypologie von Gøsta Esping-Andersen, insbesondere auf das wirtschaftsliberale Regime. Der Machtressourcenansatz bildet die zentrale theoretische Grundlage zur Erklärung der unterschiedlichen Wohlfahrtsleistungen.
Welche Aspekte werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die Wohlfahrtspolitik, die Rolle von Gewerkschaften, die politische Hegemonie (konservativ in den USA, sozial-liberal in Kanada), De-Kommodifizierung und Stratifizierung in beiden Ländern. Es wird das Performanzprofil beider Länder analysiert.
Welche Rolle spielen Gewerkschaften und politische Hegemonie?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Gewerkschaften und der jeweiligen politischen Hegemonie (konservativ in den USA, sozial-liberal in Kanada) auf die Gestaltung der Sozialpolitik und die Wohlfahrtsperformanz beider Länder.
Was sind De-Kommodifizierung und Stratifizierung im Kontext dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Ausprägung von De-Kommodifizierung (Entkoppelung des sozialen Status von der Marktabhängigkeit) und Stratifizierung (Schichtung der Bevölkerung) in den Wohlfahrtssystemen Kanadas und der USA und deren Zusammenhang mit den beobachteten Unterschieden.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Wohlfahrtsstaat, Machtressourcenansatz, wirtschaftsliberales Regime, De-Kommodifizierung, Stratifizierung, Gewerkschaften, politische Hegemonie, Vergleichende Politikwissenschaft, MSDO-Methode und Sozialpolitik.
Was ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zum Vergleich und zur Erklärung der Wohlfahrtsperformanz, und ein Fazit. Die Einleitung beinhaltet die Fragestellung und Methodik. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den jeweiligen Inhalt.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Arbeit nennt als konkrete Beispiele den "Patient Protection and Affordable Care Act" (USA) und den "Canada Assistance Plan" (Kanada) im Kontext der Gesundheitspolitik. Die unterschiedlichen Definitionen von "Wohlfahrt" werden ebenfalls diskutiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Wohlfahrtsstaatlichkeit in Kanada und den USA. Eine theoriebasierte Analyse anhand des Machtressourcenansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540864