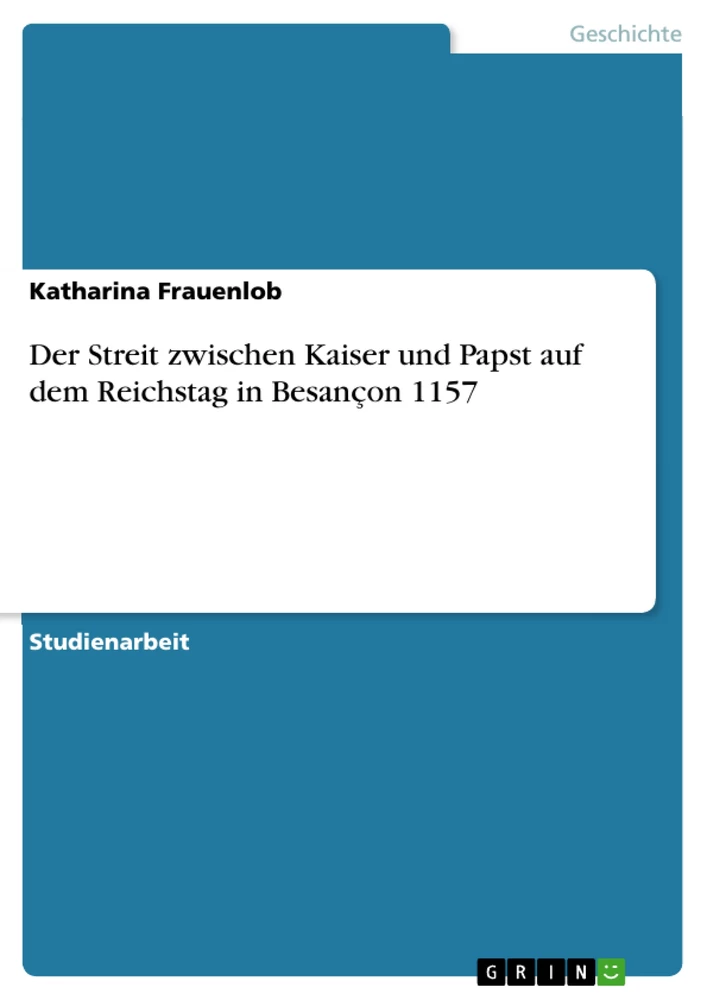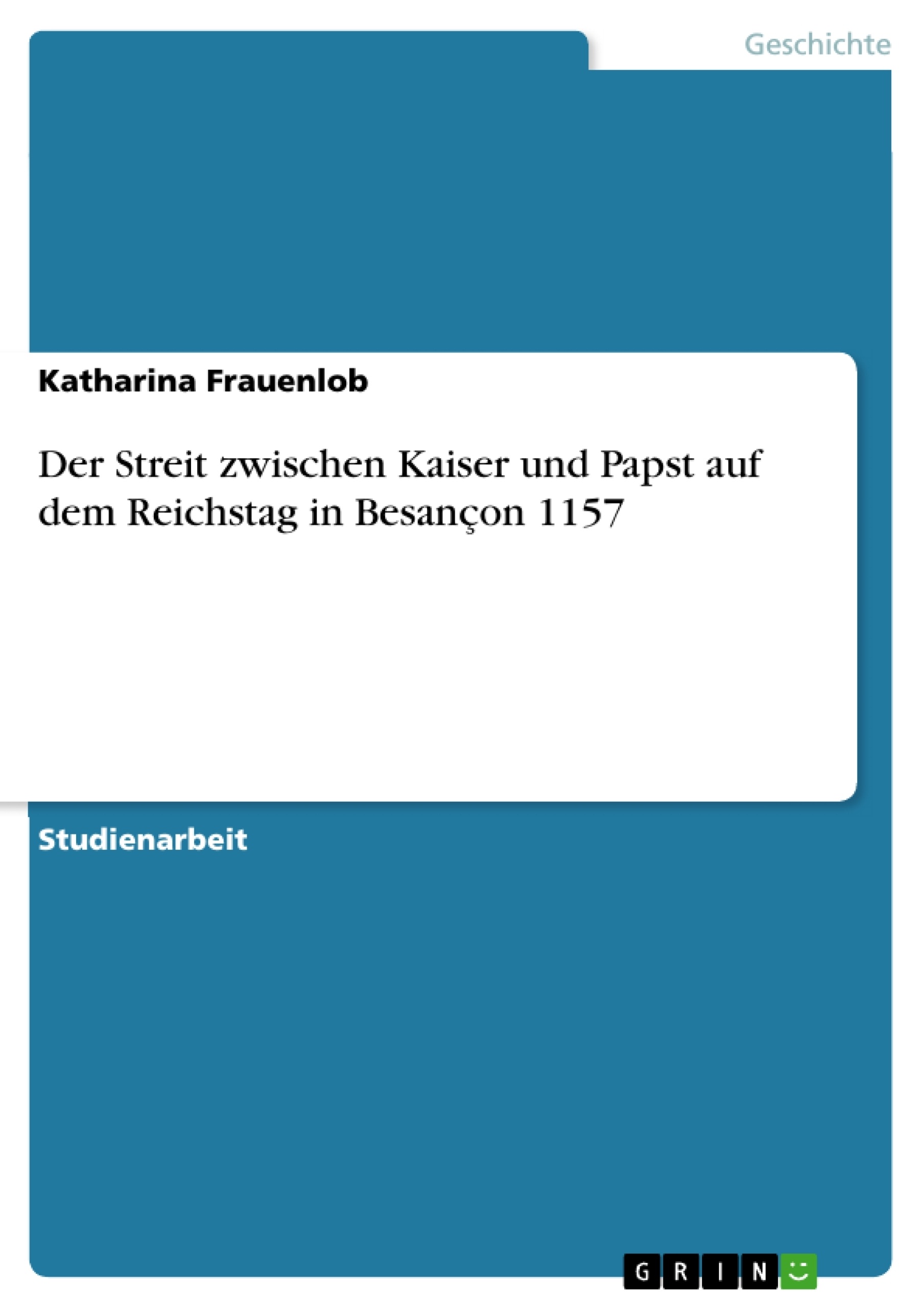Den Ereignissen des Hoftags in Besançon schenkten deutsche Historiker bereits in der älteren Geschichtsforschung ihr besonderes Interesse. Hier kommt der Konflikt zwischen Papst und Kaiser, der sich bereits in den Jahren vor 1157, u. a. in Sutri 1155, herauskristallisiert hat, offen zum Ausbruch. Dieses angespannte Verhältnis entstand durch die unterschiedliche Auffassung beider von der Legitimation weltlicher und geistlicher Macht. Dabei ist umstritten, wie das Verhalten der Handlungsträger auf dem Reichstag 1157 in Burgund zu bewerten ist. In der älteren deutschen Forschung nahm man zunächst an, Papst Hadrian IV. habe mit seinem den Streit auf dem Reichstag auslösenden Brief an den Kaiser die Freilassung des Bischofs Eskils von Lund erreichen wollen. Dem entgegen stellt H. Schrörs die Beanstandung der Gefangennahme Eskils von Lund nur als vordergründigen Zweck des Briefes dar. E. Otto folgt diesem, indem er in dem Brief ebenfalls einen Vorwand des Papstes zu erkennen glaubt. Er geht davon aus, der Papst habe in dem Brief den Kaiser zurechtweisen und zu einem Zusammenwirken mit der Kirche ermahnen wollen. Spätere Historiker, v. a. W. Heinemeyer, vertiefen diese Thesen.
Die folgende Arbeit wird die Handlungsweise der politischen Akteure auf dem Hoftag von Besançon darstellen. Es soll besonders der Frage nachgegangen werden, inwieweit der Streit vom Papst provoziert wurde, um seinen Machtanspruch geltend zu machen. Dabei wird untersucht werden, ob der Dolmetscher Rainald von Dassel durch seine bewusst scharfe Übersetzung den Streit auslöste und welche Rolle das Verhalten der Legaten dabei spielte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Die Quellen und ihre Besonderheiten
- 2.2 Ursachen des Streites
- 2.2.1 Die päpstliche Gesandtschaft
- 2.2.2 Der Brief des Papstes
- 2.2.3 Die Bedeutung des Wortes beneficium
- 2.2.4 Sutri als Interpretationsansatz für beneficium
- 2.3 Die Reaktionen auf den Brief
- 2.4 Das Einlenken des Papstes
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Streit zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Hadrian IV. auf dem Reichstag in Besançon im Jahr 1157. Sie untersucht die Ursachen des Streites und analysiert die Handlungsweise der politischen Akteure. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit der Streit vom Papst provoziert wurde, um seinen Machtanspruch geltend zu machen. Die Arbeit analysiert die Rolle des Dolmetschers Rainald von Dassel und der päpstlichen Legaten im Konflikt.
- Untersuchung des Streites zwischen Kaiser und Papst auf dem Reichstag in Besançon
- Analyse der Ursachen des Streites und der politischen Handlungsweise
- Beurteilung des Einflusses des Papstes auf den Streit
- Rolle des Dolmetschers Rainald von Dassel und der päpstlichen Legaten
- Bedeutung der Quellen für die Analyse des Konflikts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt den Konflikt zwischen Papst und Kaiser in den historischen Kontext und erläutert die Forschungsgeschichte des Themas. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen von weltlicher und geistlicher Macht und gibt einen Überblick über die Forschungsdiskussion zum Streit in Besançon.
- Kapitel 2: Hauptteil: Dieses Kapitel befasst sich mit den Quellen des Streites und ihren Besonderheiten. Es analysiert die päpstliche Gesandtschaft, den Brief des Papstes an Kaiser Barbarossa und die Bedeutung des Wortes "beneficium". Darüber hinaus werden die Reaktionen auf den Brief des Papstes und das Einlenken des Papstes im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Kaiser Friedrich Barbarossa, Papst Hadrian IV., Reichstag von Besançon 1157, Konflikt, Machtanspruch, Legitimation, weltliche Macht, geistliche Macht, Quellen, Urkunden, Brief des Papstes, Dolmetscher Rainald von Dassel, päpstliche Legaten.
- Citation du texte
- Katharina Frauenlob (Auteur), 2005, Der Streit zwischen Kaiser und Papst auf dem Reichstag in Besançon 1157, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54107