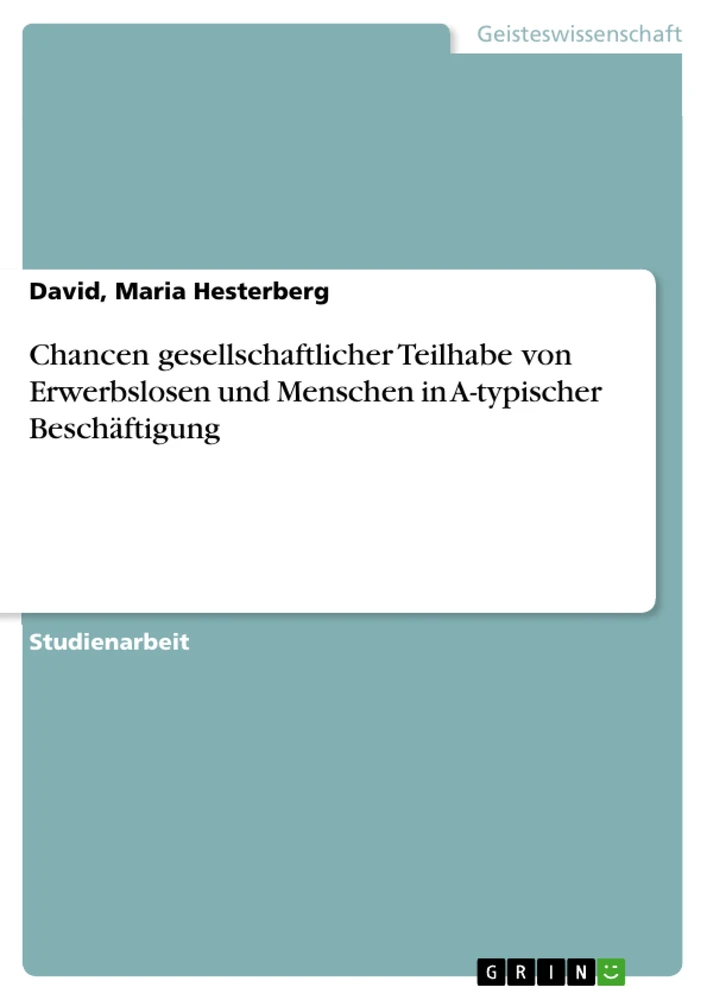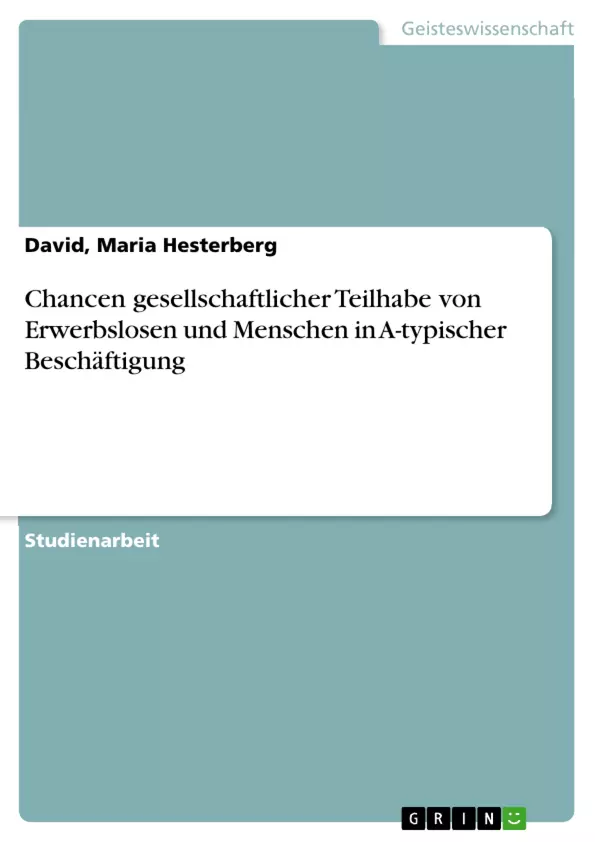Menschen, die den Ganzen Tag nichts zu tun haben. Sie trinken zu viel, dabei sitzen sie vor dem Fernseher auf der Couch und kümmern sich nicht um Haushalt, Familie oder das berufliche Fortkommen ihres Nachwuchses. So ein beliebtes Klischee wenn es um arbeitslose Menschen in Deutschland geht.
Jedoch steht diesem Vorurteil ein Phänomen voran welches in der deutschen Öffentlichkeit zunehmend an Brisanz gewinnt. Das Problem vom gesellschaftlichen Unten und Oben bzw. von Drinnen und Draußen wird mittlerweile in vielen Medien in Form von Talkshows und Berichterstattungen und anderen Diskussionsforen Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei dreht es sich im Kern um Zusammenhalt und Auseinanderdriften der deutschen Gesellschaft. Auch hat dieses Thema in den Letzten Jahren für viel Diskussionsstoff in der wissenschaftlichen Welt gesorgt. So berichtet Jens Bisky für die 'Süddeutsche Zeitung' am 17. Mai 2010 um 21:03 in der Rubrik 'Kultur' zu Thema 'soziale Schieflage in Deutschland' über die Diskussion zweier soziologischer Lager.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit
- Sozialstaatlichkeit in der BRD
- Die Reform des SGB II ein Paradigmenwechsel
- Fördern und Fordern - Was bedeuten die Hartz-Reformen konkret?
- Der deutsche Sozialstaat im Europäischen Vergleich
- Inklusion / Exklusion
- Was ist soziale Exklusion / Inklusion?
- Geld als universales Inklusionsmedium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Chancen gesellschaftlicher Teilhabe von Erwerbslosen und Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen im Kontext der sich transformierenden deutschen Sozialstaatlichkeit. Sie untersucht, inwiefern die Art der Sozialstaatlichkeit die Teilhabemöglichkeiten erwerbsloser Personen an der Gesellschaft beeinflusst.
- Die verschiedenen Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit nach Esping-Andersen
- Die Reform des Sozialstaates in Deutschland, insbesondere die Hartz-Reformen
- Die Bedeutung des Konzepts der Inklusion und Exklusion im Kontext der gesellschaftlichen Teilhabe
- Die Rolle von Geld als Inklusionsmedium
- Die Auswirkungen der Sozialstaatlichkeit auf die Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe von Erwerbslosen und Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Teilhabe von Erwerbslosen und Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen ein und stellt das Problem des gesellschaftlichen Unten und Oben dar. Sie beleuchtet die Diskussion um soziale Schieflage in Deutschland und die unterschiedlichen Perspektiven von Heinz Bude und Berthold Vogel.
- Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit: Dieses Kapitel stellt die drei Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit nach Esping-Andersen vor: den liberalen, den konservativen und den sozialdemokratischen Typus. Es erläutert die Konzepte der Dekommodifizierung, Residualismus, Privatisierung, Korporatismus, Umverteilungskapazität und Vollbeschäftigungsgarantie.
- Sozialstaatlichkeit in der BRD: Dieses Kapitel diskutiert die Sozialstaatlichkeit in Deutschland, insbesondere die Reform des SGB II und die Hartz-Reformen. Es untersucht die Veränderungen des sozialstaatlichen Apparates und die Folgen der Reform für die Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt.
- Inklusion / Exklusion: Dieses Kapitel definiert die Begriffe soziale Exklusion und Inklusion und untersucht die Rolle von Geld als Inklusionsmedium. Es analysiert die Auswirkungen des Mangels an Geld auf die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Inklusion, Exklusion, gesellschaftliche Teilhabe, Erwerbslosigkeit, atypische Beschäftigung, Hartz-Reformen, Dekommodifizierung, Geld als Inklusionsmedium.
Häufig gestellte Fragen
Was sind atypische Beschäftigungsverhältnisse?
Dazu zählen Arbeitsverhältnisse, die von der Normalarbeitszeit abweichen, wie z.B. Befristungen, Teilzeit, Leiharbeit oder Minijobs.
Wie beeinflussen die Hartz-Reformen die gesellschaftliche Teilhabe?
Die Arbeit untersucht den Paradigmenwechsel von "Fördern und Fordern" und wie die Reform des SGB II die Lebensrealität und Inklusionschancen von Erwerbslosen verändert hat.
Was bedeutet "Dekommodifizierung" nach Esping-Andersen?
Es beschreibt den Grad, in dem ein Bürger seine Existenz unabhängig von der Marktlage (durch staatliche Leistungen) sichern kann.
Warum wird Geld als "universales Inklusionsmedium" bezeichnet?
Geld ermöglicht den Zugang zu fast allen gesellschaftlichen Bereichen (Kultur, Mobilität, Bildung); ein Mangel an finanziellen Mitteln führt daher oft zur sozialen Exklusion.
Welche Wohlfahrtsstaatstypen gibt es laut der Theorie?
Unterschieden werden der liberale (z.B. USA), der konservative (z.B. Deutschland) und der sozialdemokratische Typus (z.B. Skandinavien).
- Arbeit zitieren
- David, Maria Hesterberg (Autor:in), 2014, Chancen gesellschaftlicher Teilhabe von Erwerbslosen und Menschen in A-typischer Beschäftigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541121