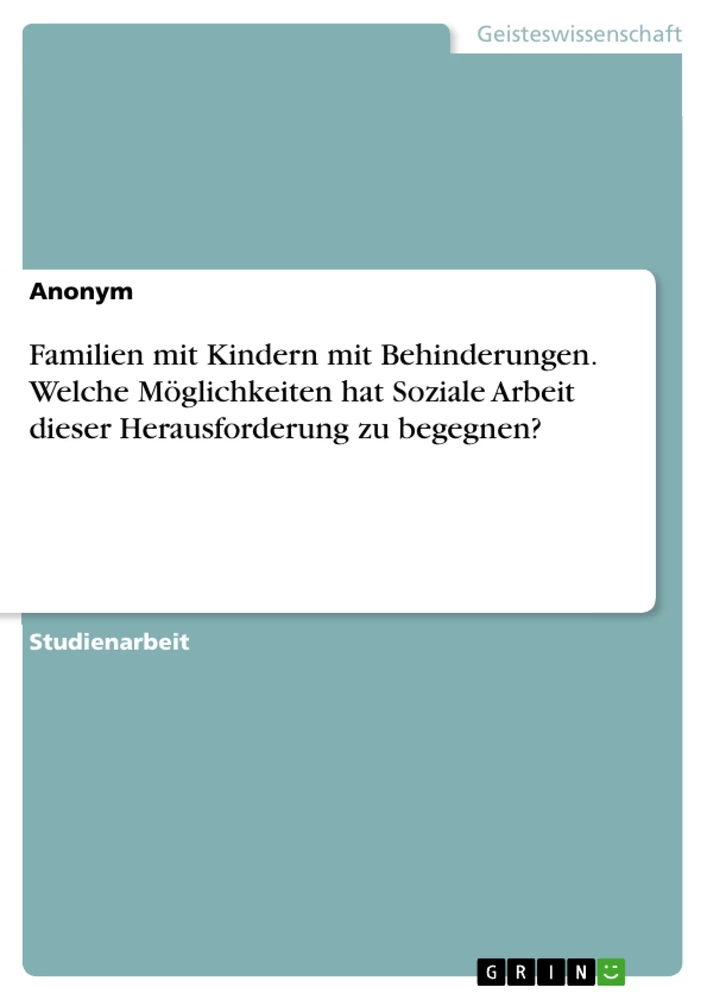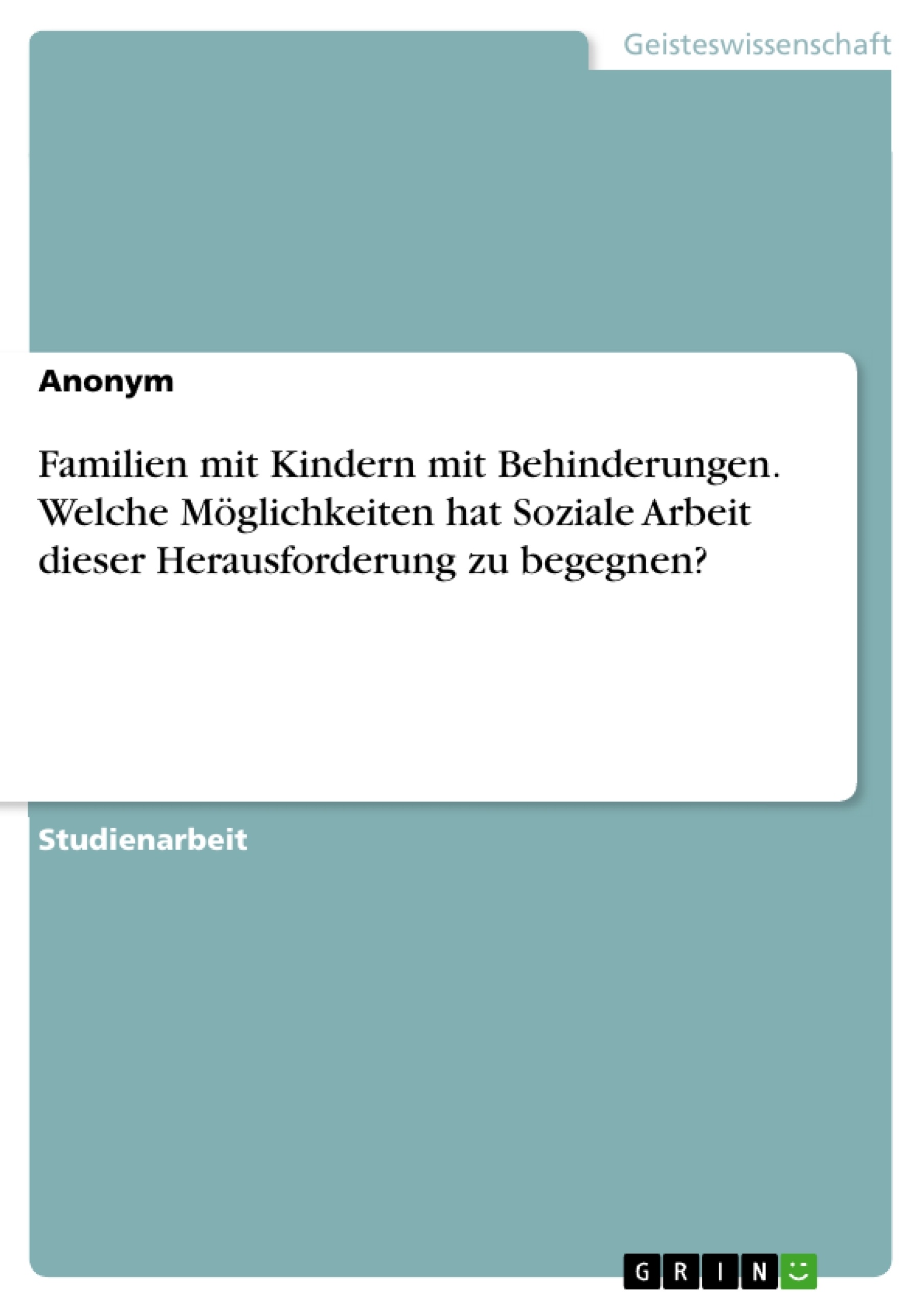Die Arbeit beschäftigt sich mit innerfamiliären Anpassungsprozessen sowie Bewältigungsstrukturen von Familien mit Kindern mit Behinderungen. Es wird versucht zu erläutern, welche Möglichkeit Soziale Arbeit hat, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Losgelöst davon, ob eine Behinderung während der Schwangerschaft, postnatal oder erst im Laufe des Lebens diagnostiziert wird, geraten Eltern durch die Diagnose einer Behinderung ihres Kindes oftmals in eine Krise. Meist ist die Behinderung nicht der direkte Grund eventuell auftretender Schwierigkeiten. Vielmehr sind die stressbelasteten Eltern sowie die organisatorische Veränderung innerhalb des Familiensystems problematisch. Aufgrund des durchaus traumatischen Ereignisses kann es zu Gefühlen wie Angst, Verzweiflung oder aber auch zum Gefühl von Ohnmacht kommen. Die Sorge, die neue Lebensaufgabe nicht bewältigen zu können, bestimmt meist das ganze Familienleben und beeinflusst die familiären Beziehungen oftmals negativ. Zudem verlangt es von der gesamten Familie eine jahrelange Umorientierung und Neuorganisation des familiären Gleichgewichts, ihrer Strukturen sowie ihrer Gegebenheiten.
Die besonderen Bedürfnisse des Kindes bestimmen den Alltag der Familie. Mit dem Heranwachsen eines Kindes mit Behinderung verändern sich oft auch die Anforderungen an die Familien. Sie werden somit wiederkehrend mit komplexen Anpassungsprozessen konfrontiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Forschungsstand.
- 3. Theoriegeleitete Zugänge
- 3.1 Lebensbewältigung nach Böhnisch...
- 3.2 Soziologische Familienforschung - Rosemarie Nave-Herz
- 3.3 Krise/ kritisches Lebensereignis nach Sigrun Heide-Filipp………………………………….
- 4. Konkretisierung der Theorie in Hinblick auf Herausforderungen für Familien mit Kindern mit Behinderung ......
- 4.1 Konkretisierung der Lebensbewältigung nach Böhnisch
- 4.2 Konkretisierung der soziologischen Familienforschung.
- 4.3 Konkretisierung der kritischen Lebensereignisse
- 5. Perspektiven für die Soziale Arbeit.............
- 6. Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die sich für Familien mit behinderten Kindern ergeben, und untersucht die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, diesen Herausforderungen zu begegnen. Dabei werden verschiedene theoretische Ansätze, wie die Lebensbewältigung nach Böhnisch, die soziologische Familienforschung und die Theorie der kritischen Lebensereignisse, herangezogen, um die Situation von Familien mit behinderten Kindern zu analysieren.
- Die Auswirkungen der Geburt eines Kindes mit Behinderung auf das Familiensystem.
- Die Bewältigung von Krisen und Herausforderungen in Familien mit behinderten Kindern.
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern.
- Die Bedeutung von Anpassungsprozessen und Neuorganisation im Familienalltag.
- Die Herausforderungen im Kontext der Lebensbewältigung, der Familienforschung und der Theorie der kritischen Lebensereignisse.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Geburt eines Kindes mit Behinderung auf die Lebenssituation der Familie. Es werden die besonderen Herausforderungen aufgezeigt, die sich für Eltern und das gesamte Familienleben ergeben, sowie die Bedeutung von Anpassungsprozessen und Neuorganisation.
- Kapitel 2: Forschungsstand Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur zum Thema Behinderung und die Situation von Familien mit behinderten Kindern. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs „Behinderung“ vorgestellt und Statistiken zu den Zahlen von Menschen mit Behinderung in Deutschland präsentiert. Zudem werden die Ergebnisse relevanter Studien zur Lebensqualität und den Belastungen von Familien mit behinderten Kindern aufgezeigt.
- Kapitel 3: Theoriegeleitete Zugänge Dieses Kapitel stellt drei verschiedene theoretische Ansätze vor, die für die Analyse der Situation von Familien mit behinderten Kindern relevant sind: die Lebensbewältigung nach Böhnisch, die soziologische Familienforschung und die Theorie der kritischen Lebensereignisse. Die einzelnen Ansätze werden in ihren Grundzügen erläutert und ihre Relevanz für das Thema der Behinderung in der Familie beleuchtet.
- Kapitel 4: Konkretisierung der Theorie in Hinblick auf Herausforderungen für Familien mit Kindern mit Behinderung Dieses Kapitel konkretisiert die in Kapitel 3 vorgestellten Theorien im Hinblick auf die Herausforderungen, die sich für Familien mit behinderten Kindern ergeben. Es werden die Anwendungsmöglichkeiten der jeweiligen Theorie auf die Lebensbewältigung, die Familienstrukturen und die Bewältigung kritischer Lebensereignisse im Kontext von Behinderung aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themengebiete dieser Arbeit sind Behinderung, Familie, Lebensbewältigung, soziologische Familienforschung, kritische Lebensereignisse, Soziale Arbeit, Unterstützung, Anpassung, Herausforderungen, Integration und Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen ergeben sich für Familien nach der Diagnose einer Behinderung beim Kind?
Die Diagnose einer Behinderung löst oft eine Krise aus, die von Gefühlen wie Angst, Verzweiflung und Ohnmacht geprägt ist. Die Familie muss ihr Gleichgewicht, ihre Strukturen und den Alltag grundlegend neu organisieren.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Analyse der Familiensituation herangezogen?
Die Arbeit nutzt die Lebensbewältigung nach Böhnisch, die soziologische Familienforschung nach Nave-Herz und die Theorie der kritischen Lebensereignisse nach Heide-Filipp.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Unterstützung dieser Familien?
Soziale Arbeit bietet Perspektiven zur Bewältigung der Herausforderungen, unterstützt bei Anpassungsprozessen und fördert die Integration sowie Inklusion der betroffenen Familienmitglieder.
Wie beeinflusst die Behinderung eines Kindes die Geschwister und Elternbeziehungen?
Die Sorge um die Bewältigung der neuen Lebensaufgabe bestimmt oft das gesamte Familienleben und kann familiäre Beziehungen negativ beeinflussen, da die Bedürfnisse des Kindes mit Behinderung den Alltag dominieren.
Was versteht man unter dem Begriff "Anpassungsprozess" in diesem Kontext?
Damit ist die jahrelange Umorientierung und Neuorganisation des familiären Gleichgewichts gemeint, die notwendig ist, um den besonderen Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden.
Gibt es statistische Daten zum Thema Behinderung in der Arbeit?
Ja, Kapitel 2 gibt einen Überblick über Definitionen von Behinderung und präsentiert Statistiken zur Anzahl von Menschen mit Behinderung in Deutschland.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Familien mit Kindern mit Behinderungen. Welche Möglichkeiten hat Soziale Arbeit dieser Herausforderung zu begegnen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541236