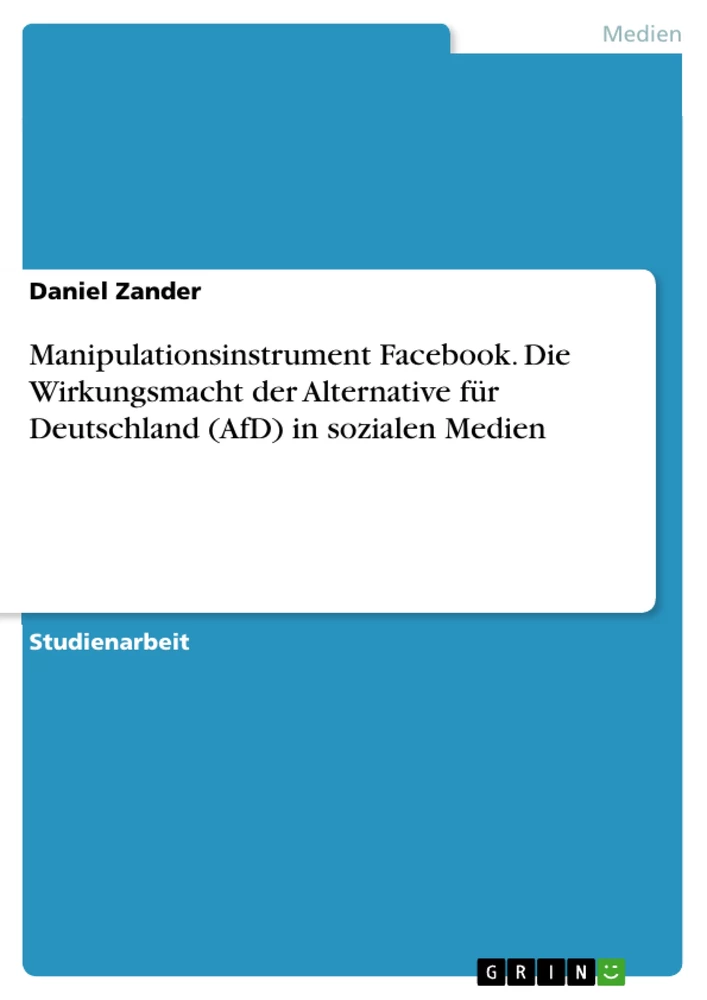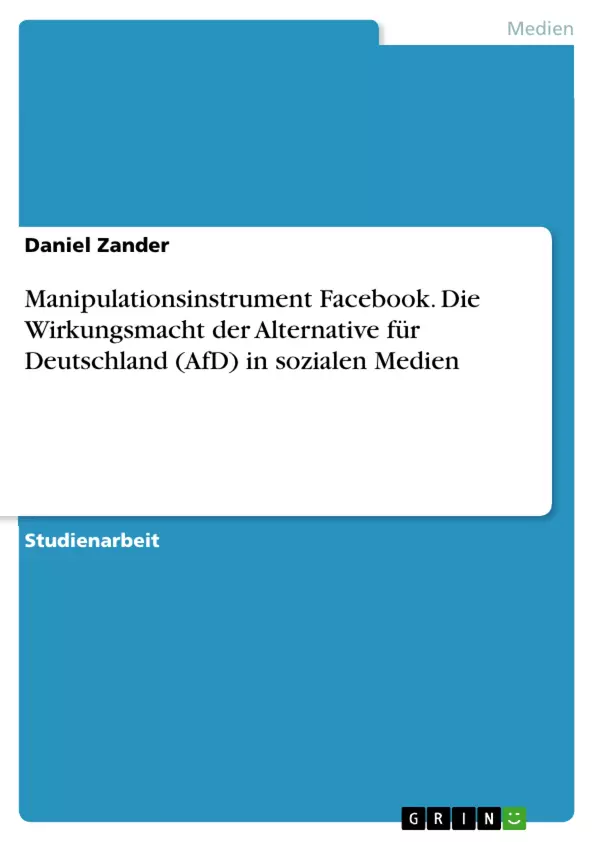Die Arbeit legt einen medienwissenschaftlichen Fokus darauf, wie die Alternative für Deutschland (AfD) das Medium Facebook verwendet. Was präsentiert die Partei auf welche Art ihren vergleichsweise vielen Followern? Versucht die AfD mittels Facebook die Meinung der Nutzer zu beeinflussen? Wie nutzt die Partei die spezifischen Eigenschaften des Mediums Facebook?
Ziel ist es, zu beantworten, inwiefern die Facebook-Seite der Alternative für Deutschland die spezifischen Eigenschaften des sozialen Mediums nutzt, um Auswirkungen auf die reale Gesellschaft zu erzeugen?
Zunächst werden Unterschiede zwischen den für die Arbeit relevanten Medien und dem damit verbundenen Begriff der Medialität dargelegt sowie explizit auf die Adressierung von Medien eingegangen. Der Fokus liegt auf der Art und Weise, wie Nutzer verschiedene Medien rezipieren und welche Möglichkeiten und Einschränkungen Facebook im Vergleich zu anderen Medien besitzt. Anschließend wird der Begriff der Performativität nach Erika Fischer-Lichte sowie nach Judith Butler erläutert. Dieser Begriff sowie der Begriff der Adressierung wird daraufhin in der Analyse der Facebook-Postings der AfD angewendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eigensinnigkeit von Medien
- Unterschiede von Medien
- Adressierung von Medien
- Konzepte der Performativität
- Performativität nach Fischer-Lichte und Judith Butler
- Performativität und Materie
- Analyse des Facebook-Auftritts
- Die AfD auf Facebook
- Adressierung der AfD
- Sprache und Narrative der AfD
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, wie die Alternative für Deutschland (AfD) die Plattform Facebook nutzt, um ihre politische Botschaft zu verbreiten und potenziell die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sie analysiert die spezifischen Eigenschaften des Mediums Facebook und wie die AfD diese zur Erreichung ihrer Ziele einsetzt.
- Die Analyse der spezifischen Eigenschaften von Facebook im Vergleich zu anderen Medien.
- Die Untersuchung der Performativität von Facebook-Postings der AfD im Kontext der Theorien von Erika Fischer-Lichte und Judith Butler.
- Die Analyse der Adressierung von Facebook-Nutzern durch die AfD.
- Die Untersuchung der Sprache und der narrativen Strategien, die die AfD auf Facebook einsetzt.
- Die Analyse des Einflusses der AfD auf Facebook auf die reale Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Facebook für die AfD heraus und führt in die Forschungsfrage ein: Inwiefern nutzt die Facebook-Seite der AfD die spezifischen Eigenschaften des sozialen Mediums, um Auswirkungen auf die reale Gesellschaft zu erzeugen?
Eigensinnigkeit von Medien
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Medialität und untersucht die Unterschiede zwischen verschiedenen Medien, insbesondere zwischen Massenmedien wie der Zeitung, dem Radio und sozialen Plattformen. Es werden verschiedene medienwissenschaftliche Definitionen des Medienbegriffs vorgestellt und der Fokus auf die Adressierung von Medien gelegt.
Konzepte der Performativität
Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Performativität nach Erika Fischer-Lichte und Judith Butler. Es wird diskutiert, wie Performativität in Verbindung mit sozialen Medien steht und wie sie in der Analyse der Facebook-Postings der AfD angewendet werden kann.
Analyse des Facebook-Auftritts
In diesem Kapitel wird der Facebook-Auftritt der AfD analysiert. Es werden die Inhalte der Facebook-Seite, die Adressierung der Nutzer, die Sprache und die narrativen Strategien der AfD untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzt die AfD Facebook für ihre politische Kommunikation?
Die AfD nutzt spezifische Eigenschaften des Mediums, wie direkte Adressierung und performative Sprache, um ihre Narrative zu verbreiten und die Meinung der Nutzer zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt der Begriff der Performativität in der Analyse?
Basierend auf Theorien von Erika Fischer-Lichte und Judith Butler wird untersucht, wie die Postings der AfD Realität nicht nur beschreiben, sondern aktiv mitgestalten.
Was unterscheidet Facebook von traditionellen Massenmedien?
Die Arbeit beleuchtet die Eigensinnigkeit von Medien und zeigt auf, dass soziale Plattformen andere Möglichkeiten der Rezeption und Adressierung bieten als Zeitungen oder Radio.
Welche sprachlichen Strategien setzt die AfD ein?
Die Analyse konzentriert sich auf die spezifischen Narrative und die Art der Adressierung der Follower, um Auswirkungen auf die reale Gesellschaft zu erzeugen.
Was ist das Ziel dieser medienwissenschaftlichen Hausarbeit?
Ziel ist es zu beantworten, inwiefern die Facebook-Seite der AfD mediale Eigenschaften nutzt, um politische Wirkungsmacht zu entfalten.
- Arbeit zitieren
- Daniel Zander (Autor:in), 2020, Manipulationsinstrument Facebook. Die Wirkungsmacht der Alternative für Deutschland (AfD) in sozialen Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541246