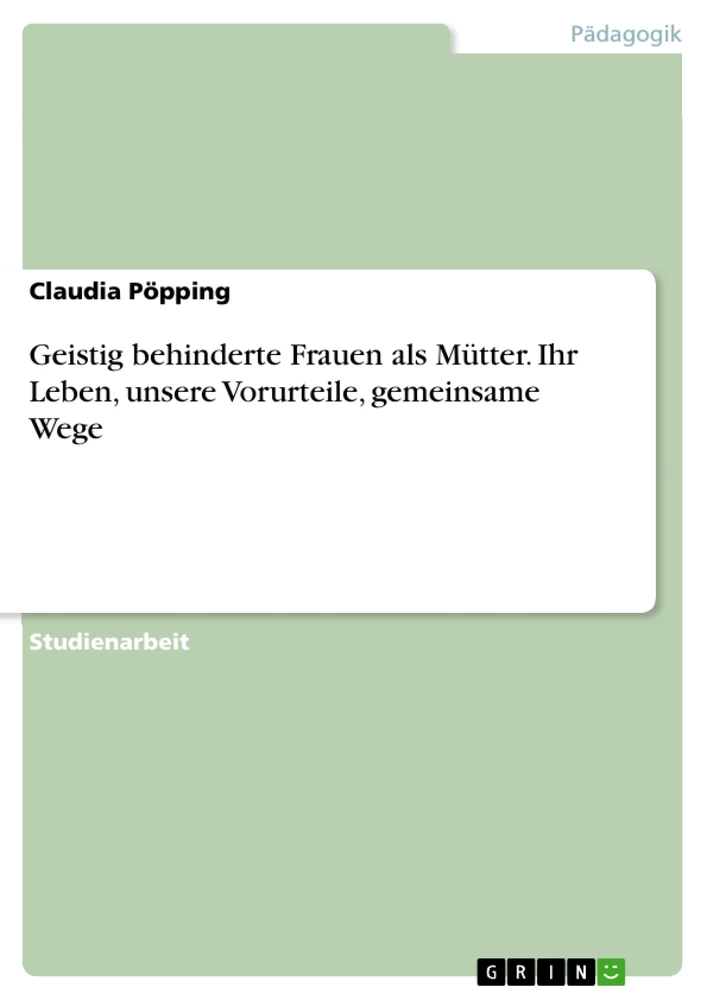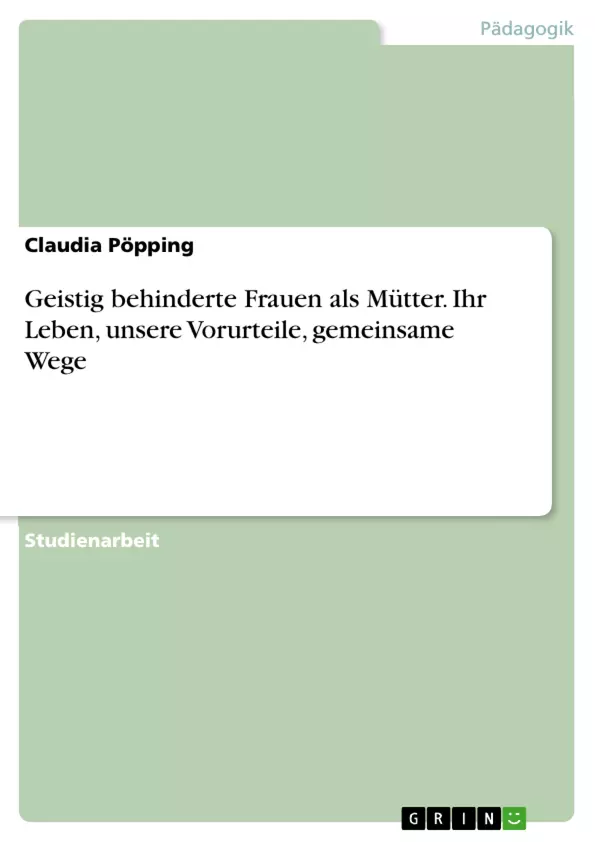Vorliegende Arbeit untersucht die Fragestellung, ob Frauen mit einer geistigen Behinderung in der Lage sein können, eigene Kinder verantwortungsvoll großzuziehen. Ausgehend von der Situation von Frauen mit geistiger Behinderung und ihrer oftmals belasteten Sozialisation in Familie und Gesellschaft werden Entwicklungsaufgaben wie Pubertät, Identitätsentwicklung, Sexualität, Partnerschaft, Ehe und Mutterschaft untersucht. Vorurteile gegenüber geistig behinderten Müttern werden auf ihre Gültigkeit hin reflektiert. Ausgehend vom Normalisierungsprinzip wird schließlich erarbeitet, wie eine optimale Begleitung von Müttern mit sogenannter geistiger Behinderung erfolgen könnte und welche Erfahrungen und Projekte es bisher gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Behinderung- der Versuch einer Begriffsbestimmung
- 2.1 Geistige Behinderung
- 2.2 Das Normalisierungsprinzip
- 3 Zur Situation der geistig behinderten Frau
- 3.1 Mutter-Tochter- Beziehung
- 3.2 Sozialisation in der Schule.
- 3.3 Pubertät
- 3.4 Die Identität als Frau in der Gesellschaft
- 3.5 Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Freunde
- 3.6 Sexualität.
- 3.7 Partnerschaft.
- 3.8 Ehe........
- 3.9 Mutterschaft.
- 4 Vorurteile gegenüber geistig behinderten Müttern
- 4.1 Vorurteil 1: Mütter sind emotional nicht in der Lage, Liebe zu geben
- 4.2 Vorurteil 2: Unzureichende finanzielle Absicherung der Mutter ..
- 4.3 Vorurteil 3: Das Risiko für die Kindesentwicklung ist zu hoch.....
- 4.4 Vorurteil 4: Das Kind wird auch behindert sein
- 5 Ableitungen der bisherigen Betrachtungen für die Begleitung der Frauen....
- 5.1 Die Notwendigkeit einer Trennungsbegleitung- ein aktuelles Beispiel
- 6 Wie sieht eine optimale Begleitung von Mutter und Kind aus? ..
- 6.1 Aspekte auf der gesellschaftlichen Ebene
- 6.2 Aspekte auf der institutionellen Ebene...\n
- 6.3 Aspekte auf der professionellen Ebene
- 7 Zum Stand gegenwärtiger Betreuungsmöglichkeiten.
- 8 Abschließende Betrachtung..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Situation geistig behinderter Frauen als Mütter. Sie untersucht die besonderen Herausforderungen, denen diese Frauen im Laufe ihrer Entwicklung und im Muttersein begegnen, insbesondere in Bezug auf Vorurteile und gesellschaftliche Stigmatisierung. Ziel ist es, die Lebensrealität dieser Frauen besser zu verstehen und Handlungsempfehlungen für die Begleitung von Mutter und Kind abzuleiten.
- Geistige Behinderung und ihre soziale Konstruktion
- Das Normalisierungsprinzip und seine Bedeutung für die Lebensgestaltung geistig behinderter Menschen
- Die besonderen Herausforderungen der Mutterrolle für geistig behinderte Frauen
- Vorurteile gegenüber geistig behinderten Müttern und ihre Auswirkungen
- Die Bedeutung von Unterstützung und Begleitung für geistig behinderte Mütter und ihre Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik geistig behinderter Frauen als Mütter und skizziert den persönlichen Hintergrund der Autorin. Anschließend wird der Begriff „Behinderung“ im Kontext von sozialer Konstruktion beleuchtet und das Normalisierungsprinzip vorgestellt. Kapitel 3 widmet sich den besonderen Herausforderungen, denen geistig behinderte Frauen im Laufe ihrer Entwicklung begegnen, beginnend mit der Mutter-Tochter-Beziehung über die Sozialisation in der Schule und Pubertät bis hin zu Fragen der Identität, Wohnen, Arbeit, Freizeit, Sexualität, Partnerschaft und Ehe. Das vierte Kapitel beleuchtet die Vorurteile, mit denen geistig behinderte Mütter konfrontiert werden, und analysiert die Folgen dieser Vorurteile für die Lebensgestaltung der Frauen und ihre Kinder. Das fünfte Kapitel leitet aus den bisherigen Betrachtungen Handlungsempfehlungen für die Begleitung dieser Frauen ab, wobei ein aktuelles Beispiel für die Notwendigkeit einer Trennungsbegleitung vorgestellt wird. Im sechsten Kapitel werden die Aspekte einer optimalen Begleitung von Mutter und Kind auf gesellschaftlicher, institutioneller und professioneller Ebene beleuchtet. Das siebte Kapitel widmet sich dem Stand gegenwärtiger Betreuungsmöglichkeiten und das achte Kapitel bietet eine abschließende Betrachtung der Thematik.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Normalisierungsprinzip, Mutterschaft, Vorurteile, gesellschaftliche Stigmatisierung, Begleitung, Unterstützung, Lebensqualität, Inklusion, Empowerment
Häufig gestellte Fragen
Können geistig behinderte Frauen verantwortungsvolle Mütter sein?
Die Arbeit bejaht dies unter der Voraussetzung, dass eine adäquate Unterstützung und Begleitung (begleitete Elternschaft) gewährleistet ist.
Welche Vorurteile gibt es gegenüber geistig behinderten Müttern?
Häufige Vorurteile sind, dass sie emotional nicht liebesfähig seien, die Kinderentwicklung gefährdet sei oder das Kind zwangsläufig ebenfalls behindert zur Welt komme.
Was besagt das Normalisierungsprinzip?
Es fordert, dass Menschen mit Behinderung ein Leben führen können, das so weit wie möglich den allgemeinen Lebensbedingungen der Gesellschaft entspricht (inkl. Sexualität und Elternschaft).
Wie sieht eine optimale Begleitung für diese Mütter aus?
Sie umfasst Hilfen auf gesellschaftlicher, institutioneller und professioneller Ebene, wie z. B. Assistenz im Alltag, ohne die Autonomie der Mutter zu untergraben.
Warum ist "Trennungsbegleitung" ein wichtiges Thema?
Falls eine Trennung von Mutter und Kind unvermeidbar ist, muss dieser Prozess professionell begleitet werden, um traumatische Folgen für beide Seiten zu minimieren.
- Quote paper
- Claudia Pöpping (Author), 2004, Geistig behinderte Frauen als Mütter. Ihr Leben, unsere Vorurteile, gemeinsame Wege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54127