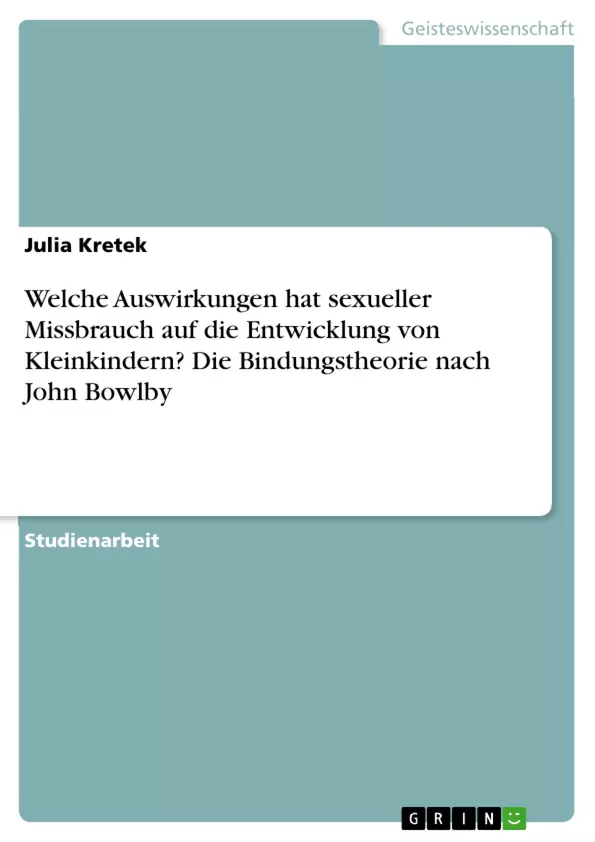Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Auswirkungen von sexuellem Kindesmissbrauch zu erarbeiten. Dies geschieht unter Einbezug der Bindungstheorie, indem zunächst ein Einblick in diese geboten wird. Die verschiedenen Bindungsmuster, die Kinder in den ersten zwei Jahren zu ihren Bezugspersonen entwickeln, werden in Betracht genommen, woraufhin das Augenmerk auf die weitere Entwicklung, je nach Bindungsmuster, gelegt wird. Daraufhin wird der Bezug zu sexuell missbrauchten Kindern und deren jeweiliger Bindung dargestellt, woraufhin nach einer Einführung in das Thema "sexueller Kindesmissbrauch" die Langzeitauswirkungen von Kindesmissbrauch thematisiert werden. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit stellt die Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs dar, indem die neu gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft positiv dazu beitragen, potenzielle Missbrauchsopfer zu erkennen und bestehende Wissensdefizite auszubauen, indem dieses gewonnene Wissen weitergetragen wird.
Die Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs war bereits in der Antike präsent. Erst zum 19. Jahrhundert fand sexueller Missbrauch mehr und mehr Beachtung und wurde als unmoralisch betrachtet. Die Kindheit müsste geschützt werden. Sexuelle Übergriffe galten als sündhaft und wurden zunehmend bestraft. 1982 wandten sich betroffene Frauen erstmals an die Öffentlichkeit. In der Folge wurde dem Thema und der dahinterstehenden Problematik immer mehr Beachtung in der Öffentlichkeit geschenkt.
Dennoch wurden im Jahre 2016 laut polizeilicher Kriminalstatistik 12.019 Anzeigen wegen Kindesmissbrauchs in Deutschland gemeldet. Die Dunkelziffer aufgrund nicht gemeldeter Fälle scheint jedoch erheblich höher zu sein. Über derartige Berichte in den Medien tritt meist Aufregung und Empörung in der Gesellschaft auf, über die Folgen für die Kinder ist sich jedoch kaum jemand bewusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Bindungstheorie
- Bindungsqualitäten
- sexueller Kindesmissbrauch (Definition und Arten)
- Auswirkungen
- psychische Auswirkungen
- physische und psychosomatische Auswirkungen
- soziale Auffälligkeiten
- Sexualverhalten
- Auswirkungen auf die Partnerschaft
- Auswirkungen hinsichtlich des Bindungsaufbaus zu eigenen Kindern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Folgen von sexuellem Kindesmissbrauch auf die Entwicklung von Kleinkindern unter Berücksichtigung der Bindungstheorie nach John Bowlby. Dabei werden die Auswirkungen auf die psychische, physische und soziale Entwicklung sowie das Sexualverhalten der Opfer beleuchtet. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Langzeitfolgen von Kindesmissbrauch zu entwickeln und damit die Prävention von Missbrauch zu fördern.
- Die Bedeutung der Bindungstheorie für das Verständnis der Entwicklung von Kindern
- Die verschiedenen Bindungsqualitäten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung
- Die verschiedenen Formen und Auswirkungen von sexuellem Kindesmissbrauch
- Die Langzeitfolgen von Kindesmissbrauch auf die psychische, physische und soziale Entwicklung
- Die Bedeutung der Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Themas. Anschließend wird die Bindungstheorie von John Bowlby vorgestellt, die die Entwicklung eines emotionalen Bandes zwischen Kind und Bezugsperson betont. Die verschiedenen Bindungsqualitäten, wie sichere, unsicher-vermeidende, unsicher-ambivalente und desorganisierte Bindung, werden im Detail erläutert.
Das Kapitel zum sexuellen Kindesmissbrauch definiert die verschiedenen Formen des Missbrauchs und beleuchtet die möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung der Opfer. Dabei werden die psychischen, physischen, sozialen und sexuellen Folgen des Missbrauchs analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: sexueller Kindesmissbrauch, Bindungstheorie, John Bowlby, Bindungsqualitäten, psychische Auswirkungen, physische Auswirkungen, soziale Auffälligkeiten, Sexualverhalten, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst sexueller Missbrauch die Bindungsqualität eines Kindes?
Missbrauch kann zu desorganisierten Bindungsmustern führen, da die Bezugsperson, die Schutz bieten sollte, zur Quelle von Angst und Gefahr wird.
Was sind die zentralen Thesen der Bindungstheorie nach John Bowlby?
Bowlby betont die Bedeutung eines stabilen emotionalen Bandes zwischen Kind und Bezugsperson für eine gesunde psychische Entwicklung.
Welche Langzeitfolgen hat Kindesmissbrauch?
Die Folgen reichen von psychischen Störungen und sozialen Auffälligkeiten bis hin zu Problemen in späteren Partnerschaften und beim Bindungsaufbau zu eigenen Kindern.
Wie hoch ist die Dunkelziffer bei sexuellem Kindesmissbrauch?
Trotz über 12.000 gemeldeten Fällen jährlich in Deutschland wird vermutet, dass die tatsächliche Zahl aufgrund nicht gemeldeter Fälle erheblich höher liegt.
Welche Rolle spielt Prävention in diesem Kontext?
Das Ziel der Arbeit ist es, durch Wissen über Bindungsmuster und Missbrauchsfolgen dazu beizutragen, potenzielle Opfer früher zu erkennen.
Welche physischen Auswirkungen kann Missbrauch bei Kleinkindern haben?
Neben unmittelbaren Verletzungen treten oft psychosomatische Beschwerden auf, die die körperliche Entwicklung beeinträchtigen können.
- Quote paper
- Julia Kretek (Author), 2018, Welche Auswirkungen hat sexueller Missbrauch auf die Entwicklung von Kleinkindern? Die Bindungstheorie nach John Bowlby, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541286