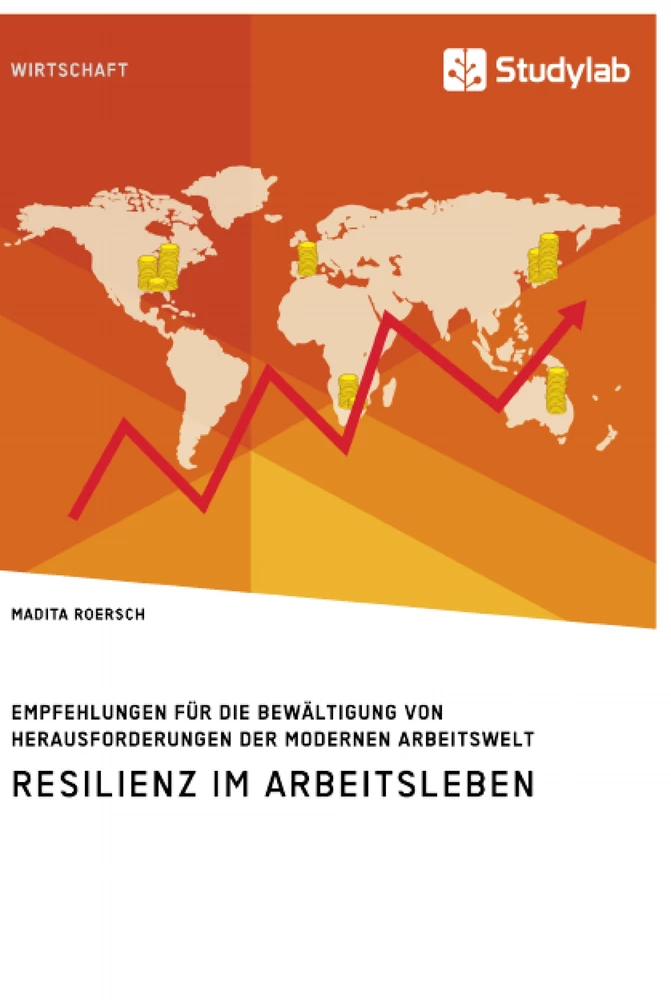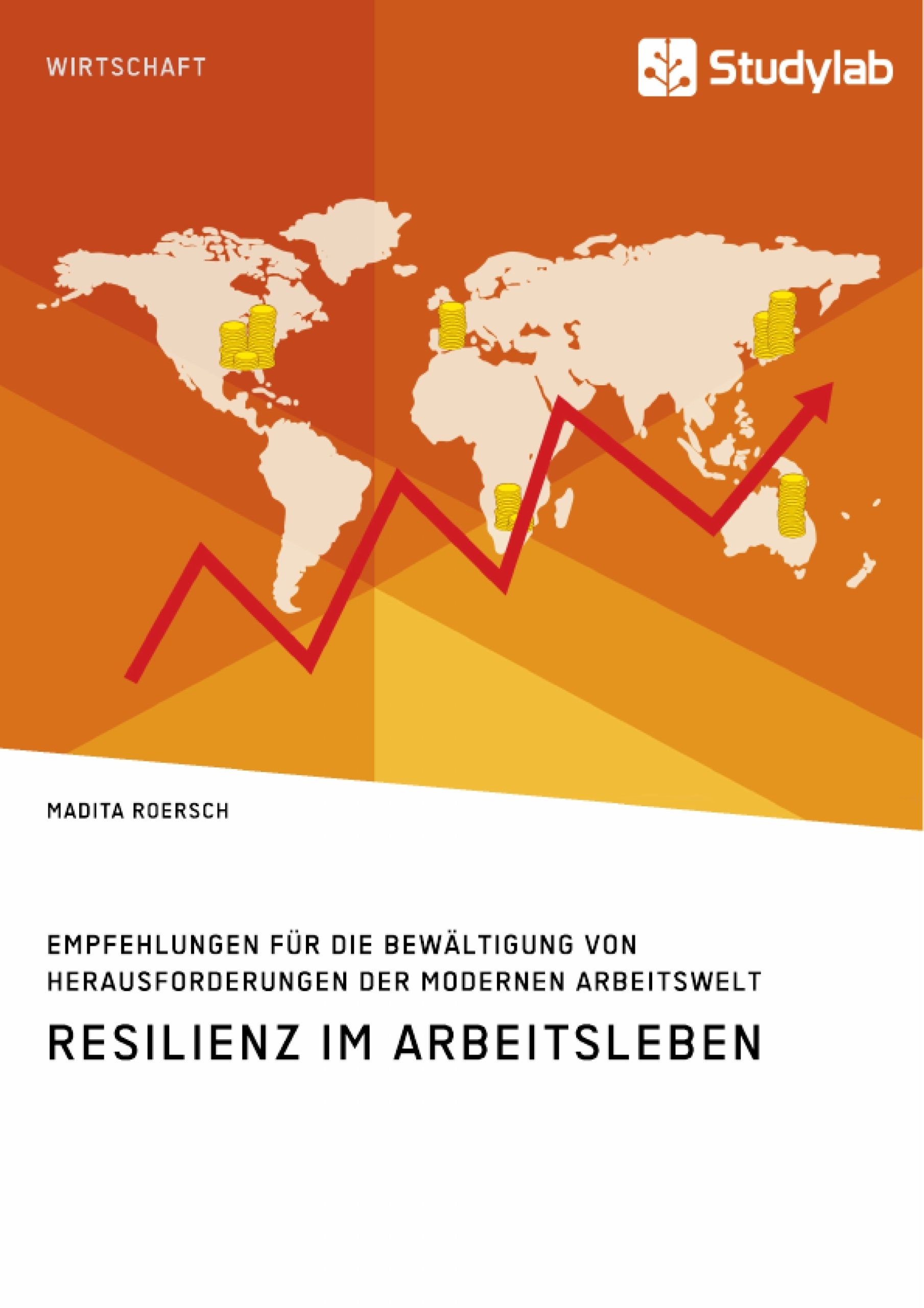Unsere Arbeit hat sich in den letzten 20 Jahren weitreichend verändert. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben werden immer fließender und um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Organisations- und Arbeitsstrukturen anpassen.
Neben positiven Veränderungen und Chancen bringen die neuen Konzepte jedoch auch negative Auswirkungen für die Arbeitnehmer mit sich. Um psychischen Belastungen vorzubeugen, ist Resilienz von entscheidender Bedeutung. Doch wie funktioniert das aktuelle Resilienzmodell im beruflichen Kontext?
Madita Roersch untersucht, welche Faktoren und Prozesse dazu beitragen, dass ein Mitarbeiter psychischen Belastungen besser standhält oder sogar gestärkt daraus hervorgeht. Dabei betrachtet sie die Ebenen Organisation, Team, Führungskraft und Arbeitnehmer. Sie plädiert dafür, dass Resilienzförderung zu einem unverzichtbaren Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Personalentwicklung wird und gibt Handlungsempfehlungen.
Aus dem Inhalt:
- Agilität;
- Motivation;
- Stressbewältigung;
- Widerstandsfähigkeit;
- Belastbarkeit;
- Positive Psychologie
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Aufbau und Vorgehensweise
- Theoretischer Teil
- 2 Grundlagen, Begriffsdefinitionen und Modelle
- 2.1 Veränderungen der Arbeitswelt
- 2.2 Arbeitsgestaltung in der heutigen Zeit
- 2.3 Psychische Belastung und Beanspruchung an der Arbeit
- 2.4 Belastungs-Beanspruchungsmodell
- 2.5 Mögliche Auswirkungen psychischer Belastungen
- 2.6 Kompetenzen & Ressourcen
- 2.7 Resilienz
- 2.8 Risiko- und Schutzfaktoren
- 2.8.1 Resilienzfaktoren
- 2.8.2 Resilienzmodelle
- 2.8.3 Abzugrenzende Konzepte
- 3 Forschungsentwicklung und Einordnung von Resilienz
- 3.1 Entwicklung der Resilienzforschung und wichtige empirische Studien
- 3.2 Einordnung in die Positive Psychologie
- 3.3 Einordnung in die Organisationspsychologie
- 4 Resilienz im beruflichen Kontext
- 4.1 Aktueller Forschungsstand
- 4.2 Resilienzmodell für die Arbeit
- 4.3 Differenzierung auf verschiedenen Wirkebenen
- 4.4 Messinstrumente
- 4.5 Förderungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen
- 4.5.1 Organisationsebene
- 4.5.2 Führungsebene
- 4.5.3 Teamebene
- 4.5.4 Individualebene
- Empirischer Teil
- 5 Die qualitativen Interviews
- 5.1 Präzisierung der Fragestellung
- 5.2 Forschungsmethode und Untersuchungsdesign
- 5.2.1 Auswahl der Gesprächspartner
- 5.2.2 Interviewleitfaden und Gesprächsdurchführung
- 5.3 Datenaufbereitung und -analyse
- 5.4 Untersuchungsergebnisse nach Antwortkategorien
- 6 Anpassung des Mehrebenenmodells und Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Bedeutung von Resilienz im Arbeitskontext. Ziel ist es, einen Überblick über das Resilienzkonzept und den aktuellen Forschungsstand zu geben. Anhand qualitativer Interviews werden Prozesse resilienten Verhaltens und Faktoren auf den Ebenen Individuum, Team und Organisation analysiert, um das bestehende Mehrebenenmodell der Wirkmechanismen von Resilienz zu erweitern. Die Arbeit zeigt zudem mögliche Implikationen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen auf.
- Resilienzkonzept und aktuelle Forschung
- Prozesse resilienten Verhaltens im Arbeitskontext
- Einflussfaktoren von Resilienz auf individueller, Team- und Organisationsebene
- Erweiterung des Mehrebenenmodells der Wirkmechanismen von Resilienz
- Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Förderung von Resilienz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zunehmenden Herausforderungen der modernen Arbeitswelt ein und betont die Bedeutung von Resilienz als Fähigkeit zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Sie beschreibt den aktuellen Forschungsstand und das Defizit an Wissen über resilienzfördernde Faktoren im Arbeitskontext Erwachsener. Die Arbeit zielt auf die Identifizierung dieser Faktoren mittels qualitativer Interviews ab und die Erweiterung eines bestehenden Mehrebenenmodells.
2 Grundlagen, Begriffsdefinitionen und Modelle: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es beschreibt Veränderungen in der Arbeitswelt, die Arbeitsgestaltung, psychische Belastungen und Beanspruchungen, das Belastungs-Beanspruchungsmodell und dessen Auswirkungen. Es definiert Kompetenzen und Ressourcen, erläutert das Konzept der Resilienz, grenzt es von ähnlichen Konzepten ab und beschreibt das Risiko- und Schutzfaktorenprinzip sowie verschiedene Resilienzmodelle.
3 Forschungsentwicklung und Einordnung von Resilienz: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Resilienzforschung, präsentiert wichtige empirische Studien (z.B. die Kauai-Studie), und ordnet Resilienz in die Positive Psychologie und Organisationspsychologie ein. Es hebt die Verschiebung von einem defizitorientierten zu einem ressourcenorientierten Ansatz hervor und diskutiert den aktuellen Forschungsstand im Arbeitskontext.
4 Resilienz im beruflichen Kontext: Das Kapitel präsentiert den aktuellen Forschungsstand zu arbeitsbezogener Resilienz, beleuchtet den Zusammenhang mit Arbeitsleistung, Arbeitszufriedenheit und Gesundheit. Es stellt das Resilienzmodell für die Arbeit von Soucek et al. vor, differenziert die Wirkebenen (Individuum, Team, Organisation) und beschreibt vorhandene Messinstrumente. Abschließend werden Fördermöglichkeiten und Handlungsempfehlungen auf den verschiedenen Ebenen abgeleitet.
5 Die qualitativen Interviews: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik des empirischen Teils der Arbeit. Es präzisiert die Forschungsfragen, erläutert die Wahl der qualitativen Forschungsmethode (leitfadengestützte Interviews und qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring), die Auswahl der Gesprächspartner und den Interviewleitfaden. Die Datenaufbereitung und -analyse werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Resilienz, Arbeitswelt, psychische Belastung, Beanspruchung, Belastungs-Beanspruchungsmodell, Positive Psychologie, Organisationspsychologie, Risiko- und Schutzfaktoren, qualitative Forschung, Mehrebenenmodell, Handlungsempfehlungen, betriebliches Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung, Mitarbeitergesundheit, Teamresilienz, Organisationale Resilienz.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Resilienz im Arbeitskontext
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Bedeutung von Resilienz im Arbeitskontext. Sie beleuchtet das Resilienzkonzept, den aktuellen Forschungsstand und analysiert Prozesse resilienten Verhaltens und Einflussfaktoren auf individueller, Team- und Organisationsebene mittels qualitativer Interviews. Ziel ist die Erweiterung eines bestehenden Mehrebenenmodells und die Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: das Resilienzkonzept und die aktuelle Forschung, Prozesse resilienten Verhaltens im Arbeitskontext, Einflussfaktoren auf individueller, Team- und Organisationsebene, Erweiterung eines Mehrebenenmodells und Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Förderung von Resilienz.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert einen theoretischen Teil mit einem empirischen Teil. Der theoretische Teil basiert auf einer Literaturrecherche und der Analyse bestehender Modelle und Theorien zur Resilienz. Der empirische Teil nutzt qualitative Interviews, um die Erfahrungen und Perspektiven von Beschäftigten zu erfassen und das Mehrebenenmodell zu erweitern. Die Datenanalyse erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Teil (Grundlagen, Begriffsdefinitionen und Modelle; Forschungsentwicklung und Einordnung von Resilienz; Resilienz im beruflichen Kontext), Empirischer Teil (Die qualitativen Interviews; Anpassung des Mehrebenenmodells und Diskussion), Zusammenfassung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert einen Überblick über das Resilienzkonzept und den aktuellen Forschungsstand. Die Ergebnisse der qualitativen Interviews liefern Einblicke in Prozesse resilienten Verhaltens und Einflussfaktoren auf verschiedenen Ebenen (Individuum, Team, Organisation). Diese Ergebnisse werden genutzt, um das bestehende Mehrebenenmodell zu erweitern und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für Unternehmen zu formulieren.
Wer sind die Zielgruppen dieser Arbeit?
Die Zielgruppen sind Wissenschaftler, die sich mit Resilienz, Arbeits- und Organisationspsychologie befassen, sowie Praktiker im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Personalentwicklung. Die Ergebnisse sind relevant für alle, die an der Förderung von Mitarbeitergesundheit und Teamresilienz interessiert sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Resilienz, Arbeitswelt, psychische Belastung, Beanspruchung, Belastungs-Beanspruchungsmodell, Positive Psychologie, Organisationspsychologie, Risiko- und Schutzfaktoren, qualitative Forschung, Mehrebenenmodell, Handlungsempfehlungen, betriebliches Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung, Mitarbeitergesundheit, Teamresilienz, Organisationale Resilienz.
Wie kann ich die vollständige Arbeit einsehen?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Zugriffshinweis einfügen, z.B. über die Universitätsbibliothek erhältlich].
- Arbeit zitieren
- Madita Roersch (Autor:in), 2020, Resilienz im Arbeitsleben. Empfehlungen für die Bewältigung von Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541362