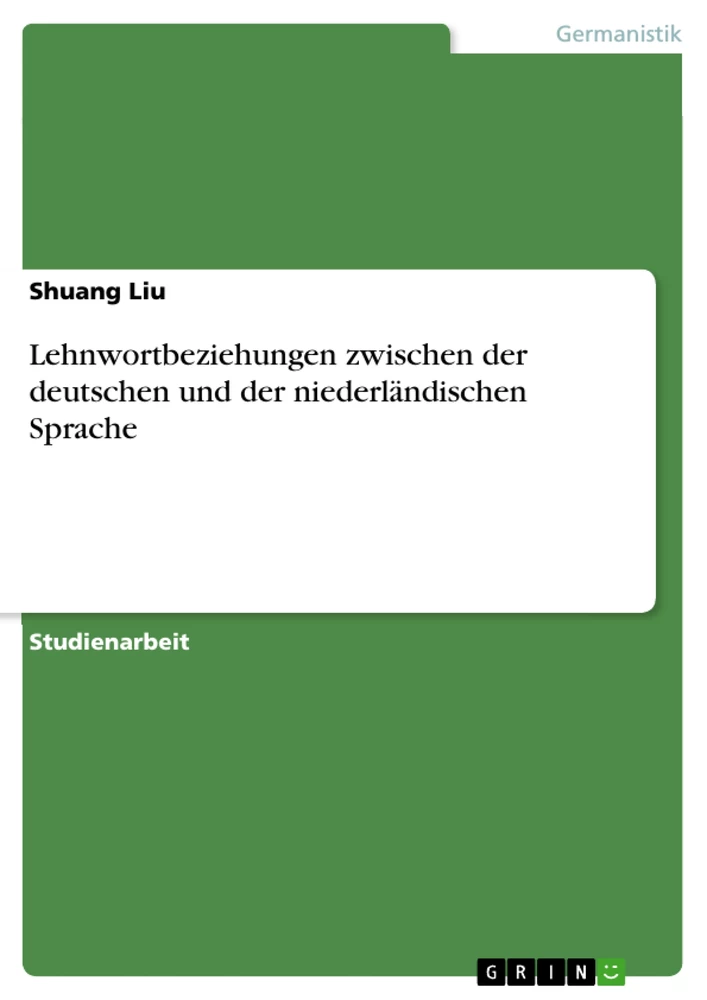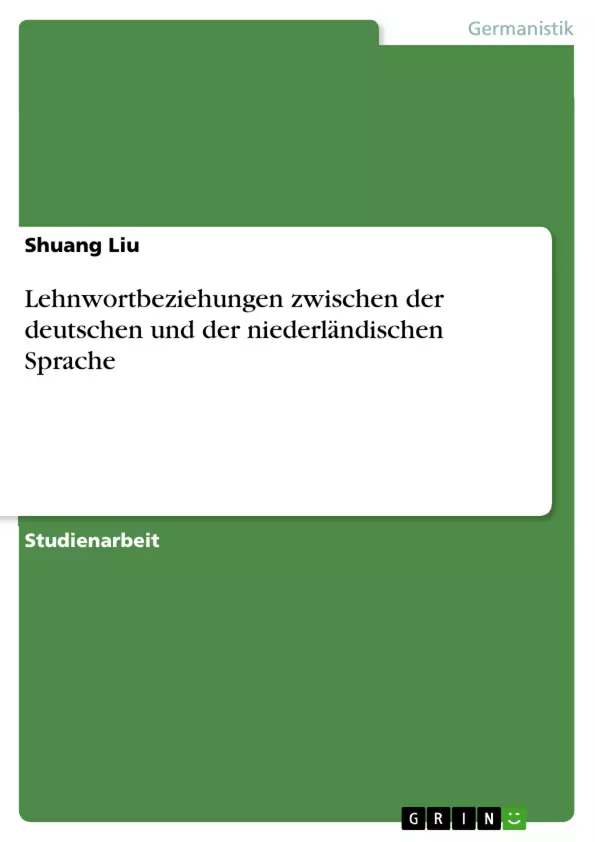Die vorliegende Arbeit analysiert Lehnwortbeziehungen im deutsch-niederländischen Sprachkontakt. Die Lehnwörter werden nicht nur zum Spiegel der Kulturgeschichte des kontinentalwestgermanischen Raumes, sondern darüber hinaus zu Einzelelementen innerhalb der Gesamtstruktur der diachronischen Kommunikationssituation zwischen beiden sich verselbstständigenden Sprachen. Dabei werden die wechselseitigen kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen und persönlichen Beeinflussungen sowie die Entwicklung beider Sprachen am Beispiel des niederländischen Romans „De Tweeling“ (zu deutsch „Die Zwillinge“) von Tessa de Loo dargestellt. Betrachtet werden ca. zwanzig Wörter, die in der deutschen Übersetzung des Romans auftauchen und jeweils im Wortschatz beider Kultursprachen vorkommen bzw. aus der jeweils anderen Kultursprache entlehnt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lehnwortbeziehungen in der Sprachkommunikation
- Diachronische-kulturelle Betrachtungen im Sinne der Wortschatzübernahmen zwischen Deutschland und den Niederlanden
- Deutsche Einflüsse auf den niederländischen Wortschatz
- Das Frühe Mittealter und „Brandaen-Legende“
- Der Einfluss der deutschen Mystik
- Deutschen Wörter in der niederländischen Verkehrssprache
- Luthers Bibelübersetzung in den Niederlanden
- Deutsche literarische Wirkung im 18. Jahrhundert auf die niederländische Sprache
- Niederländische Einflüsse auf den deutschen Wortschatz (insbesondere auf das Niederdeutsche)
- Bewegung niederländischer Siedler und die maritime Expansion auf den niederdeutschen Sprachraum
- Lehnwörter in der Seemannssprache
- Niederländische Lehnwortbeziehungen zu deutschen Lebensbereichen und zum Kulturraum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wechselseitigen Einflüsse der deutschen und niederländischen Sprache im Bereich der Lehnwortbeziehungen. Anhand des Romans „De Tweeling“ (Die Zwillinge) von Tessa de Loo werden kulturelle, religiöse, wirtschaftliche und persönliche Beeinflussungen beleuchtet, die zur Entwicklung beider Sprachen beigetragen haben.
- Diachronische Analyse der Lehnwortbeziehungen im deutsch-niederländischen Sprachkontakt
- Kulturelle Einflüsse und ihre Auswirkungen auf die Wortschatzentwicklung beider Sprachen
- Untersuchung der Kommunikationstruktur zwischen Deutsch und Niederländisch bis ins 18. Jahrhundert
- Bedeutung der Seemannssprache und des Handels für die Lehnwortübernahme
- Einfluss der deutschen Mystik und der Reformation auf den niederländischen Wortschatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lehnwortbeziehungen im deutsch-niederländischen Sprachkontakt ein und stellt den Roman „De Tweeling“ als Analyseobjekt vor.
Das erste Kapitel beleuchtet die diachronische und kulturelle Entwicklung der Lehnwortbeziehungen zwischen Deutsch und Niederländisch. Es werden die historischen Hintergründe der wechselseitigen Einflüsse beleuchtet und deren Auswirkungen auf die Entwicklung beider Sprachen beschrieben.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Einflüsse des Deutschen auf den niederländischen Wortschatz. Es werden verschiedene Epochen betrachtet, darunter das Frühe Mittelalter, die deutsche Mystik, die Reformation sowie die literarische Wirkung des 18. Jahrhunderts.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Einflüssen des Niederländischen auf den deutschen Wortschatz, insbesondere auf das Niederdeutsche. Es wird die Bedeutung der Seemannssprache, des Handels und der niederländischen Kolonialgebiete für die Lehnwortübernahme in den Fokus gerückt.
Schlüsselwörter
Lehnwortbeziehungen, Deutsch-Niederländischer Sprachkontakt, Wortschatzübernahmen, Kulturgeschichte, Sprachentwicklung, Seemannssprache, Hanse, Reformation, Lutherbibel, „De Tweeling“ (Die Zwillinge), Tessa de Loo, Diachronie.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussten sich Deutsch und Niederländisch gegenseitig?
Die Sprachen stehen in engem Kontakt durch Handel (Hanse), Religion (Reformation) und Literatur, was zu zahlreichen wechselseitigen Wortübernahmen führte.
Welchen Einfluss hatte die deutsche Mystik auf das Niederländische?
Religiöse Texte und die deutsche Mystik prägten im Mittelalter den niederländischen Wortschatz im Bereich der Spiritualität und Philosophie.
Welche Rolle spielt die Seemannssprache bei den Lehnwörtern?
Durch die maritime Expansion der Niederlande gelangten viele nautische Fachbegriffe aus dem Niederländischen in den deutschen (besonders niederdeutschen) Sprachraum.
Welche Bedeutung hat Luthers Bibelübersetzung für die Niederlande?
Luthers Übersetzung hatte eine enorme Ausstrahlungskraft und beeinflusste die religiöse Sprache und Wortwahl in den Niederlanden während der Reformationszeit.
Was ist das Analyseobjekt im Roman „De Tweeling“?
In dem Roman von Tessa de Loo werden ca. zwanzig Wörter untersucht, die als Spiegel der gemeinsamen Kulturgeschichte in beiden Sprachen vorkommen.
Was bedeutet diachronische Sprachbetrachtung?
Es ist die Untersuchung der Sprachentwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg, hier speziell die Geschichte der Lehnwortbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden.
- Arbeit zitieren
- Shuang Liu (Autor:in), 2006, Lehnwortbeziehungen zwischen der deutschen und der niederländischen Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54141