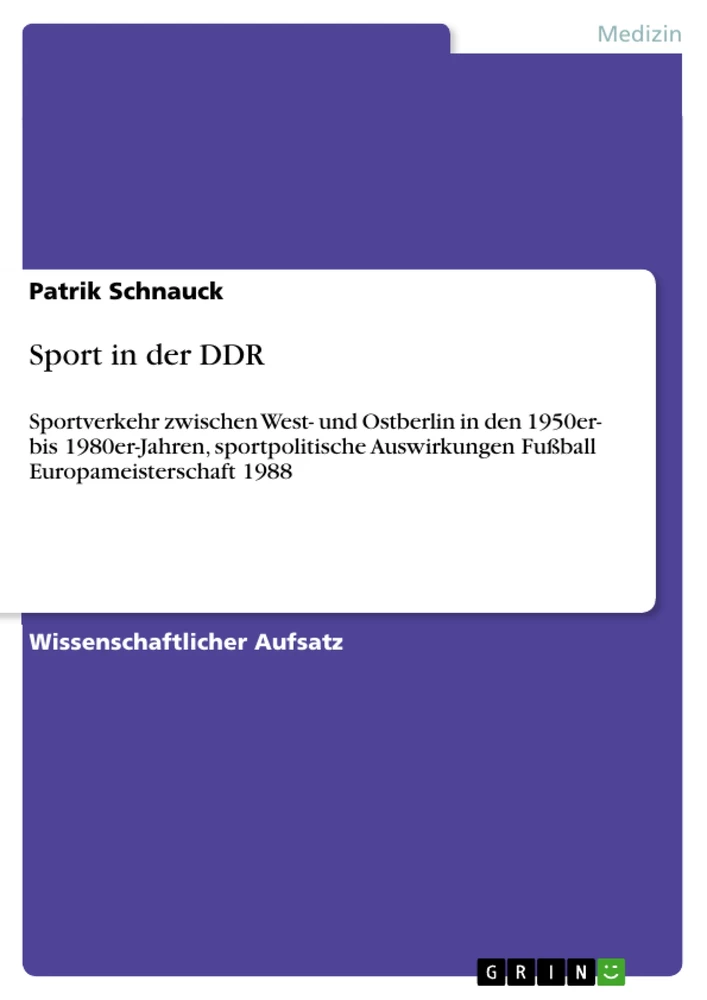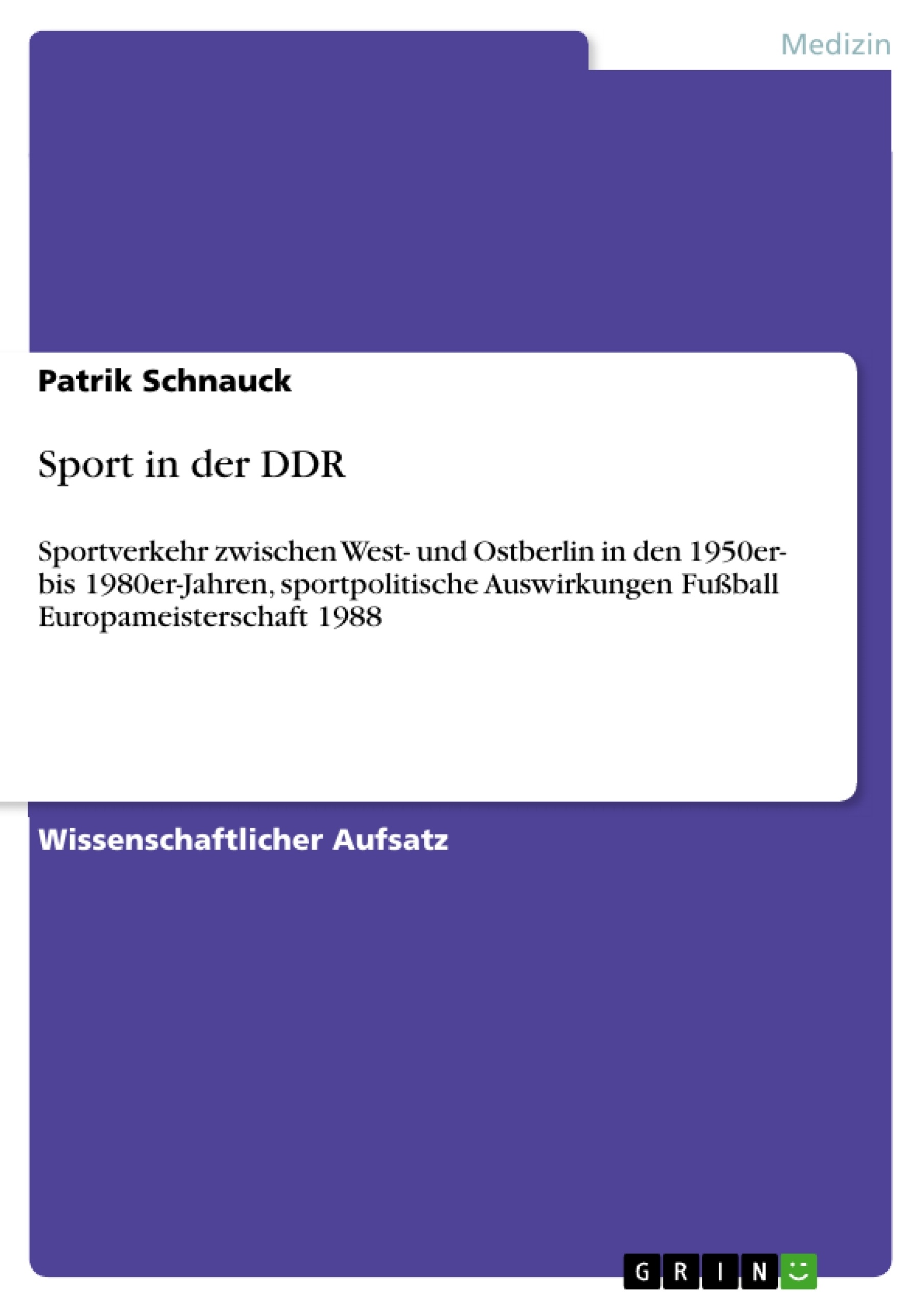Die Teilung Berlins und der anschließende Mauerbau bedeutete für Westberlin eine Isolation zum Rest der Bundesrepublik Deutschland. Auf Grund des „Vier-Mächte-Status“ wurde die Stadt in vier Sektoren aufgeteilt. Die Stadt Westberlin war eine Insel umgeben von der DDR. Somit hatte die Stadt immer eine Sonderstellung in der Bundesrepublik Deutschland. Westberlin gehörte zwar zur Bundesrepublik Deutschland, allerdings enthielten Gesetze die vom westdeutschen Parlament, dem Deutschen Bundestag, verfasst worden sind eine sogenannte „Berlin-Klausel“, die die Wirkung für West-Berlin ausdrücklich regelte. Die Gesetze wurden danach vom Berliner Abgeordnetenhaus erneut beschlossen und erst dadurch rechtswirksam. Außerdem gab es verschiedende Besonderheiten wie Reisebeschränkungen, der Behelfspass und der entmilitarisierte Status. Um eine Verbindung zur Bundesrepublik aufrecht zu erhalten bemühte man auch den Sport um Hilfe. So wurden symbolische, aber auch nationale und internationale Sportveranstaltungen in Westberlin organisiert.
Parallel dazu entwickelte sich Ostberlin zu einer Sportstadt, sodass sich eine Parallelkultur feststellen lässt. Das Dasein Berlins als „Inselstadt“ bürgte auch verschiedene Probleme (z.B. Fußball EM 1988) mit sich, welche zu innerdeutschen sportpolitischen Krisen führten.
Der Sportenthusiasmus brachte aber auch die Menschen der Stadt zusammen und ließ den Glauben an ein Gesamtdeutschland immer aufrecht leben (Fankultur Hertha BSC und Union Berlin).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Politische Situation - Einordnung in die gesamtdeutsche Geschichte
- 2.1 Schreibweisen der Stadtteile
- 2.2 Berlin-Frage
- 2.3 Berlin-Krise
- 2.4 Drei-Staaten-Theorie
- 2.5 Viermächteabkommen - Beginn der Entspannung
- 2.6 Besonderheiten für Bürger der Stadt Berlin (West)
- 3. Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin in den 1950er- bis 1980er-Jahren
- 3.1 Neue Richtlinien für den Sportverkehr
- 3.2 Der Mauerbau am 13. August 1961 und die Auswirkungen auf den Sportverkehr
- 3.3 Die Olympische Berlin-Formel“ von 1965
- 3.4 Die „interne Liste“ ab 1971
- 3.5 Das Sportprotokoll zwischen Gmelin und Ewald
- 3.6 Der Sportverkehr in den 1980er-Jahren
- 4. Sportpolitische Auswirkungen Fußball Europameisterschaft 1988
- 5. Parallelkultur in der geteilten Stadt
- 6. Sportliche Annäherung - Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC Berlin und Union Berlin
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der politischen Teilung Berlins auf den Sportverkehr und die sportliche Kultur in der Stadt während des Kalten Krieges. Sie beleuchtet die komplexen politischen und sportpolitischen Herausforderungen, die sich aus der geteilten Stadt und den unterschiedlichen Interessen der Siegermächte ergaben.
- Die politische Situation Berlins im Kalten Krieg und ihre Einordnung in die gesamtdeutsche Geschichte.
- Der Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin, einschließlich Boykotte und Regelungen.
- Die Entwicklung einer Parallelkultur im Sport in den beiden Stadtteilen.
- Sportpolitische Krisen, wie die Nicht-Berücksichtigung Westberlins als Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft 1988.
- Innerdeutsche Annäherungen im Sport, am Beispiel der Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC und Union Berlin.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt Berlin als einen zentralen Schauplatz des Kalten Krieges, in dem die Gegensätze zwischen West- und Ostberlin deutlich wurden. Sie hebt die Bedeutung der Berlin-Blockade, der Berlin-Krise und des Mauerbaus hervor und unterstreicht die stetige Bedeutung der "Berlin-Frage" für den Sportverkehr, der durch Boykotte und restriktive Regelungen gekennzeichnet war. Die unterschiedlichen Ziele von West- und Ostberlin im Sport – die Demonstration der Bindung an die Bundesrepublik bzw. die positive internationale Repräsentation der DDR – werden ebenfalls angesprochen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der sportlichen Parallelkultur und innerdeutscher Annäherungen an.
2. Politische Situation - Einordnung in die gesamtdeutsche Geschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Teilung Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnend mit der Einteilung in Besatzungszonen und Sektoren. Es analysiert die wirtschaftliche Spaltung durch die Einführung der D-Mark und die daraus resultierende Berlin-Blockade. Die Berlin-Krise, der Mauerbau und das Viermächteabkommen von 1971 werden als entscheidende Wendepunkte in der Geschichte der geteilten Stadt dargestellt, die den Sportverkehr und die sportliche Kultur nachhaltig beeinflussten. Die unterschiedlichen Schreibweisen von "West-Berlin" und "Ost-Berlin" werden als Ausdruck der politischen Situation und der unterschiedlichen Ansprüche auf Berlin untersucht.
3. Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin in den 1950er- bis 1980er-Jahren: Das Kapitel behandelt den Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin über die Jahrzehnte des Kalten Krieges. Es beleuchtet die Auswirkungen des Mauerbaus auf den Sport und die Einführung neuer Richtlinien. Die „Olympische Berlin-Formel“ von 1965 und die „interne Liste“ ab 1971 werden als Versuche beschrieben, den Sportverkehr zu regulieren. Das Sportprotokoll zwischen Gmelin und Ewald zeigt die Bemühungen um einen geregelten Austausch, während die anhaltende Dominanz von Boykotten durch den Ostblock die Schwierigkeiten verdeutlicht. Die Entwicklung des Sportverkehrs in den 1980er Jahren wird im Kontext der politischen Entspannung betrachtet.
5. Parallelkultur in der geteilten Stadt: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung einer eigenständigen sportlichen Kultur in beiden Teilen Berlins. Es beleuchtet, wie beide Seiten versuchten, mit Sportstätten und Veranstaltungen zu punkten und ihr jeweiliges politisches System zu präsentieren. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen sportlichen Ausrichtungen und den jeweiligen politischen Botschaften, die durch den Sport vermittelt wurden.
6. Sportliche Annäherung - Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC Berlin und Union Berlin: Dieses Kapitel konzentriert sich auf ein bemerkenswertes Beispiel innerdeutscher Annäherung während des Kalten Krieges: die Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Es analysiert diese Freundschaft als ein Beispiel für überwindende Grenzen und die Entstehung von Gemeinsamkeiten trotz der politischen Teilung. Die Bedeutung dieser Freundschaft als Symbol der Hoffnung und des Austauschs im Kontext des Kalten Krieges wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Berlin, Kalter Krieg, geteilte Stadt, Sportverkehr, Sportpolitik, Parallelkultur, Fanfreundschaft, Berlin-Frage, Drei-Staaten-Theorie, Mauerbau, West-Berlin, Ost-Berlin, Boykott, Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen der politischen Teilung Berlins auf den Sportverkehr und die sportliche Kultur während des Kalten Krieges
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der politischen Teilung Berlins auf den Sportverkehr und die sportliche Kultur während des Kalten Krieges. Sie beleuchtet die komplexen politischen und sportpolitischen Herausforderungen, die sich aus der geteilten Stadt und den unterschiedlichen Interessen der Siegermächte ergaben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Situation Berlins im Kalten Krieg, den Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin (einschließlich Boykotte und Regelungen), die Entwicklung einer Parallelkultur im Sport in beiden Stadtteilen, sportpolitische Krisen (z.B. die Nicht-Berücksichtigung Westberlins als Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft 1988) und innerdeutsche Annäherungen im Sport (am Beispiel der Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC und Union Berlin).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Politische Situation (Einordnung in die gesamtdeutsche Geschichte), Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin (1950er- bis 1980er-Jahre), Sportpolitische Auswirkungen Fußball Europameisterschaft 1988, Parallelkultur in der geteilten Stadt, Sportliche Annäherung (Fanfreundschaft Hertha BSC/Union Berlin) und Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Thematik.
Wie wird die politische Situation Berlins dargestellt?
Das Kapitel zur politischen Situation beschreibt die Teilung Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg, die Berlin-Blockade, die Berlin-Krisen, den Mauerbau und das Viermächteabkommen von 1971 als entscheidende Wendepunkte. Es analysiert die wirtschaftliche Spaltung durch die Einführung der D-Mark und die unterschiedlichen Schreibweisen von "West-Berlin" und "Ost-Berlin" als Ausdruck der politischen Situation.
Wie wird der Sportverkehr zwischen West- und Ostberlin dargestellt?
Das Kapitel zum Sportverkehr analysiert die Auswirkungen des Mauerbaus, die Einführung neuer Richtlinien, die „Olympische Berlin-Formel“ von 1965 und die „interne Liste“ ab 1971. Es beschreibt das Sportprotokoll zwischen Gmelin und Ewald und die anhaltende Dominanz von Boykotten durch den Ostblock. Die Entwicklung des Sportverkehrs in den 1980er Jahren wird im Kontext der politischen Entspannung betrachtet.
Was versteht man unter der "Parallelkultur" im Sport?
Das Kapitel zur Parallelkultur untersucht die Entwicklung eigenständiger sportlicher Kulturen in beiden Teilen Berlins. Es beleuchtet, wie beide Seiten versuchten, mit Sportstätten und Veranstaltungen zu punkten und ihr jeweiliges politisches System zu präsentieren, sowie die unterschiedlichen sportlichen Ausrichtungen und politischen Botschaften.
Wie wird die Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC und Union Berlin dargestellt?
Die Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC und Union Berlin wird als bemerkenswertes Beispiel innerdeutscher Annäherung während des Kalten Krieges analysiert. Sie wird als ein Beispiel für überwindende Grenzen und die Entstehung von Gemeinsamkeiten trotz der politischen Teilung und als Symbol der Hoffnung und des Austauschs im Kontext des Kalten Krieges hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berlin, Kalter Krieg, geteilte Stadt, Sportverkehr, Sportpolitik, Parallelkultur, Fanfreundschaft, Berlin-Frage, Drei-Staaten-Theorie, Mauerbau, West-Berlin, Ost-Berlin, Boykott, Wiedervereinigung.
- Citar trabajo
- Patrik Schnauck (Autor), 2009, Sport in der DDR, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541580