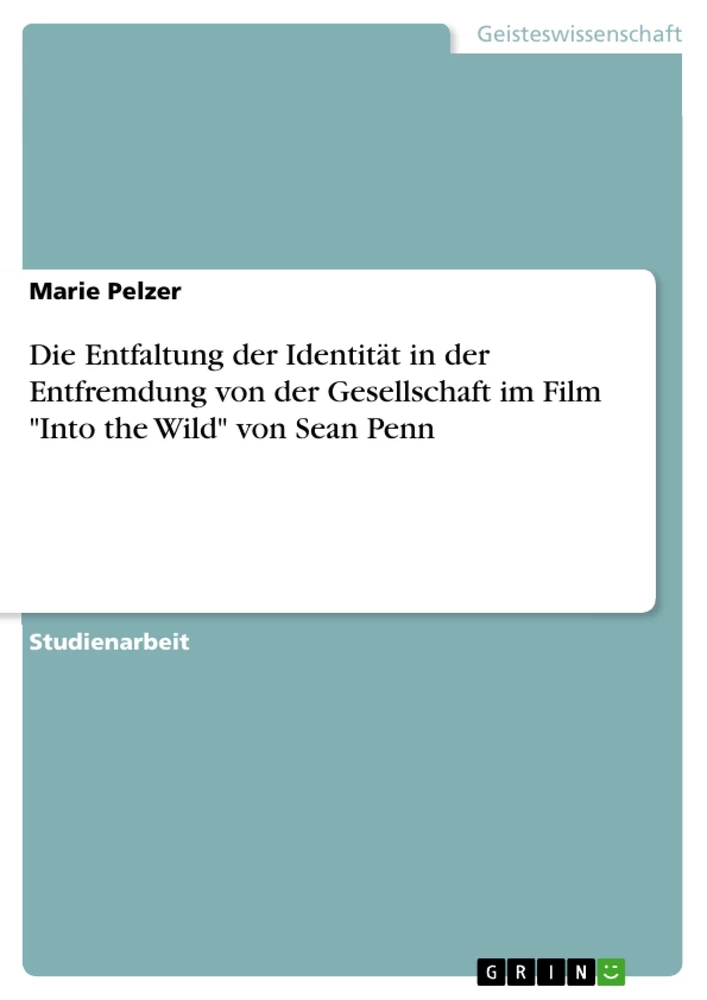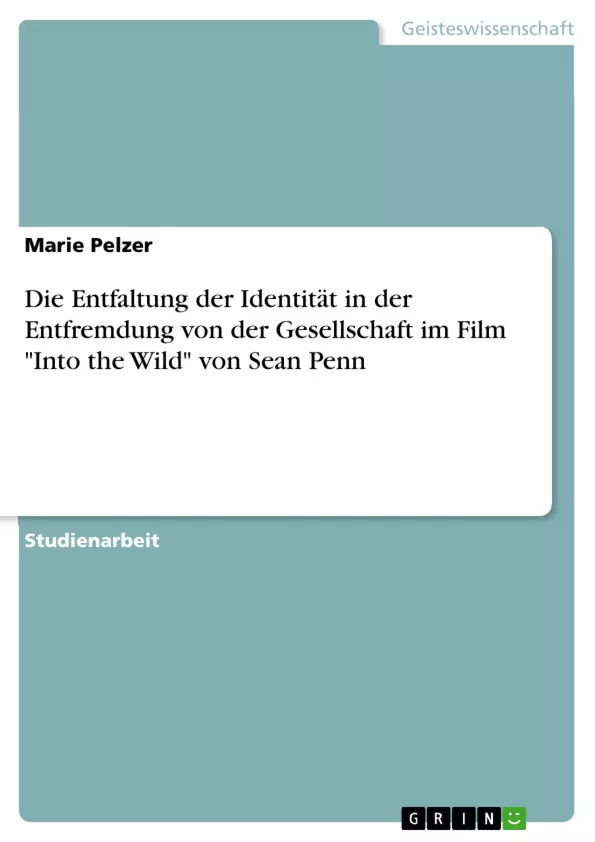Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, worauf Identität basiert. Hierfür setzt sich der Autor damit auseinander, wie es dem Protagonisten Chris im Film "Into the Wild" von Sean Peann möglich ist, durch seine Flucht vor der Gesellschaft in Einklang mit sich Selbst zu kommen.
Am Anfang der Arbeit steht die Begründung der Themenwahl sowie eine Inhaltsangabe von Into the Wild. Anschließend setzt sich der Autor mit der Problematik der Definition des Identitätsbegriffs auseinander und beleuchtet die Begriffe Identitätskrise und Identitätsfindung beziehungsweise Identitätssuche. Darauffolgend werden gesellschaftliche Normen, die Individualität und damit die Identität beeinflussen erläutert und die Einflüsse der Familie erarbeitet. Beide Bereiche, Gesellschaft und Familie, werden am Beispiel des Protagonisten aus dem Film veranschaulicht und auch seine spezifischen Wirkungen gezeigt.
Danach veranschaulicht der Autor, wie Chris sich in seiner Entfremdung von der Gesellschaft wandelt. Des Weiteren wird die Frage behandelt, wie er die Entfaltung seiner Identität fördert, indem er sich von der Gesellschaft entfremdet. Abschließend wird der Aufbau des Films beschrieben und zwei Szenen auf filmtechnische Mittel in Bezug auf die Darstellung der Natur und das Freiheitsgefühl untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung der Themenwahl
- Zum Film: Handlung und Charaktere
- Identität
- Die Vielschichtigkeit des Begriffes und dessen Definition
- Die Identitätskrise
- Identitätssuche und Identitätsfindung
- Die Einschränkung der Identität durch die Gesellschaft und die Familie am Beispiel von Christopher McCandless
- Der familiäre Einfluss
- Die Einschränkung durch gesellschaftliche Normen
- Das Konzept der fünf Säulen der Identität
- Die Vorstellung des Konzepts
- Das Konzept in Bezug auf Christopher McCandless
- Die Entwicklung von Christopher McCandless' Identität
- Christopher McCandless' Identität vor und während der Reise und kurz vor seinem Tod
- Wie fördert Christopher McCandless die Entfaltung seiner Identität durch die Entfremdung von der Gesellschaft?
- Filmtechnische Analyse in Bezug auf die Natur und das Freiheitsgefühl
- Der Filmaufbau
- Kamera - Schnitt – Musik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht die Entfaltung der Identität des Protagonisten Christopher McCandless im Film „Into the Wild“ von Sean Penn. Die Arbeit analysiert, wie McCandless' Suche nach Freiheit und Selbstfindung durch die Abwendung von gesellschaftlichen Normen und familiären Einflüssen gefördert wird.
- Identität und ihre Vielschichtigkeit
- Die Auswirkungen von gesellschaftlichen Normen und familiären Einflüssen auf die Identität
- Die Bedeutung der Entfremdung von der Gesellschaft für die Selbstfindung
- Die Rolle der Natur in der Suche nach Freiheit und Identität
- Die filmische Darstellung von Identität und Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Themenwahl und die Handlung des Films "Into the Wild" vor. Sie gibt einen Überblick über die Geschichte des Protagonisten Christopher McCandless und seine Reise in die Wildnis Alaskas. Kapitel zwei erörtert den vielschichtigen Identitätsbegriff und analysiert die Phänomene der Identitätskrise, Identitätssuche und Identitätsfindung. Kapitel drei befasst sich mit den einschränkenden Einflüssen der Gesellschaft und der Familie auf die Individualität, wobei Christopher McCandless als Beispiel dient. Kapitel vier stellt das Konzept der fünf Säulen der Identität vor und analysiert, wie dieses Konzept auf die Entwicklung von Christopher McCandless' Identität angewendet werden kann. Kapitel fünf untersucht die Veränderungen in Christopher McCandless' Identität vor, während und nach seiner Reise in die Wildnis. Kapitel sechs analysiert die filmischen Mittel in "Into the Wild", insbesondere in Bezug auf die Darstellung der Natur und des Freiheitsgefühls.
Schlüsselwörter
Identität, Entfremdung, Gesellschaft, Familie, Selbstfindung, Freiheit, Natur, Film, "Into the Wild", Christopher McCandless, Sean Penn.
- Quote paper
- Marie Pelzer (Author), 2016, Die Entfaltung der Identität in der Entfremdung von der Gesellschaft im Film "Into the Wild" von Sean Penn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541606