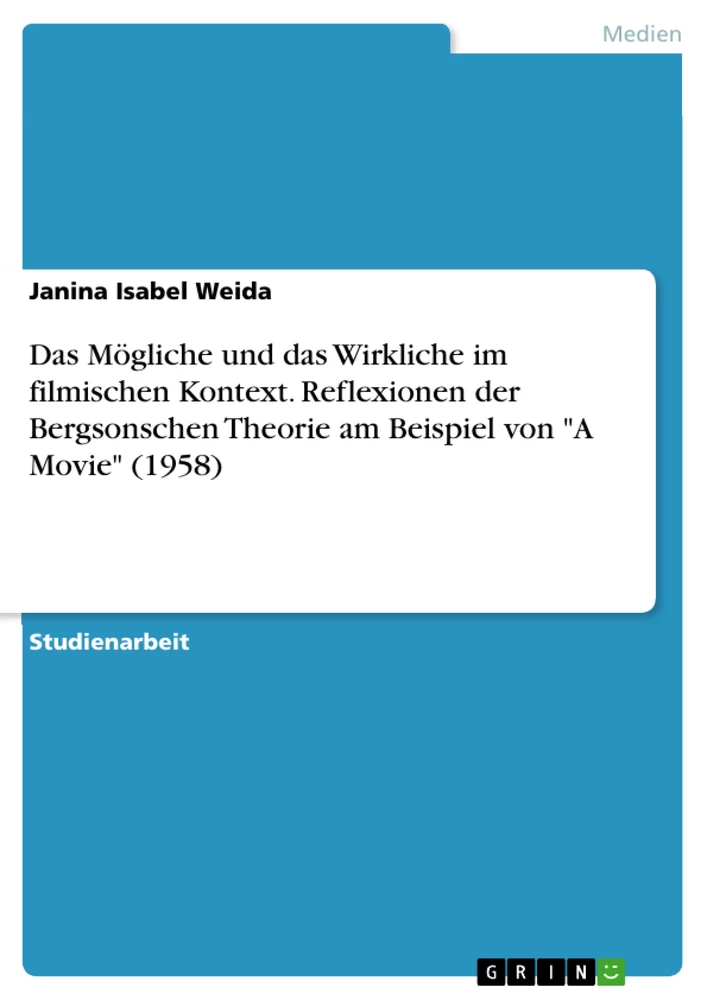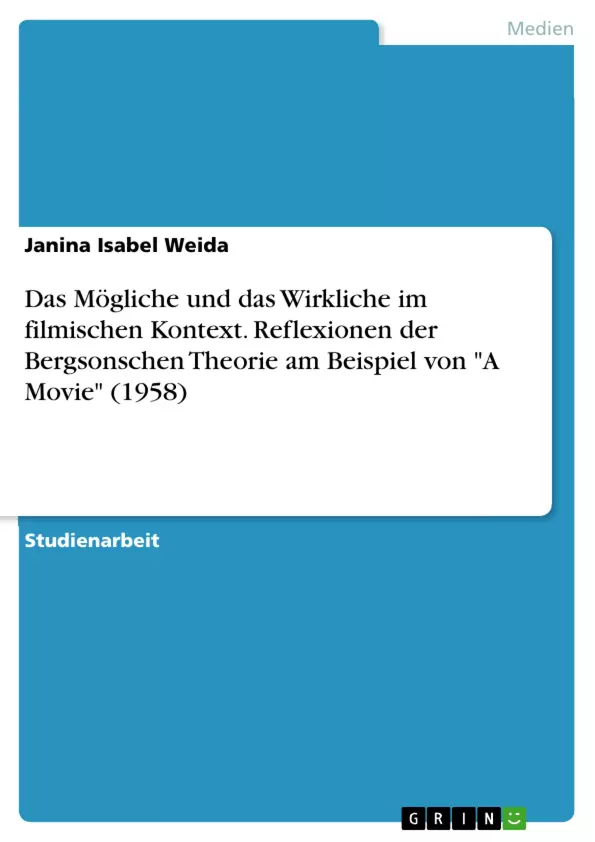Dieser Arbeit liegt im Allgemeinen die Frage zugrunde, wie sich die Konstituierung filmischer Bilder mit Bergsons Gedanken zu Möglichkeit und Wirklichkeit erklären lässt und warum seine Theorie so wichtig ist, um die Korrelation dieser Bilder womöglich erst richtig zu begreifen. Um diese Untersuchung an einem Filmbeispiel zu konkretisieren, soll A Movie (Bruce Conner, USA 1958) als Paradigma für das Phänomen der Found Footage Filme dienen, deren Beschaffenheit die Problematik der Entstehung von Filmbildern und ihrer Relation zu Möglichkeit und Wirklichkeit bereits impliziert.
Sicherlich lässt sich das breite Spektrum der Filme, die mit gefundenem Material arbeiten, nicht auf einen Film herunterbrechen, jedoch markiert A Movie einen zentralen und richtungsweisenden Moment in der Geschichte avantgardistischer Found Footage Filme. Conners Werk bietet als eines der ersten und filmgeschichtlich bedeutendsten, welches mit Found Footage Material arbeitet, einen geeigneten Ausgangspunkt für die Untersuchung dieser filmischen Verknüpfungen.
Ein künstlerisches Werk wird oft als Realisierung oder Verwirklichung einer Idee bezeichnet, als Erfindung, durch welche bereits im Raum stehende Möglichkeiten umgesetzt werden. Zuerst existiert irgendwo im Abstrakten eine Möglichkeit, die schließlich ins Konkrete verwirklicht wird – so die weit verbreitete Annahme. Doch wenn bereits die Möglichkeiten von vornherein als gegeben erscheinen – weshalb wird die Menschheit dennoch so oft vom Wesen ihrer Verwirklichung überrascht? Weshalb ist es uns nicht schon längst möglich, die Zukunft vorherzusehen und weshalb begreifen wir oft erst im Nachhinein, ob wir tatsächlich richtig oder falsch gehandelt haben?
Der französische Philosoph und Nobelpreisträger für Literatur Henri Bergson widmet sich in einem Vortrag aus dem Jahr 1930 genau dieser Problematik der Relation von Möglichem und Wirklichem bzw. Verwirklichung und versucht damit, einen Irrtum in der gängigen Auffassung über dieses Verhältnis offenzulegen. Auch wenn sich Bergson selbst sehr kritisch gegenüber dem filmischen Medium äußerte und durchaus keinen Status als Filmtheoretiker anstrebte, stellen sich seine Überlegungen vor dem Hintergrund der Entstehung und Verknüpfung kinematographischer Bilder bei näherer Beschäftigung mit diesem Phänomen als Bereicherung, wenn nicht sogar unabdingbare Reflexionen heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung der Hausarbeit
- Das Mögliche und das Wirkliche nach Bergson im filmischen Kontext
- Found Footage Filme als Reflexion der Theorie Bergsons
- Bruce Conners A Movie als Beispiel
- Hintergrundinformationen zum Film
- Mikrokosmische Analyse
- Formale Aspekte
- Inhaltliche Beobachtungen
- Makrokosmische Bezüge
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Verbindung zwischen Bergsons Theorie von Möglichkeit und Wirklichkeit und der Entstehung filmischer Bilder. Der Fokus liegt dabei auf Found Footage Filmen und insbesondere auf Bruce Conners A Movie (1958) als exemplarischem Beispiel.
- Bergsons Konzept von Möglichkeit und Wirklichkeit im Kontext filmischer Bilder
- Die Rolle von Found Footage Filmen als Reflexion der Bergsonschen Theorie
- Mikro- und Makrokosmische Analyse von A Movie als Beispiel für die Anwendung der Theorie
- Das Verhältnis von Wiederholung und Neuem in der filmischen Produktion
- Der Einfluss von subjektiven Wahrnehmungen auf die Rezeption filmischer Bilder
Zusammenfassung der Kapitel
- Zielsetzung der Hausarbeit: Die Einleitung stellt die grundlegende Fragestellung der Arbeit dar: Wie lässt sich die Konstituierung filmischer Bilder mit Bergsons Theorie von Möglichkeit und Wirklichkeit erklären? Dabei wird A Movie als Fallbeispiel für Found Footage Filme vorgestellt.
- Das Mögliche und das Wirkliche nach Bergson im filmischen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet Bergsons Gedanken zur unaufhörlichen Schöpfung von Neuem und deren Implikationen für das filmische Medium. Es wird argumentiert, dass sowohl die Realisierung eines Films durch den Regisseur als auch die individuelle Wahrnehmung des Zuschauers von unvorhersehbaren Elementen geprägt sind.
- Found Footage Filme als Reflexion der Theorie Bergsons: Der Begriff des Found Footage Films wird definiert und mit der Theorie Bergsons in Verbindung gebracht. Es wird argumentiert, dass diese Filmform die Problematik der Entstehung von Filmbildern und deren Relation zu Möglichkeit und Wirklichkeit auf einzigartige Weise spiegelt.
- Bruce Conners A Movie als Beispiel: Dieses Kapitel analysiert A Movie als Beispiel für einen Found Footage Film, indem es sowohl auf mikrokosmische (formale und inhaltliche Aspekte) als auch auf makrokosmische (Beziehungen zwischen Film und Theorie) Ebenen eingeht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themengebieten Filmästhetik, Filmwissenschaft, Found Footage, Henri Bergson, Möglichkeit und Wirklichkeit, Schöpfung, Zeit, Dauer, subjektive Wahrnehmung und filmisches Bild.
Häufig gestellte Fragen
Welche Theorie von Henri Bergson wird auf Filme angewandt?
Es geht um Bergsons Überlegungen zum Verhältnis von „Möglichkeit“ und „Wirklichkeit“ sowie seine Konzepte von Zeit und Dauer.
Was ist ein „Found Footage Film“?
Ein Film, der ausschließlich oder überwiegend aus bereits existierendem, „gefundenem“ Filmmaterial zusammengeschnitten wird.
Warum ist Bruce Conners „A Movie“ (1958) so bedeutend?
Er gilt als wegweisendes Werk des avantgardistischen Found Footage Kinos, das durch seine Montage völlig neue Sinnzusammenhänge schafft.
Wie hängen Bergsons Theorien mit der Filmmontage zusammen?
Die Montage verwirklicht eine von vielen Möglichkeiten der Bildverknüpfung und erschafft so eine neue filmische Wirklichkeit.
Kritisierte Bergson das Kino?
Ja, Bergson sah das Kino kritisch, da er fand, es zerlege die fließende Zeit in künstliche Einzelbilder (kinematographischer Irrtum).
- Quote paper
- Janina Isabel Weida (Author), 2016, Das Mögliche und das Wirkliche im filmischen Kontext. Reflexionen der Bergsonschen Theorie am Beispiel von "A Movie" (1958), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541862