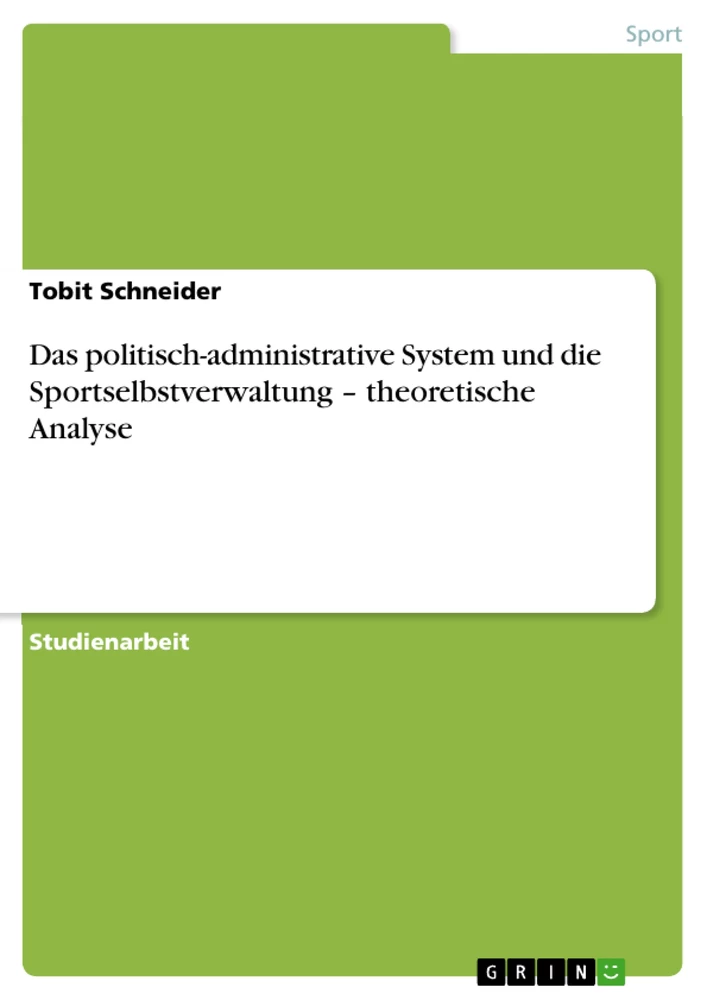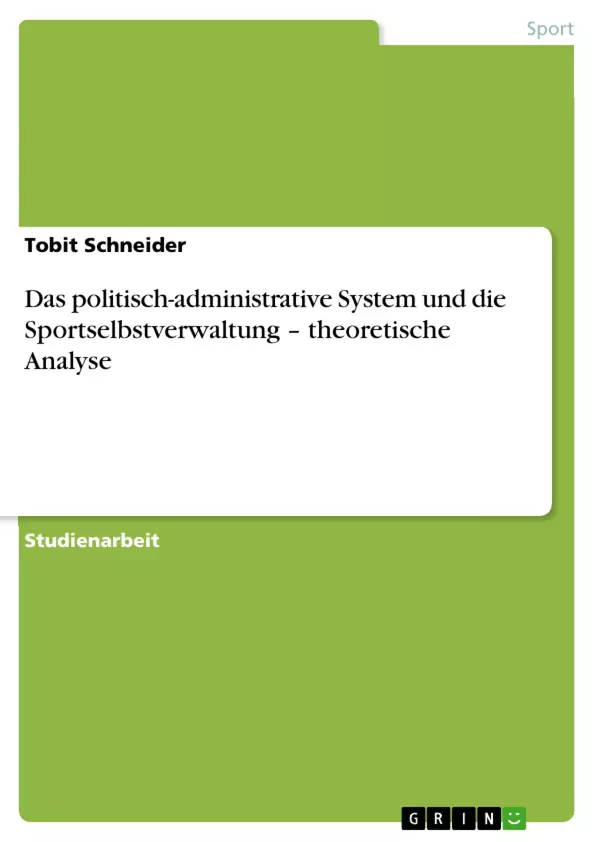Nachdem sich die Politikwissenschaftler Klaus Heinemann und Rolf Meier Mitte der neunziger Jahre bereits intensiv mit dem Verhältnis des Staats und des organisierten Sports auseinandersetzten, ist die Wiederaufarbeitung Peter Lösches, der die Problematik des Verhältnisses zwischen Staat und Sport anhand eines Strukturierungsansatzes versucht einzugrenzen, Anlass das Thema erneut unter Berücksichtigung aller Aspekte zu beleuchten.
Zunächst war es Rolf Meier, der 1995 „das Verhältnis von Interessensverbänden und Staat im Allgemeinen und das Verhältnis vom Deutschen Sportbund nebst Mitgliedverbänden und Staat im Besonderen“ (Meier 1995, 91) untersuchte. Meier tat dies vor allem unter dem Aspekt des Neokorporatismus.
1996 folgte dann ein Beitrag Klaus Heinemanns, der sich ebenfalls mit dem Legitimationsproblemen im Verhältnis von Sport und organisiertem Sport beschäftigte. Heinemann nahm zwar den Begriff des Neokorporatismus in seiner Arbeit wieder auf, doch war der Grundsatz der Autonomie Hauptmerkmal seines Beitrags. So seien „Unabhängigkeit und Selbstverantwortung des Sports fundamentale Grundprinzipien der Sportpolitik der Bundesrepublik Deutschland“ (vgl. Heinemann 1996, 178). Dieses Prinzip, was auch als Subsidiaritätsprinzip verstanden werden kann, schließt sich grundsätzlich mit dem Prinzip des Neokorporatismus aus.
Folglich wurden zwei Konzepte für das Verhältnis zwischen Staat und Sport erarbeitet, die sich stark unterscheiden.
Auf diesem komplexen Thema aufbauend, versuchte Peter Lösche die Politologie des Sports zu strukturieren.
Im folgenden Beitrag wird zunächst die Beziehung von Sport und Politik herausgestellt. Zusammenhänge und Interessenskonflikte werden genauso Thema sein, wie die Vielfalt der Verflechtungen mit Bezug auf das duale System der Sportselbstverwaltung und ihre Zusammenarbeit mit der öffentlichen, staatlichen Sportverwaltung. Thema ist die Frage, inwieweit die Arten der Interaktion von Sport und Staat, also einerseits die als neokorporatistisch in Erscheinung tretende Interaktion und andererseits die Interaktionsweise die dem Subsidiaritätsprinzip folgt, sich kombinieren bzw. sich in das mit dem Sport verflochtene politisch-administrative System gemeinsam einordnen lassen können.
Abschließend gilt mein Hauptaugenmerk dem Strukturierungsansatz der Politologie des Sports nach Lösche unter Miteinbeziehung der Konzepte des Neokorporatismus und der Subsidiarität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beziehungen von Sport und Politik
- Zusammenhänge und Interessenskonflikte von Sport und Politik
- Das duale System - Vielfalt der Verflechtungen
- Interaktionsweisen zwischen Sport und Politik
- Subsidiarität
- Neokorporatismus
- Schlussbetrachtung
- Strukturierungsansatz nach Lösche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Verhältnis von Sport und Politik, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Zusammenspiel des politisch-administrativen Systems und der Sportselbstverwaltung liegt. Ziel ist es, die verschiedenen Interaktionsweisen zwischen Sport und Politik zu verstehen und die Komplexität dieses Verhältnisses zu beleuchten.
- Analyse der Zusammenhänge und Interessenskonflikte zwischen Sport und Politik
- Untersuchung des dualen Systems der Sportselbstverwaltung und seiner Verflechtungen mit der staatlichen Sportverwaltung
- Behandlung der Interaktionsweisen Neokorporatismus und Subsidiarität im Verhältnis von Sport und Politik
- Einordnung dieser Interaktionsweisen in das politisch-administrative System im Zusammenhang mit dem Sport
- Anwendung des Strukturierungsansatzes der Politologie des Sports nach Lösche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Verhältnisses zwischen Sport und Politik ein und beleuchtet den Forschungsstand zu diesem Thema, insbesondere die Arbeiten von Klaus Heinemann und Rolf Meier. Es werden die zentralen Konzepte des Neokorporatismus und der Subsidiarität im Kontext der Interaktionsweisen von Sport und Staat vorgestellt.
Beziehungen von Sport und Politik
Dieses Kapitel erläutert die Beziehung zwischen Sport und Politik, indem es zunächst den Begriff des Sports und die Intention politischer Handlung definiert. Anschließend werden die Zusammenhänge und Interessenskonflikte zwischen Sport und Politik anhand von Beispielen und Argumenten aus verschiedenen Perspektiven herausgearbeitet.
Interaktionsweisen zwischen Sport und Politik
Dieses Kapitel befasst sich mit den Interaktionsweisen zwischen Sport und Politik, wobei die Konzepte des Neokorporatismus und der Subsidiarität im Mittelpunkt stehen. Die unterschiedlichen Formen der Interaktion werden analysiert und ihre Bedeutung für das Verhältnis von Sport und Staat diskutiert.
Schlüsselwörter
Sportpolitik, Sportselbstverwaltung, politisch-administratives System, Neokorporatismus, Subsidiarität, duale System, Interessenkonflikte, Interaktionsweisen, Strukturierungsansatz, Politologie des Sports.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Sportselbstverwaltung" in Deutschland?
Es beschreibt die Autonomie des organisierten Sports, sich unabhängig von staatlicher Einmischung selbst zu verwalten, basierend auf dem Subsidiaritätsprinzip.
Was ist der Unterschied zwischen Subsidiarität und Neokorporatismus?
Subsidiarität betont die Eigenverantwortung des Sports, während Neokorporatismus eine enge Verflechtung und Zusammenarbeit zwischen Sportverbänden und staatlichen Institutionen beschreibt.
Welche Interessenskonflikte gibt es zwischen Sport und Politik?
Konflikte entstehen oft bei Fragen der Finanzierung, der Autonomie versus staatlicher Kontrolle oder wenn der Sport für politische Zwecke instrumentalisiert wird.
Was ist der Strukturierungsansatz nach Peter Lösche?
Lösche versucht, die Politologie des Sports zu ordnen, indem er die komplexen Interaktionsformen zwischen dem politisch-administrativen System und der Sportselbstverwaltung analysiert.
Wer sind die zentralen Theoretiker in der Sportpolitik-Forschung?
In dieser Arbeit werden insbesondere die Arbeiten von Klaus Heinemann, Rolf Meier und Peter Lösche herangezogen.
- Quote paper
- Tobit Schneider (Author), 2004, Das politisch-administrative System und die Sportselbstverwaltung – theoretische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54209