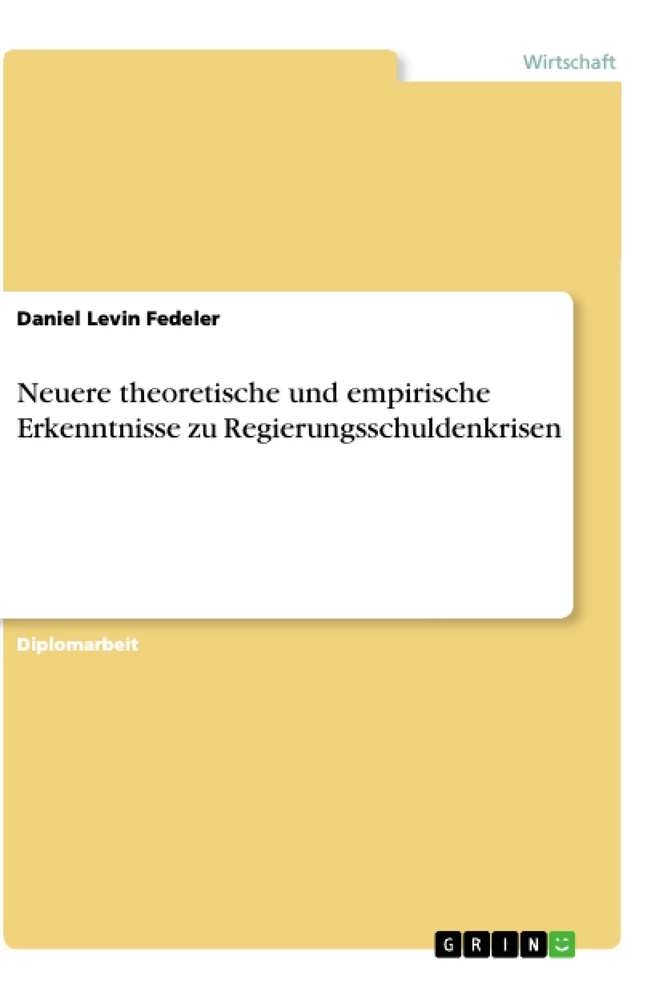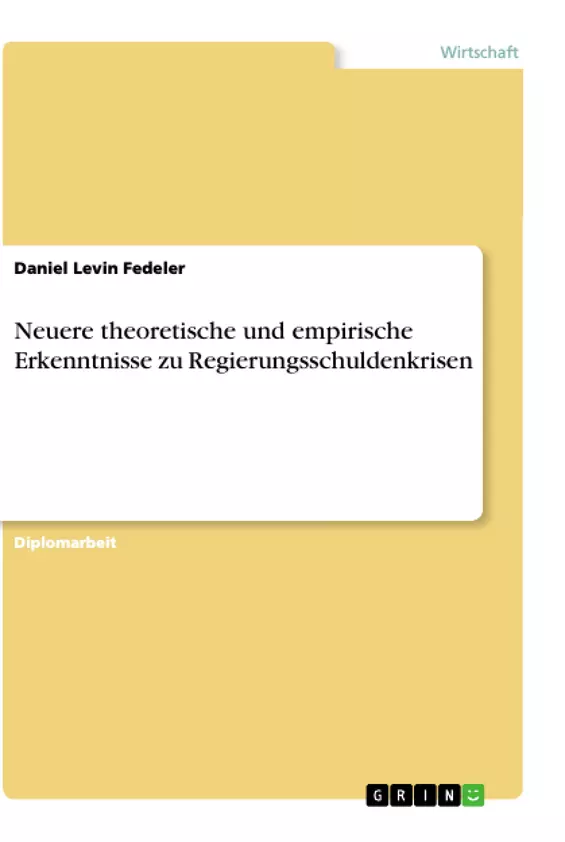In der volkswirtschaftlichen Forschung widmen sich, gerade in der jüngsten Vergangenheit, einige Autoren unterschiedlichen Fragestellungen auf dem Gebiet der Regierungsschuldenkrisen . Die hier vorliegende Arbeit liefert einen Überblick über die empirischen Befunde und modell-theoretischen Erkenntnisse zu der Entstehung, dem Vollzug und dem Ende von Regierungsschuldenkrisen.
Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008 und der seit 2010 in Europa herrschenden Staatsschuldenkrise ist eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, welche verschiedenen Fragestellungen zu dem Thema Schuldenkrisen nachgehen. Insbesondere die Fragen nach der Entstehung wie auch nach der Ansteckungsgefahr solcher Schuldenkrisen sind in den Fokus der Wirtschaftswissenschaftler gerückt. In den verschiedenen Arbeiten und Publikationen sind in diesem Zusammenhang eine Vielzahl an Theorien aufgeworfen worden, deren Beantwortung eine ganze Reihe von empirisch-theoretischen Modellen hervorgebracht hat. In diesen Modellen werden unterschiedliche Schwerpunktfragen vorgestellt und diskutiert. Aufgrund dessen bietet diese Arbeit in den nachfolgenden Kapiteln einen Überblick über die zu diesem Themengebiet entstandene Literatur und die hieraus resultierenden empirischen wie auch theoretischen Modellen zu Regierungsschuldenkrisen.
Allgemein betrachtet ist mit einer Krise ein gefährlicher Zustand oder eine Situation gemeint, die bei zu einem Höhe- oder Wendepunkt einer Entscheidungssituation auftaucht. Zu beachten ist, dass dieser Zustand in den meisten Fällen lediglich im Zusammenhang mit negativen (erwarteten) Entwicklungen gebräuchlich ist. Nach Steiner (2013) werden Krisen im monetären Sektor in drei Arten von Finanzkrisen unterteilt. Dies sind Bankenkrisen, Währungskrisen und Staatsschuldenkrisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Aktualitätsbezug der Arbeit
- Themenabgrenzung
- Aufbau/Gliederung der Arbeit
- Überblick über die theoretischen Fragestellungen und bisherige Arbeiten
- Überblick über die theoretischen Fragestellungen
- Bisherige modell-theoretische Literatur
- Sich selbsterfüllende Schuldenkrisen
- Einfluss von Devisenreserven
- Ex-post Neuverhandlungen
- Politische Anreizsysteme
- Laufzeit von Schulden
- Einfluss der Geldpolitik
- Einordnung der in dieser Arbeit ausführlicher dargelegten Modelle in den Kontext der Forschung
- Darlegung der zu unterscheidenden Modelle
- Schwache Sanktionsmöglichkeiten und eine Kultur des „Nicht Bezahlens“
- Einordnung des Modells in den Forschungskontext
- Modelltheoretische Umgebung
- Das Gleichgewicht
- Die Wahrscheinlichkeit von Krisen
- Die „Committment Lösung“ – Zwischen kurz- und langfristigen Schulden
- Einordnung des Modells in den Forschungskontext
- Modelltheoretische Umgebung
- Die Strategie
- Das Gleichgewicht
- Die Rolle einer Internationalen Finanzinstitution
- Restrukturierung
- Neuprofilierung
- Sich selbsterfüllende Regierungsschuldenkrise durch Liquidierungsdruck unter rationalem Verhalten
- Die Einordnung des Modells in den theoretischen Kontext
- Modelltheoretische Umgebung
- Die Anleihemärkte
- Das Gleichgewicht
- Sich selbsterfüllende Liquiditätskrisen
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Regierungsschuldenkrisen und analysiert die Entstehung, den Vollzug und das Ende dieser Krisen. Die Arbeit beleuchtet sowohl empirische Befunde als auch modelltheoretische Erkenntnisse, die in den vergangenen Jahren im Kontext der Finanz- und Staatsschuldenkrise entstanden sind.
- Die Entstehung von Regierungsschuldenkrisen
- Die Rolle von Erwartungen und Koordinationsversagen
- Die Auswirkung von politischer Unsicherheit und Anreizsystemen
- Der Einfluss der Laufzeitstruktur von Staatsschulden
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Geldpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aktualitätsbezug der Arbeit erläutert und eine Themenabgrenzung vornimmt. Anschließend werden die wichtigsten theoretischen Fragestellungen und die bisherige Literatur zu Regierungsschuldenkrisen zusammengefasst.
Im dritten Kapitel werden drei modelltheoretische Arbeiten im Detail präsentiert und diskutiert. Zunächst wird das Modell von Arellano/Kocherlakota (2014) vorgestellt, das die Entstehung von Krisen durch schwache Sanktionsmöglichkeiten und eine Kultur des „Nicht Bezahlens“ erklärt. Anschließend wird das Modell von Fernández/Martin (2014) analysiert, das den Einfluss der Laufzeitstruktur von Schulden auf die Krisenwahrscheinlichkeit beleuchtet. Abschließend wird das Modell von Conesa/Kehoe (2015) vorgestellt, das sich mit sich selbsterfüllenden Liquiditätskrisen unter rationalem Verhalten befasst.
Schlüsselwörter
Regierungsschuldenkrisen, Staatsschuldenkrise, Finanzkrise, Modelltheoretische Ansätze, Selbsterfüllende Prophezeiung, Koordinationsversagen, Politische Anreizsysteme, Laufzeitstruktur von Schulden, Geldpolitik, Restrukturierung, Neuprofilierung, Liquiditätsdruck, Risikoprämien, Ausfallwahrscheinlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen Regierungsschuldenkrisen laut aktueller Forschung?
Krisen entstehen oft durch eine Kombination aus ökonomischen Schocks, politischer Instabilität, Koordinationsversagen an den Märkten und sich selbsterfüllenden Erwartungen der Investoren.
Was ist eine „sich selbsterfüllende“ Schuldenkrise?
Dabei führen die Sorgen der Gläubiger vor einem Zahlungsausfall zu steigenden Zinsen, was die Schuldenlast so stark erhöht, dass der befürchtete Ausfall tatsächlich eintritt (Liquiditätskrise).
Welchen Einfluss hat die Laufzeitstruktur von Staatsschulden?
Kurzfristige Schulden erhöhen den Liquiditätsdruck und die Anfälligkeit für Krisen, während langfristige Schulden mehr Planungssicherheit bieten, aber oft teurer sind.
Was versteht man unter einer „Kultur des Nicht-Bezahlens“?
Dies bezieht sich auf Modelle (z.B. Arellano/Kocherlakota), in denen schwache Sanktionsmöglichkeiten dazu führen, dass Staaten trotz vorhandener Ressourcen strategisch entscheiden, ihre Schulden nicht zu bedienen.
Welche Rolle spielen internationale Finanzinstitutionen?
Institutionen wie der IWF können durch Restrukturierungen oder Neuprofilierungen von Schulden helfen, Krisen zu bewältigen oder das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen.
- Arbeit zitieren
- Daniel Levin Fedeler (Autor:in), 2015, Neuere theoretische und empirische Erkenntnisse zu Regierungsschuldenkrisen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542111