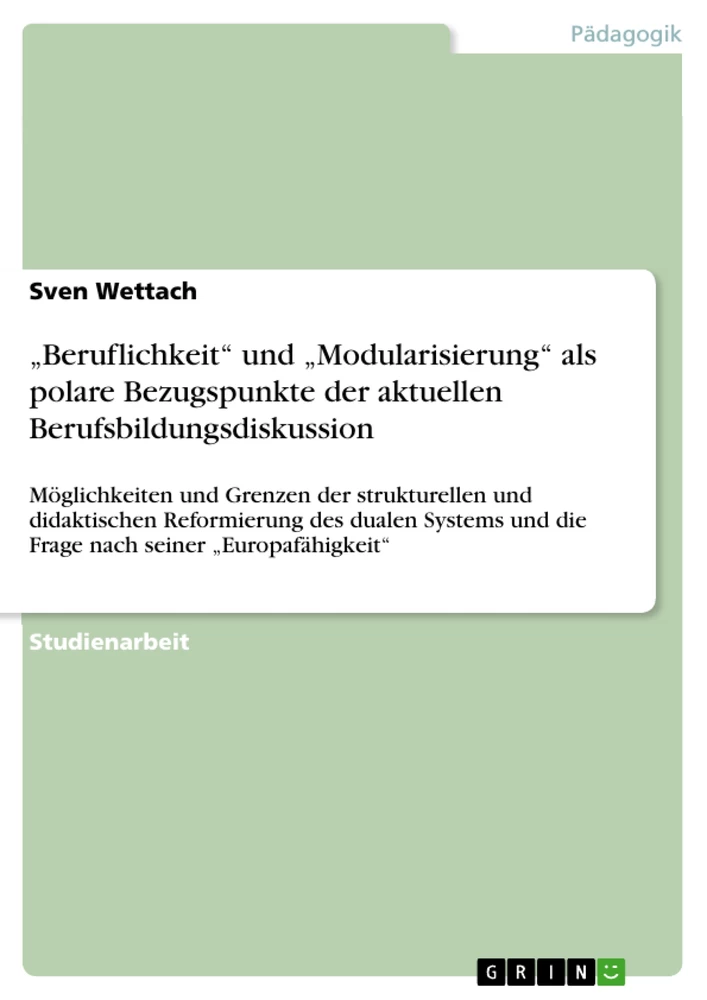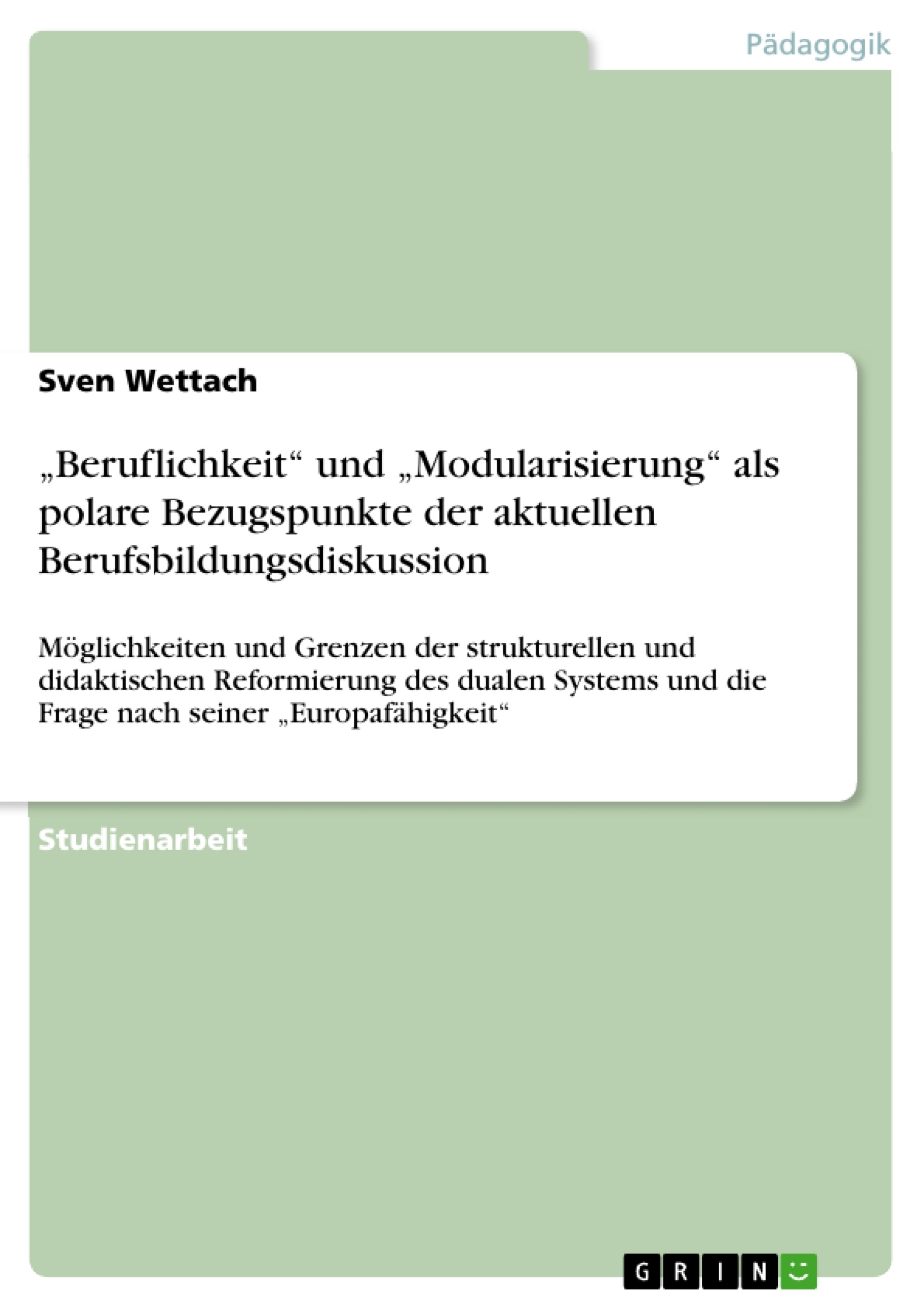Im Laufe des letzten Jahrzehnts geriet das deutsche Berufsbildungssystem mit seinem Herzstück, dem dualen System, gegenüber weniger beruflich sondern stärker schulisch orientierten Systemen ins Hintertreffen. Die Schere zwischen Lehrplänen und Anforderung der Wirtschaft ging immer weiter auseinander. Verantwortlich hierfür wird die mangelnde Anpassungsfähigkeit an die sich dynamisch veränderten Rahmenbedingungen gemacht. Alle beteiligten Institutionen sind sich im Grunde darüber einig, dass das duale System modernisiert werden muss. Wie nicht anders zu erwarten ist, bestehen aber hinsichtlich des „wie“ und der jeweiligen Folgen für die Beruflichkeit und das duale System Kontroversen.
Schließen sich Beruflichkeit und Modularisierung als unüberbrückbare Gegensätze gegenseitig aus und bedeutet Modularisierung zwangsläufig das Ende des deutschen dualen Systems und den qualitativen Niedergang der beruflichen Ausbildung? Erweist sich eine Modularisierung in Maßen, als innere Modernisierung, die die Sinnreferenz des Dualen Systems nicht zerstört, bei der der Beruf mehr als nur die Summe der erworbenen Kenntnisse bleibt, als Ausweg aus dem relativ statischen deutschen beruflichen Ausbildungssystem?
Inhaltsverzeichnis
- PROBLEMSTELLUNG
- MODULARISIERUNG
- WAS SIND MODULE ?
- Sequenzierungskonzept
- Differenzierungskonzept
- Supplementierungskonzept
- Fragmentierungskonzept
- ZIELE, VORTEILE UND GEFAHREN DER MODULARISIERUNG
- REFORMVORSCHLÄGE UND NEUORDNUNGEN
- AUSBILDUNGSOFFENSIVE 2003
- Die Bundesregierung
- Die Wirtschaftsverbände
- Die Gewerkschaften
- BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG [BIBB]
- DEUTSCHER INDUSTRIE – UND HANDELSKAMMERTAG [DIHK]
- NEUORDNUNG DER ELEKTROBERUFE
- EUROPA
- DÄNEMARK
- NIEDERLANDE
- ENGLAND
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der aktuellen Berufsbildungsdiskussion in Deutschland und untersucht die Frage, ob sich „Beruflichkeit“ und „Modularisierung“ als unvereinbare Gegensätze gegenüberstehen. Sie analysiert die unterschiedlichen Konzepte der Modularisierung im Kontext des dualen Systems, beleuchtet Reformvorschläge und Veränderungen in neuen Ausbildungsprofilen sowie Entwicklungen in anderen europäischen Ländern im Bereich der Berufsausbildung.
- Die Modernisierung des dualen Systems
- Die Auswirkungen der Modularisierung auf die Beruflichkeit
- Die Anpassungsfähigkeit des dualen Systems an den dynamischen Wandel der Arbeitswelt
- Reformvorschläge von verschiedenen Interessensgruppen
- Vergleichende Analyse von Berufsausbildungssystemen in europäischen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemstellung: Die Arbeit stellt die Herausforderungen des deutschen Berufsbildungssystems im Vergleich zu anderen Systemen dar und beleuchtet die Kontroversen um die Modernisierung des dualen Systems.
- Modularisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Modul“ und erläutert verschiedene Modularisierungskonzepte, die mit dem Beruflichkeitsprinzip vereinbar sind, sowie das Fragmentierungskonzept, das vom deutschen System abweicht.
- Reformvorschläge und Neuordnungen: Dieses Kapitel präsentiert Reformvorschläge von Bundesregierung, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, dem BiBB und dem DIHK sowie die Neuordnung der Elektroberufe.
- Europa: Dieses Kapitel beleuchtet die Berufsausbildungsmodelle in Dänemark, den Niederlanden und England.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Begriffe und Konzepte „Beruflichkeit“, „Modularisierung“, „duales System“, „Reform“, „Anpassungsfähigkeit“, „Globalisierung“, „lebenslanges Lernen“ und „Europäische Integration“ im Kontext der deutschen Berufsbildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Beruflichkeit“ im dualen System?
Beruflichkeit bezeichnet das Prinzip, dass eine Ausbildung nicht nur Einzelqualifikationen vermittelt, sondern zu einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf führt.
Was bedeutet „Modularisierung“ in der Berufsbildung?
Modularisierung ist die Aufteilung von Ausbildungsinhalten in kleinere, abgeschlossene Lerneinheiten (Module), um die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Systems zu erhöhen.
Sind Beruflichkeit und Modularisierung Gegensätze?
Die Diskussion dreht sich darum, ob Module die ganzheitliche Bildung zerstören (Fragmentierung) oder als „innere Modernisierung“ helfen können, das duale System aktuell zu halten.
Welche Modularisierungskonzepte gibt es?
Es wird zwischen Sequenzierungs-, Differenzierungs-, Supplementierungs- und Fragmentierungskonzepten unterschieden, die jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf das Berufsbild haben.
Warum steht das duale System unter Reformdruck?
Durch Globalisierung und dynamische Marktveränderungen klaffen Lehrpläne und Wirtschaftsanforderungen oft auseinander, was eine höhere Anpassungsfähigkeit des statischen deutschen Systems erfordert.
- Arbeit zitieren
- Sven Wettach (Autor:in), 2003, „Beruflichkeit“ und „Modularisierung“ als polare Bezugspunkte der aktuellen Berufsbildungsdiskussion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54236