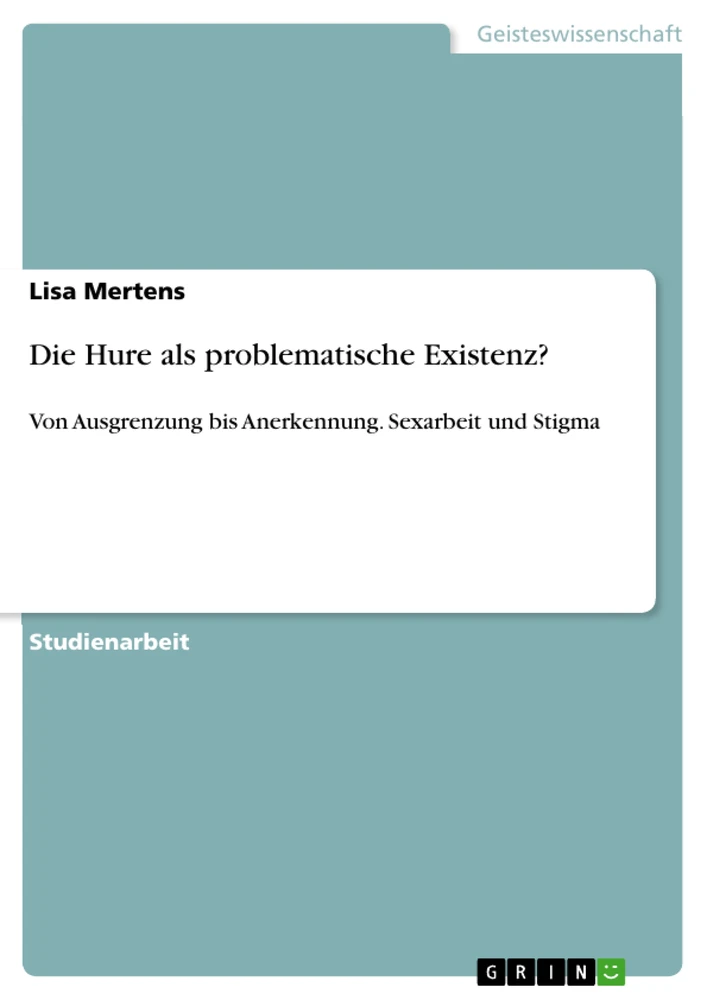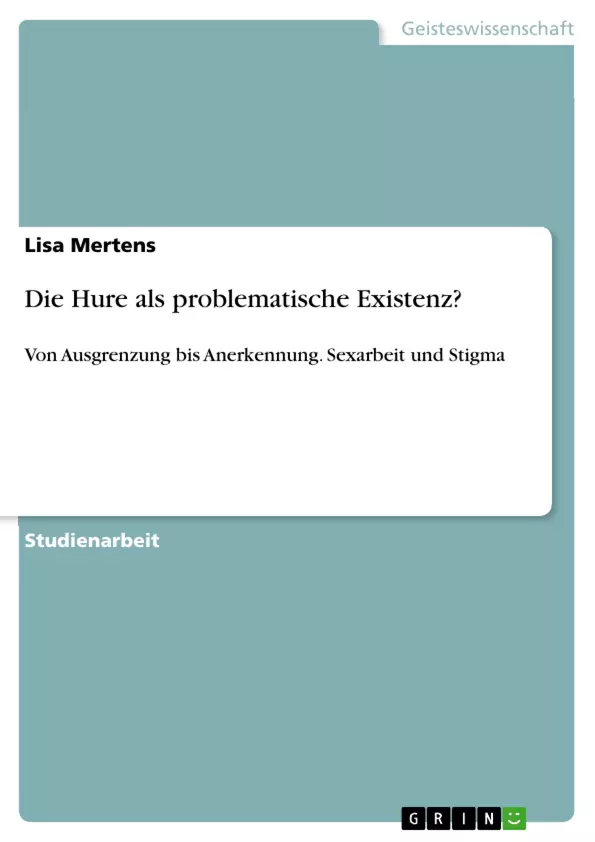Diese Arbeit versucht das Thema Prostitution unter Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekten zu beleuchten. Gesellschaftliche Stellung der Prostituierten, Stigmata und Gründe für den Einstieg werden behandelt. Des Weiteren wird die Sexarbeit unter beruflichen Gesichtspunkten beleuchtet und deren Berufsethos erläutert, um eine mögliche wirtschaftliche Unzulänglichkeit, welcher Prostituierten oft nachgesagt wird, zu widerlegen. Schlussendlich wird unter Berücksichtigung von nachgewiesenen Kompetenzen ausgewertet, ob Prostituierte eine problematische Existenz in dieser Gesellschaft darstellen oder nicht.
Mit der Einführung des Prostitutionsgesetzes am 01.01.2005 wurde die Erwerbstätigkeit im Bereich der Sexarbeit legalisiert und die Vereinbarungen zwischen Prostituierten und Freiern anderen rechtswirksamen Verträgen gleichgestellt. Vorher wurden Dienstleistungen dieser Art nicht als Arbeit anerkannt, obwohl das verdiente Geld durch die Einkommens- und Umsatzsteuer belastet wurde. Durch die Verbesserung der rechtlichen und sozialen Situation von Prostituierten in Deutschland ist es ihnen seither möglich als selbstständig arbeitende Personen unmittelbaren Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung und Sozialversicherung zu beantragen und in einem Angestelltenverhältnis einen Anspruch auf Arbeitslosen- und Rentenversicherung zu erheben.
Trotz immenser Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist Prostitution und vor allem die dort Tätigen von wenig differenzierten und pauschalen Annahmen betroffen. Obwohl die immer mehr zunehmende und durch die Medien zusätzlich propagierte Offenheit der Sexualität zu einer Enttabuisierung dieser Thematik geführt hat, ist und bleibt Sex und vor allem käuflicher Sex eine Problematik über die weder gesprochen noch öffentlich gelebt werden darf. Prostitution kollidiert somit mit den starren Werten und der traditionellen Moralvorstellungen der Gesellschaft. Ansammlungen von Vorurteilen bestimmen das Bild unzähliger und vielseitiger Erscheinungsformen der Sexarbeit, welche sich durch unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Praktiken, Lebensweisen und persönlicher Motivation der dort Tätigen markant unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ein sachlicher Blick auf die Prostitution
- 2.1 Demografische Anhaltspunkte
- 2.2 Wirtschaftsfaktor und weibliche Erwerbstätigkeit
- 3. Gesellschaftliche Stellung und Stigmata von Prostituierten
- 4. Sexarbeit als Beruf des tertiären Sektors
- 5. Berufsethos, berufliche Qualifikation und Kompetenzen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Wahrnehmung und die sozioökonomische Realität von weiblicher Prostitution in Deutschland. Sie hinterfragt die gängigen Vorurteile und Stigmata, die mit diesem Beruf verbunden sind, und beleuchtet die Sexarbeit unter beruflichen Aspekten. Die Zielsetzung ist es, ein differenziertes Bild der Situation von Prostituierten zu zeichnen und die Frage zu beantworten, ob ihre Existenz als problematisch einzustufen ist.
- Sozioökonomische Aspekte der Prostitution in Deutschland
- Gesellschaftliche Stigmatisierung und Vorurteile gegenüber Prostituierten
- Sexarbeit als Beruf im tertiären Sektor
- Berufsethos und Qualifikationen in der Sexarbeit
- Das traditionelle Frauenbild im Kontext von Prostitution
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der weiblichen Prostitution in Deutschland ein und skizziert den historischen Kontext der Legalisierung im Jahr 2005. Sie thematisiert die anhaltende Stigmatisierung trotz rechtlicher Veränderungen und kündigt den Fokus auf gesellschaftliche Rollenverständnisse der Frau und den Einfluss von Vorurteilen auf das Leben von Prostituierten an. Die Arbeit verspricht eine sachliche Betrachtung der Prostitution unter sozioökonomischen Aspekten, inklusive der Analyse der gesellschaftlichen Stellung, der Stigmata und der beruflichen Aspekte der Sexarbeit, um letztlich die Frage nach der „problematischen Existenz“ zu beantworten.
2. Ein sachlicher Blick auf die Prostitution: Dieses Kapitel untersucht die Schwierigkeiten, eine neutrale Definition von Prostitution zu finden, da der Begriff stark von gesellschaftlichen und rechtlichen Normen geprägt ist. Es werden verschiedene soziologische und feministische Perspektiven auf Prostitution vorgestellt, die den Begriff unterschiedlich interpretieren und die gesellschaftliche Rolle der Frau thematisieren. Der Kapitel schliesst mit dem Hinweis auf die Einbeziehung ökonomischer und demografischer Daten, um die Relevanz der Thematik aufzuzeigen und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Standpunkt von Prostituierten zu verdeutlichen.
2.1 Demografische Anhaltspunkte: Dieser Abschnitt präsentiert statistische Daten zur Anzahl weiblicher Prostituierter in Deutschland, die jedoch mit Unsicherheiten aufgrund von Dunkelziffern behaftet sind. Es wird die Diversität im Altersbereich, der Berufserfahrung und dem Bildungsniveau der Prostituierten hervorgehoben, die gängigen Klischees entgegenwirken.
2.2 Wirtschaftsfaktor und weibliche Erwerbstätigkeit: Dieser Teil beleuchtet die wirtschaftliche Bedeutung der Prostitution in Deutschland und schätzt den jährlichen Umsatz. Es wird der Zusammenhang zwischen der steigenden Nachfrage, der Enttabuisierung von Sexualität und der Globalisierung erörtert. Der Abschnitt verweist auf die Einbettung der Sexbranche in die allgemeine Wirtschaft und diskutiert die Parallelen zwischen sexuellen Abhängigkeitsverhältnissen in der Sexarbeit und anderen Arbeitsbereichen.
Schlüsselwörter
Prostitution, Sexarbeit, Stigma, Vorurteile, Frauenbild, Sozioökonomie, Tertiärer Sektor, Beruf, Legalisierung, Gesellschaftliche Wahrnehmung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sozioökonomische Aspekte weiblicher Prostitution in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Wahrnehmung und sozioökonomische Realität weiblicher Prostitution in Deutschland. Sie hinterfragt gängige Vorurteile und Stigmata, beleuchtet Sexarbeit unter beruflichen Aspekten und zielt darauf ab, ein differenziertes Bild der Situation von Prostituierten zu zeichnen und die Frage nach ihrer „problematischen Existenz“ zu beantworten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sozioökonomische Aspekte der Prostitution, gesellschaftliche Stigmatisierung und Vorurteile, Sexarbeit als Beruf im tertiären Sektor, Berufsethos und Qualifikationen in der Sexarbeit sowie das traditionelle Frauenbild im Kontext von Prostitution. Sie umfasst eine Einleitung, Kapitel zu einem sachlichen Blick auf die Prostitution (inklusive demografischer Anhaltspunkte und des Wirtschaftsfaktors), die gesellschaftliche Stellung und Stigmata von Prostituierten, Sexarbeit als Beruf des tertiären Sektors, Berufsethos, berufliche Qualifikation und Kompetenzen sowie eine Zusammenfassung.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Analyse bestehender soziologischer und feministischer Perspektiven auf Prostitution, ökonomische und demografische Daten (wobei die Grenzen aufgrund von Dunkelziffern beachtet werden) sowie eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Rollenverständnissen und Vorurteilen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Text nicht explizit vorweggenommen, aber die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes Bild der Situation von Prostituierten zu liefern und die Frage nach ihrer „problematischen Existenz“ auf Basis der gesammelten Daten und Perspektiven zu beantworten.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum sachlichen Blick auf die Prostitution (mit Unterkapiteln zu demografischen Anhaltspunkten und dem Wirtschaftsfaktor), ein Kapitel zur gesellschaftlichen Stellung und Stigmata, ein Kapitel zu Sexarbeit als Beruf im tertiären Sektor, ein Kapitel zu Berufsethos und Qualifikationen und abschließend eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prostitution, Sexarbeit, Stigma, Vorurteile, Frauenbild, Sozioökonomie, Tertiärer Sektor, Beruf, Legalisierung, Gesellschaftliche Wahrnehmung, Deutschland.
Wie wird die Legalisierung der Prostitution in Deutschland behandelt?
Die Legalisierung von 2005 wird in der Einleitung erwähnt und bildet einen Kontext für die anhaltende Stigmatisierung und die Untersuchung der gesellschaftlichen Rollenverständnisse von Frauen im Zusammenhang mit Prostitution.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet statistische Daten zur Anzahl weiblicher Prostituierter in Deutschland, wobei die Unsicherheit aufgrund von Dunkelziffern hervorgehoben wird. Es werden auch Daten zur wirtschaftlichen Bedeutung der Prostitution und zum Zusammenhang mit Nachfrage, Enttabuisierung und Globalisierung verwendet.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Die Arbeit berücksichtigt verschiedene soziologische und feministische Perspektiven auf Prostitution, um ein vielschichtiges Verständnis zu ermöglichen. Sie versucht, einen sachlichen Blick auf die Thematik einzunehmen und gängige Klischees zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Lisa Mertens (Autor:in), 2014, Die Hure als problematische Existenz?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542671