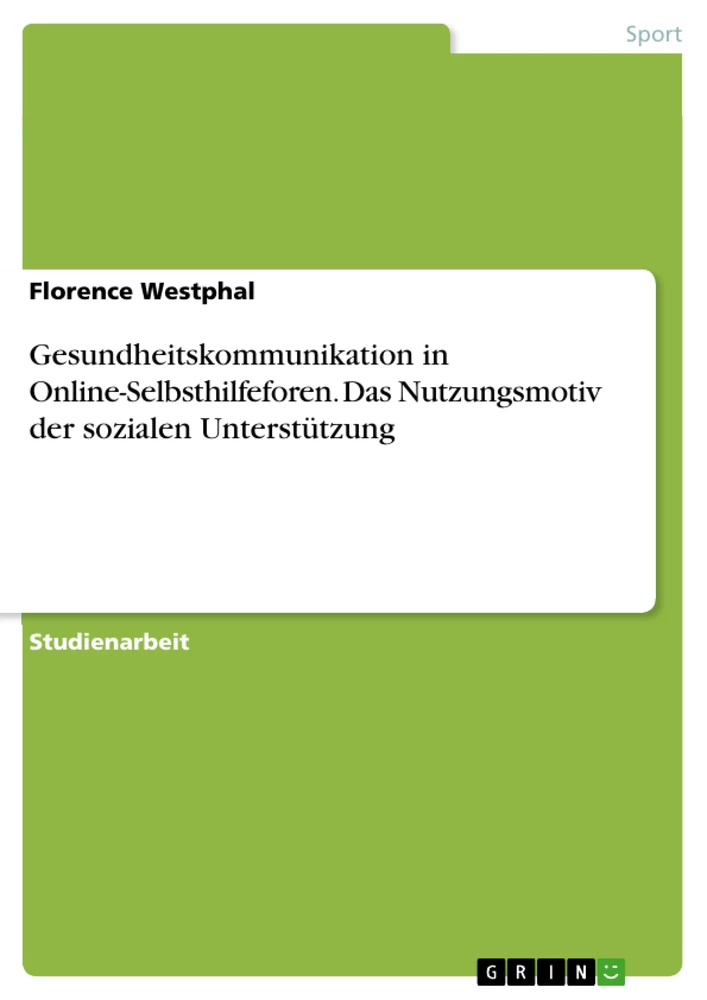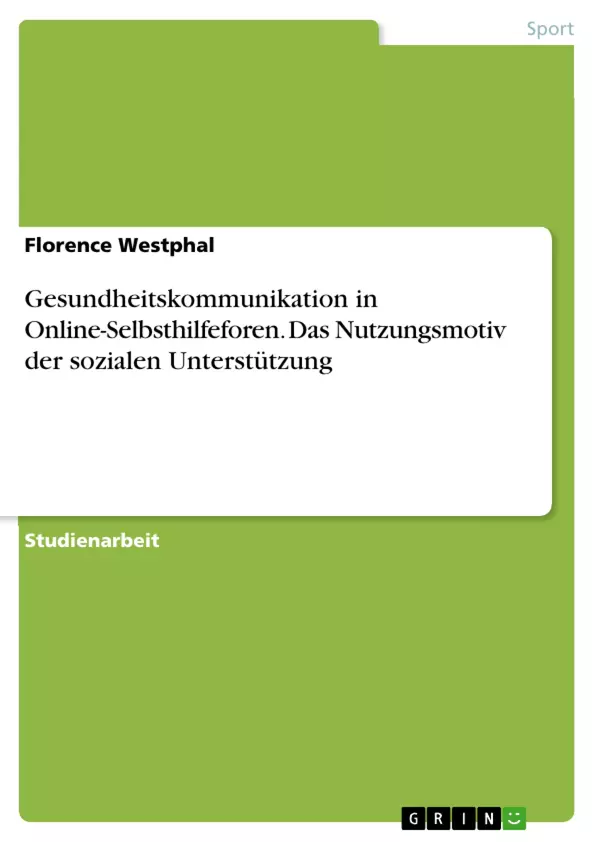In dieser Hausarbeit befasst sich der Autor mit der digitalen Gesundheitskommunikation auf online Selbsthilfeforen. Hierbei werden die Nutzungsmotive dieser Selbsthilfeforen genauer beleuchtet, zu welchen die soziale Unterstützung sowie die Stressbewältigung zählen. Im Zuge dessen ergibt sich die folgende Forschungsfrage: "Inwiefern stellen online gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen eine soziale Unterstützung für die Forennutzenden dar und helfen bei der Stress- und Krankheitsbewältigung?"
Auf Basis dieser Forschungsfrage ist das Ziel dieser Arbeit, die zentrale Rolle der online basierenden Selbsthilfeforen für die Gesundheitskommunikation herauszuarbeiten und dabei das Nutzungsmotiv der sozialen Unterstützung genauer zu beleuchten. In Verbindung damit soll zunächst eine kurze Einführung in das Forschungsfeld der Gesundheitskommunikation erfolgen, woran anknüpfend im Detail die Besonderheit der Foren mit deren Akteursgruppen und Foreninhalte sowie Nutzungsmotive analysiert werden. Im Anschluss folgt eine kurze Diskussion hinsichtlich der positiven sowie negativen Effekte der Hilfsforen.
Die Relevanz dieser Arbeit zeigt sich auf zwei Ebenen. Zum einen stellt die Social-Media-Forschung einen schwer übersichtlichen sowie dynamisch und ständig erneuernden Bereich dar. Demnach steht die Forschung in Verbindung mit der gesundheitsbezogenen Kommunikation vor der stetigen Herausforderungen mit dem ständigen Wandel der online Kommunikationsprozesse mitzuhalten, wodurch jeder neue Beitrag hilfreich sein kann. Zum anderen sind einige Forschungen zu online Hilfsforen im Forschungsbereich der Gesundheitskommunikation zu finden, jedoch fokussieren sich diese meist nur auf einzelne Krankheitsforen (z.B. Depressionsforen oder Krebsforen). Zusätzlich sind diese Forschungen meist sehr fokussiert und beziehen sich nur auf einzelne Teilaspekte der sozialen Unterstützung und Situationsbewältigung. Demnach soll diese Arbeit einen umfassenden Überblick über alle online Selbsthilfeforen im Gesundheitsbereich geben und auf mögliche fehlende Forschungsbereiche hinweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesundheitskommunikation
- Mediale Gesundheitskommunikation
- Gesundheitskommunikation im Internet
- Social Media, Social Networks und mHealth
- Online gesundheitsbezogene Selbsthilfeforen
- Charakteristika gesundheitsbezogener online Selbsthilfeforen
- Themenfelder der online Selbsthilfeforen
- Nutzungsmotive
- Soziale Unterstützung
- Krankheits- und Stressbewältigung
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Relevanz von online gesundheitsbezogenen Selbsthilfeforen im Kontext der Gesundheitskommunikation. Sie untersucht, inwiefern diese Foren soziale Unterstützung für ihre Nutzer bieten und bei der Bewältigung von Stress und Krankheiten helfen. Dabei stehen die Nutzungsmotive der sozialen Unterstützung und die Analyse der Besonderheiten der Foren im Vordergrund.
- Die Rolle von online Selbsthilfeforen in der Gesundheitskommunikation
- Soziale Unterstützung als Nutzungsmotiv
- Die Nutzung von Selbsthilfeforen zur Stress- und Krankheitsbewältigung
- Die Bedeutung der digitalen Medien in der Gesundheitskommunikation
- Die Herausforderungen und Chancen der Gesundheitskommunikation im Internet
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung von digitalen Medien in der Gesundheitskommunikation und die Rolle von online Selbsthilfeforen als Unterstützung für Menschen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen.
Gesundheitskommunikation: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Gesundheitskommunikation und betrachtet die Rolle von Medien in diesem Bereich. Es beleuchtet die Bedeutung des Internets und von Social Media Plattformen für die Gesundheitskommunikation.
Online gesundheitsbezogene Selbsthilfeforen: Dieses Kapitel analysiert die Charakteristika, Themenfelder und Nutzungsmotive von online Selbsthilfeforen im Gesundheitsbereich. Es beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten, wie diese Foren soziale Unterstützung und Hilfestellung für Nutzer bieten.
Diskussion: Dieses Kapitel beleuchtet die positiven und negativen Effekte von online Selbsthilfeforen und diskutiert die Bedeutung dieser Foren im Kontext der Gesundheitskommunikation.
Schlüsselwörter
Online Selbsthilfeforen, Gesundheitskommunikation, Soziale Unterstützung, Stressbewältigung, Krankheitsbewältigung, Digitale Medien, Social Media, mHealth, Patient_innen, Gesundheitsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmotive für die Nutzung von Online-Selbsthilfeforen?
Zentrale Nutzungsmotive sind die Suche nach sozialer Unterstützung sowie die Unterstützung bei der Krankheits- und Stressbewältigung.
Helfen Online-Foren tatsächlich bei der Krankheitsbewältigung?
Die Arbeit untersucht, inwiefern der Austausch mit Gleichgesinnten in Foren als Ressource zur Situationsbewältigung und emotionalen Entlastung dient.
Gibt es auch negative Effekte bei der Nutzung von Hilfsforen?
Ja, die Arbeit diskutiert sowohl positive als auch negative Aspekte, wie etwa die Gefahr von Fehlinformationen oder eine übermäßige emotionale Belastung.
Was unterscheidet diese Arbeit von bisherigen Forschungen zu Selbsthilfeforen?
Während sich viele Studien auf spezifische Krankheiten (z.B. Krebs) fokussieren, bietet diese Arbeit einen umfassenden Überblick über verschiedene online Selbsthilfeforen im Gesundheitsbereich.
Welche Rolle spielt mHealth in der modernen Gesundheitskommunikation?
Mobile Health (mHealth) und Social Media sind Teil des dynamischen Wandels der Gesundheitskommunikation, der in der Einleitung der Arbeit beleuchtet wird.
Wer sind die Hauptakteure in gesundheitsbezogenen Foren?
Die Akteursgruppen bestehen primär aus Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen, die Informationen und emotionale Unterstützung suchen.
- Citation du texte
- Florence Westphal (Auteur), 2018, Gesundheitskommunikation in Online-Selbsthilfeforen. Das Nutzungsmotiv der sozialen Unterstützung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542874