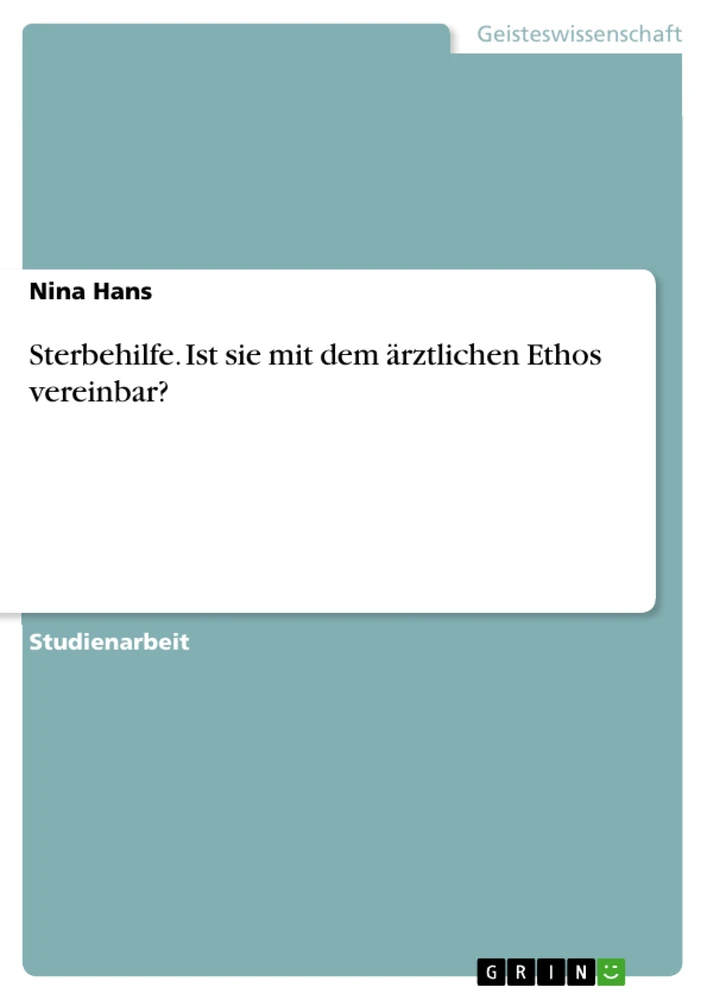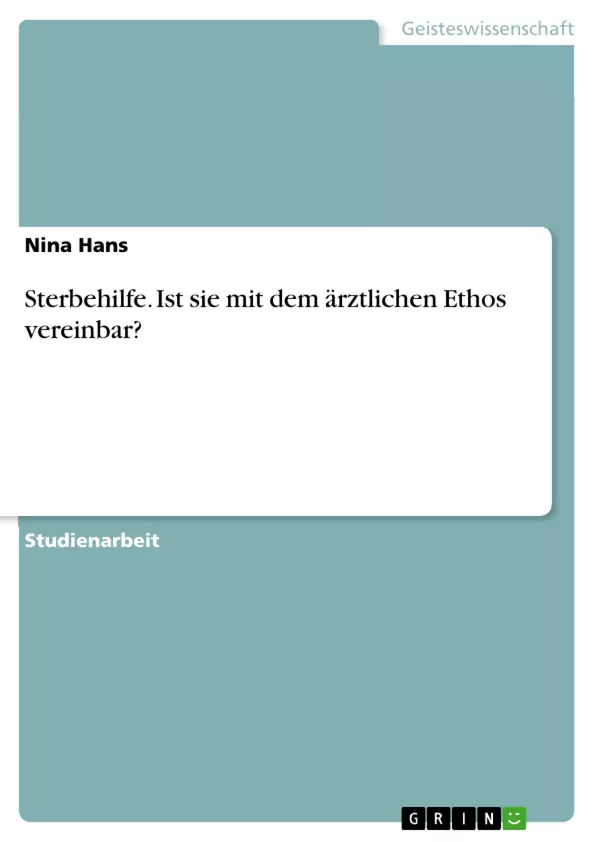Die US-amerikanische Patientin Brittany Maynard fasste im Alter von 29 Jahren den Beschluss, im Jahr 2014 mit Hilfe des assistierten Suizids ihr Leben zu beenden. Ihre Patientengeschichte ist nur ein Beispiel von vielen Fällen, die im Zusammenhang mit der Thematik der Sterbehilfe stehen. Die Geschichte verdeutlicht, dass die Relevanz der Sterbehilfe für die Gesellschaft weltweit stetig steigt. Durch die Medien werden solche Fälle an viele Menschen auf der ganzen Welt herangetragen. Menschen finden Gefallen daran und so kommt es, dass viele heutzutage das Ziel eines selbstbestimmten Sterbens verfolgen. Dies kann durch die Angst vor Schmerz und Leid oder der Befürchtung von Einsamkeit hervorgerufen werden. Daher sehen schwerkranke Menschen – vor allem im hohen Alter – oftmals keinen anderen Ausweg als zu sterben. Diesen Menschen stellt sich ein selbstbestimmtes Sterben, welches die soeben aufgeführten Sorgen umgehen kann, als angenehm dar. Dies kann beispielsweise durch das Instrument der Patientenverfügung möglich gemacht werden.
Der Tod und das Sterben sind allerdings keineswegs einfache Themen, weshalb diese auch mit Konflikten verknüpft sind. Die Frage nach Sterbehilfe gewinnt, aufgrund der Aktualität, vor allem auch für Ärzte immer mehr an Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist mit Sterbehilfe jedoch nicht Sterbebegleitung gemeint, sondern eine Handlung, die die Lebensdauer verkürzen kann. Je nachdem, wie dieser medizinische Einfluss ausfällt, kommt es zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen von Sterbehilfe. Die oben erwähnte Form des assistierten Suizids stellt nur eine Variante von vieren dar. Diese werden in der Öffentlichkeit mehr oder weniger diskutiert und kritisiert. Dabei kommt häufig die Frage auf, ob diese überhaupt mit dem ärztlichen Ethos vereinbar sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Formen der Sterbehilfe und ethische Bewertung..
- Sterbenlassen (passive Sterbehilfe).
- Definition
- Kriterien
- Argumente dafür
- Argumente dagegen
- Tötung auf Verlangen (aktive Sterbehilfe).
- Definition
- Kriterien
- Argumente dafür
- Argumente dagegen
- Therapie am Lebensende (indirekte Sterbehilfe).
- Definition
- Kriterien
- Argumente dafür
- Argumente dagegen
- Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid)
- Definition
- Kriterien
- Argumente dafür
- Argumente dagegen
- Sterbenlassen (passive Sterbehilfe).
- Ethische Überlegungen zur Patientenverfügung.
- Ärztliches Ethos
- Vereinbarkeit mit der Sterbehilfe
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Sterbehilfe und deren Vereinbarkeit mit dem ärztlichen Ethos. Sie untersucht die verschiedenen Formen der Sterbehilfe und die ethischen Argumente für und gegen diese.
- Definition und Abgrenzung der verschiedenen Formen der Sterbehilfe
- Ethische Bewertung der Sterbehilfe
- Die Rolle der Patientenverfügung
- Die Entwicklung des ärztlichen Ethos
- Die Vereinbarkeit von Sterbehilfe mit dem ärztlichen Ethos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den Fall von Brittany Maynard, der die Relevanz der Sterbehilfe-Thematik für die Gesellschaft verdeutlicht. Die Arbeit erörtert die verschiedenen Formen der Sterbehilfe, darunter Sterbenlassen, Tötung auf Verlangen, Therapie am Lebensende und Beihilfe zur Selbsttötung. Für jede Form werden Definitionen, Kriterien und Argumente für und wider dargestellt. Das Kapitel über die Patientenverfügung beschäftigt sich mit der Entwicklung des ärztlichen Ethos und beleuchtet, ob und wie Sterbehilfe mit dem ärztlichen Ethos vereinbar ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sterbehilfe, ärztliches Ethos, Patientenverfügung, Selbstbestimmung, Lebensende, Palliativmedizin, Tod und Sterben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
Passive Sterbehilfe bedeutet das Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen (Sterbenlassen), während aktive Sterbehilfe die gezielte Tötung auf Verlangen bezeichnet.
Ist der assistierte Suizid mit dem ärztlichen Ethos vereinbar?
Dies ist eine zentrale Streitfrage. Die Arbeit untersucht, ob die Hilfe zur Selbsttötung dem Heilauftrag des Arztes widerspricht oder ein Ausdruck von Patientenautonomie ist.
Welche Rolle spielt die Patientenverfügung?
Sie ermöglicht es Menschen, im Voraus festzulegen, welche medizinischen Maßnahmen sie am Lebensende wünschen oder ablehnen, um ein selbstbestimmtes Sterben zu sichern.
Was versteht man unter indirekter Sterbehilfe?
Hierbei werden Medikamente zur Schmerzlinderung eingesetzt, die als Nebenwirkung die Lebensdauer verkürzen können (Therapie am Lebensende).
Warum nimmt die Relevanz der Sterbehilfe weltweit zu?
Durch den demografischen Wandel und die moderne Medizin rücken Fragen nach Leidvermeidung, Einsamkeit im Alter und dem Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Tod stärker in den Fokus.
- Quote paper
- Nina Hans (Author), 2019, Sterbehilfe. Ist sie mit dem ärztlichen Ethos vereinbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/544361