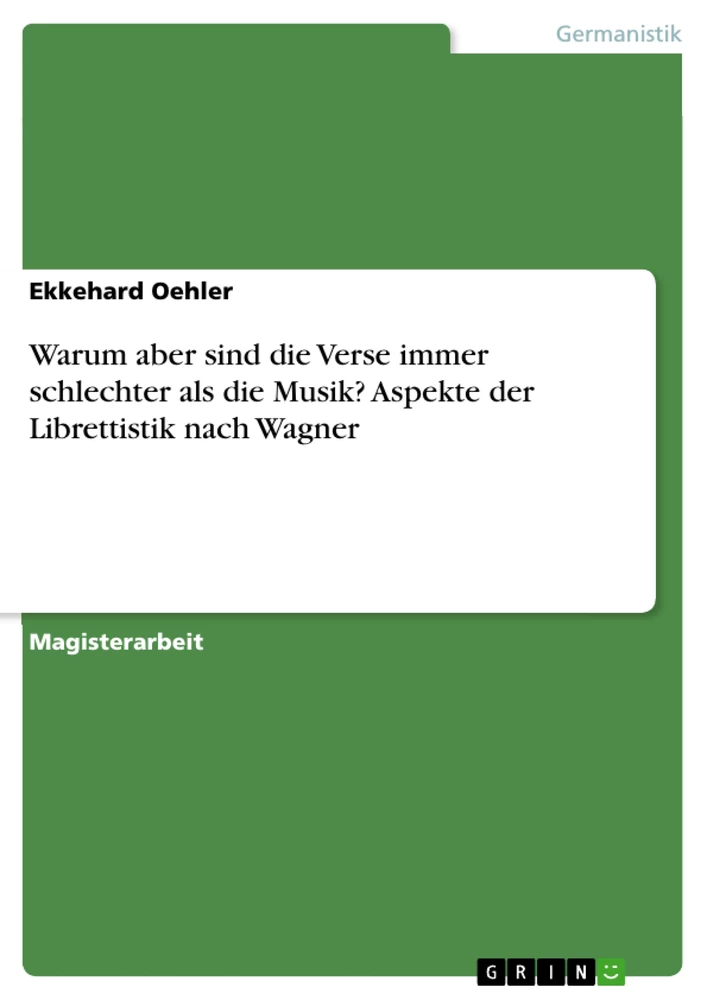„Warum aber sind die Verse immer schlechter als die Musik?“ fragt sich der Schauspieler Clairon in Richard Strauss’ letzter Oper Capriccio, einem Werk, in dem der sich Strauss am Ende seines Lebens noch einmal mit Grundfragen der Operndichtung auseinandersetzt. Clairons Frage steht vor dem Hintergrund der Erkenntnis, daß das Finden und Verarbeiten eines geeigneten Stoffes für die Opernbühne von jeher mit vielfältigen Problemen verbunden war. Ein sehr spezielles Problem stellte sich deutschen Komponisten und Textdichtern im letzten Drittel des neunzehnten und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Dieses Problem bestand in der Dominanz und der Wirkungsmächtigkeit der Musikdramen Richard Wagners, die alle anderen Opern dieser Zeit zu verdrängen drohten.
Die in dieser Arbeit zu untersuchende These lautet daher: Nach Wagner war es nicht möglich, unbefangen Operntexte zu schreiben und zu komponieren, weshalb über einen Zeitraum von nahezu 40 Jahren alle ernstzunehmenden Opern der Zeit nach etwa 1878 sich durch das Bemühen auszeichnen, die wagnersche Stoffwahl und Diktion zu vermeiden. Zwar wurden Wagners Innovationen auf musikalischem Gebiet stark beachtet und von allen namhaften Komponisten auf die eine oder andere Art im eigenen Werk aufgegriffen, was aber die Textbücher angeht, bestand eine große Scheu vor der direkten Nachahmung, auch aufgrund von Wagners neuartigen Qualitätsansprüchen. Bislang haben jedoch die Operntexte dieser Phase lediglich im Hinblick auf ihre Epigonalität Beachtung gefunden; das Vermeiden der Konkurrenzsituation mit Wagner ohne einen Rückschritt zu machen, wurde als künstlerische Eigenleistung, die den Werken einen Eigenwert verleiht, nicht anerkannt.
Anhand einiger exemplarischer Opernlibretti werden verschiedene Vermeidungsstrategien und Aneignungsformen aufzuzeigen sein. Außerdem wird der Versuch von Richard Strauss zu betrachten sein, zur Lösung des Problems einen neuen Weg einzuschlagen, der die Literaturoper begründete und neue Maßstäbe der Zusammenarbeit zwischen Librettist und Komponist setzte.
Vor der Betrachtung einzelner repräsentativer Werke des Zirkumpolaren Kreises wird jedoch zunächst ein kurzer, grundlegender Blick auf die Textform Libretto aus literaturwissenschaftlicher Sicht zu werfen sein, um die Veränderung der Textform durch Wagner nachvollziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Libretto als literarische Gattung
- Geschichte und Struktur des Librettos
- Zur Beschäftigung mit Libretti
- Zur Editionslage und Zitierweise
- Die Reformen Richard Wagners
- Die frühen Werke
- Das Konzept des Musikdramas und seine Umsetzung
- Stoffwahl im Schatten Wagners
- Komödienstoffe
- Hugo Wolf: Der Corregidor
- Sonstige Komödien
- Märchen und Verwandtes
- Engelbert Humperdincks Märchenopern
- Andere Märchenvertonungen
- Volkstümliche Opern
- Verismo
- Exkurs: Der italienische Verismo
- Eugen d'Albert: Tiefland und Die toten Augen
- Max von Schillings: Mona Lisa
- Erich Wolfgang Korngold: Violanta
- Eine Literaturvertonung: Notre Dame von Franz Schmidt
- Hans Pfitzners Musikdrama
- Der arme Heinrich
- Palestrina und die musikalische Einfallsästhetik
- Richard Strauss
- Die Frühwerke
- Salome. Die Geburt der Literaturoper
- Elektra. Die Begegnung mit Hofmannsthal
- Komödienstoffe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Reformen Richard Wagners auf die Librettistik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Analyse fokussiert auf die Reaktionen deutscher Komponisten und Librettisten auf Wagners Dominanz und die Herausforderungen, die sich aus der Notwendigkeit ergaben, eigene, innovative Operntexte zu schaffen, ohne Wagners Werk zu imitieren.
- Die Reaktion auf Wagners Musikdramen
- Die Suche nach neuen Stoffen und Themen
- Die Entwicklung neuer Operngenres
- Die Bedeutung von „Circumpolaren“ Opern
- Der Einfluss Wagners auf die Librettisten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik der Operndichtung im Schatten Wagners, indem sie Clairons Frage aus Richard Strauss' „Capriccio“ zitiert. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten, denen sich deutsche Komponisten und Librettisten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aufgrund der dominanten Wirkung von Wagners Musikdramen gegenüber sahen.
- Das Libretto als literarische Gattung: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte und Struktur des Librettos sowie die Herausforderungen, die mit seiner Erstellung verbunden sind. Es geht auf die Bedeutung von Libretti in der Operngeschichte und die Schwierigkeit, neue, originelle Texte zu schaffen ein.
- Die Reformen Richard Wagners: Hier werden die wichtigsten Reformen Wagners im Bereich der Operndichtung behandelt. Es werden die frühen Werke Wagners und die Entwicklung des Musikdramas im Detail analysiert.
- Stoffwahl im Schatten Wagners: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die verschiedenen Wege, die deutsche Komponisten und Librettisten im Schatten Wagners einschlugen, um neue Operntexte zu schaffen. Es werden verschiedene Stoffgebiete wie Komödien, Märchen, volkstümliche Opern und Verismo-Opern betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Operndichtung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und befasst sich mit Themen wie Wagner's Einfluss auf die Librettistik, die Entwicklung neuer Operngenres, Circumpolare Opern, Stoffwahl, Textgestaltung und die Reaktion auf Wagners Musikdramen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Problem hatten Librettisten nach Richard Wagner?
Wagners Musikdramen waren so dominant, dass es für nachfolgende Dichter schwer war, unbefangen Operntexte zu schreiben, ohne in eine direkte Konkurrenz oder Nachahmung zu geraten.
Was ist eine „Literaturoper“?
Eine Literaturoper ist eine Oper, deren Libretto direkt auf einem bereits existierenden literarischen Werk basiert, wie etwa Strauss' „Salome“.
Welche Vermeidungsstrategien nutzten Komponisten nach Wagner?
Man wich auf andere Stoffe aus, wie Komödien (Hugo Wolf), Märchenopern (Humperdinck) oder den Verismo, um Wagners mythischer Stoffwahl zu entgehen.
Welche Rolle spielt Richard Strauss in dieser Entwicklung?
Strauss schlug mit der Literaturoper einen neuen Weg ein und setzte neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit zwischen Librettist (z. B. Hofmannsthal) und Komponist.
Warum wurden Operntexte nach 1878 oft als epigonal bezeichnet?
Bisherige Forschungen sahen in ihnen oft nur schwache Nachahmungen Wagners, statt die bewusste Vermeidung der Konkurrenz als eigene künstlerische Leistung anzuerkennen.
- Quote paper
- Ekkehard Oehler (Author), 2005, Warum aber sind die Verse immer schlechter als die Musik? Aspekte der Librettistik nach Wagner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54599