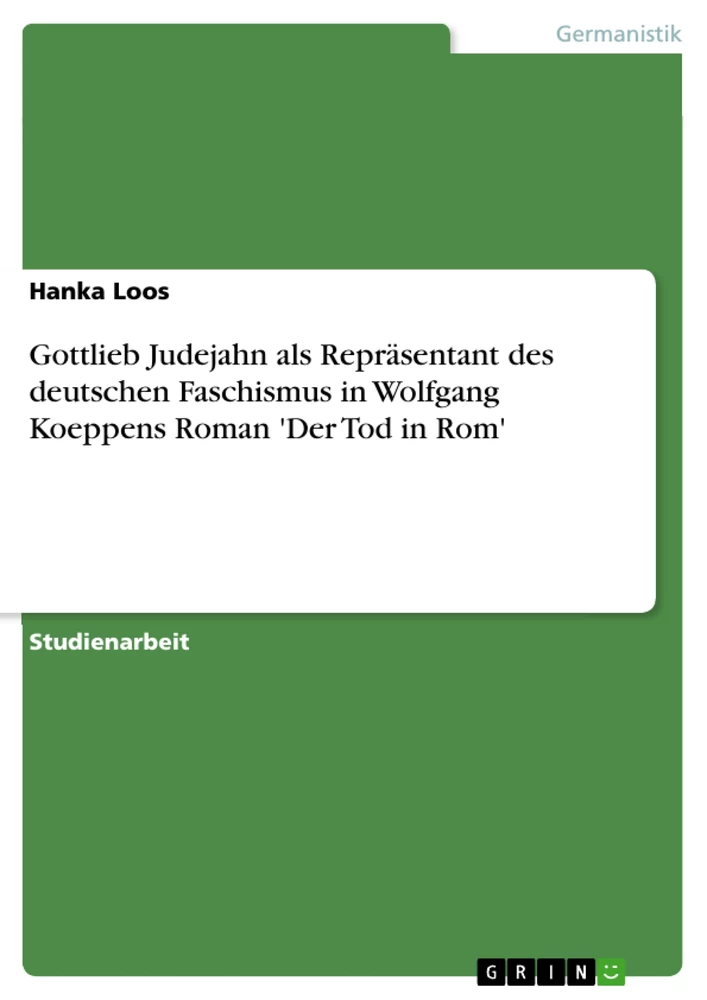Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, auf welche Weise die Figur des Gottlieb Judejahn in Koeppens Roman "Der Tod in Rom" als Repräsentant des deutschen Faschismus erscheint, wobei sowohl auf psychoanalytische Kategorien als auch auf Adornos Konzept des 'autoritären Charakters' zurückgegriffen wird. Zunächst werden diejenigen Passagen untersucht, die Judejahns Kindheitserfahrungen innerhalb einer autoritären Familienstruktur thematisieren. Die autoritäre Erziehung erscheint hier als Ursache seiner Ichschwäche, die er durch Aggressivität und Machtausübung zu kompensieren versucht. Anschließend wird Judejahns Verhältnis zur Macht analysiert, wobei das Militärische, das Sexualverhalten und die Bedienung niederer Instinkte im Vordergrund stehen. Hier erweist sich die Figur Judejahn als musterhaftes Beispiel eines autoritären Charakters. Abschließend wird die Bedeutung von Judejahns Tod untersucht, wobei festgestellt wird, dass ihm im Sterben Merkmale des Teuflischen zugewiesen werden. Es lässt sich also abschließend feststellen, dass die Figur Judejahn nicht als realistisch gestaltetes Individuum konzipiert ist, sondern vielmehr als Typus, als Inkarnation der nationalsozialistischen Ideologie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Judejahn als kleiner Gottlieb
- Autoritäre Erziehung
- Ödipus-Komplex
- Angst und Minderwertigkeitskomplex
- Judejahns Verhältnis zur Macht
- Existenz im Militärischen
- Uniform
- Kaserne
- Kommunikation
- Autoritätsdenken
- Das Töten
- Sexualverhalten
- Eva
- Laura
- Ilse Kürenberg
- Bedienung niederer Instinkte
- Existenz im Militärischen
- Judejahns Tod
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Figur des Gottlieb Judejahn im Roman „Der Tod in Rom“ von Wolfgang Koeppen und untersucht, wie er als Repräsentant des deutschen Faschismus dargestellt wird.
- Die prägende Kindheit und Erziehung Judejahns, die seine Unsicherheit und Hilflosigkeit bis ins Erwachsenenalter beeinflussen.
- Judejahns Verhältnis zur Macht und seine Abhängigkeit von Autorität, insbesondere im militärischen Kontext.
- Judejahns Sexualverhalten und seine aggressiven Machtpraktiken im Kontext antisemitischer Ideologie.
- Judejahns Perversität und Morbidität in Bezug auf die Befriedigung niederer Instinkte.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Fragestellung der Arbeit dar und skizziert die wichtigsten Themenbereiche.
Das Kapitel „Judejahn als kleiner Gottlieb“ analysiert Judejahns Kindheit und Erziehung und zeigt auf, wie diese seine spätere Persönlichkeit prägten. Es werden die Aspekte der autoritären Erziehung, des Ödipus-Komplexes und der daraus resultierenden Angst und Minderwertigkeitskomplexe beleuchtet.
Das Kapitel „Judejahns Verhältnis zur Macht“ untersucht Judejahns Existenz im militärischen Kontext. Es werden Themen wie Uniform, Kaserne, Kommunikation, Autoritätsdenken und das Töten behandelt. Darüber hinaus wird Judejahns Sexualverhalten im Kontext aggressiver Machtpraktiken und antisemitischer Ideologie beleuchtet.
Das Kapitel „Bedienung niederer Instinkte“ befasst sich mit Judejahns Perversität und Morbidität und zeigt auf, wie er niedere Instinkte bedient.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie autoritärer Erziehung, Ödipus-Komplex, Angst, Minderwertigkeitskomplexe, Faschismus, Macht, Militär, Sexualität, Perversität, Morbidität und Antisemitismus. Weitere wichtige Begriffe sind „kleiner Gottlieb“, „Führerprinzip“, „Über-Ich“ und „Triebversagung“.
- Quote paper
- Hanka Loos (Author), 2002, Gottlieb Judejahn als Repräsentant des deutschen Faschismus in Wolfgang Koeppens Roman 'Der Tod in Rom', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54616