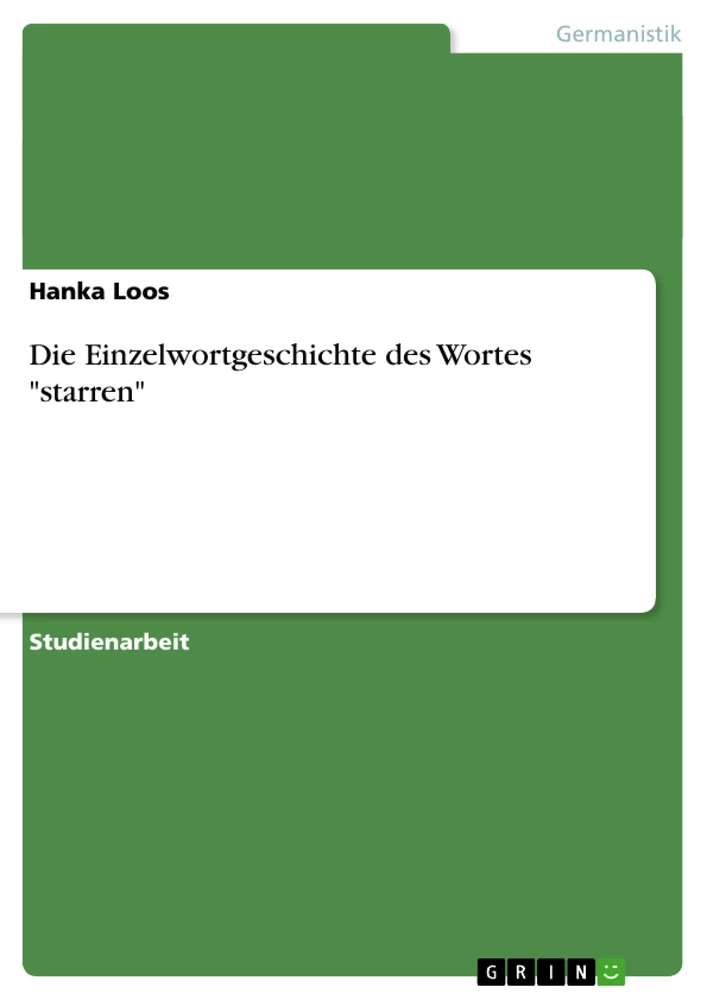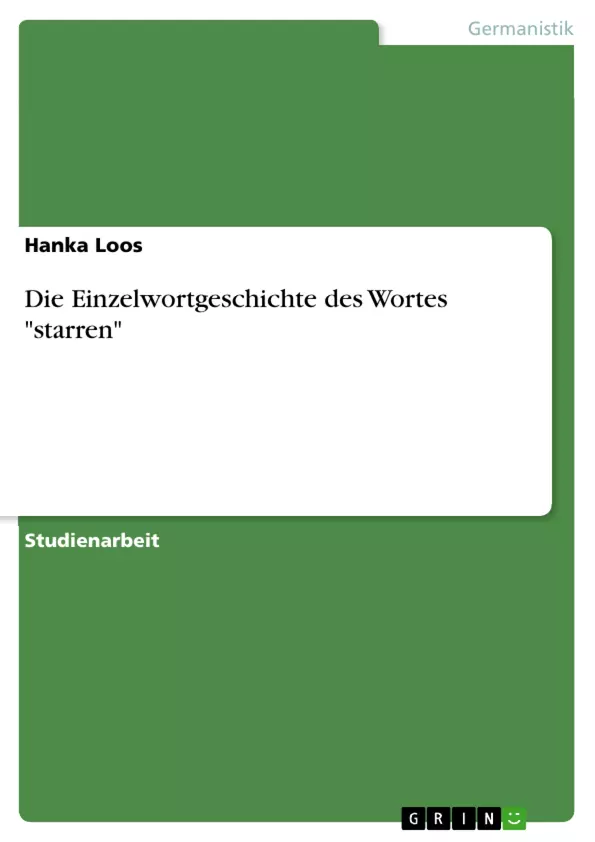Die Arbeit hat das Ziel, eine lexikologische und lexikographische Wortgeschichte des Verbs starren zu erstellen und dabei die entsprechenden Darstellungen in verschiedenen etymologischen Wörterbüchern kritisch zu bewerten. Zunächst wird die Etymologie des Wortes untersucht, um anschließend den Bedeutungswandel im Verlauf der deutschen Sprachperioden zu analysieren. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass starren aus dem Zusammenfall zweier althochdeutscher Verben hervorgegangen ist und mit dem Frühneuhochdeutschen eine Erweiterung durch die Bedeutung 'strotzen, voll von etwas bedeckt sein' erfahren hat. Die untersuchten Wörterbücher weichen in ihrer Darstellung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht stark voneinander ab, was vor allem auf deren unterschiedliche Zielsetzungen zurückzuführen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Etymologie
- Bedeutungen und ihr Wandel
- Althochdeutsch
- Mittelhochdeutsch
- Frühneuhochdeutsch
- Neuhochdeutsch
- Gesamtbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt die Erstellung einer lexikologischen und lexikographischen Einzelwortgeschichte des Verbs „starren“. Die Arbeit untersucht die sprachhistorische Entwicklung des Wortes, seine Verbindungen zu anderen germanischen und indogermanischen Sprachen und den daraus resultierenden Bedeutungsänderungen. Die Analyse umfasst die phonologischen und semantischen Merkmale des Wortes in verschiedenen Sprachperioden (Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch), unter Berücksichtigung der Eintragungen in zeitgenössischen Wörterbüchern und deren Übereinstimmungen bzw. Abweichungen.
- Etymologische Entwicklung des Verbs „starren“
- Bedeutungswandel von „starren“ über verschiedene Sprachperioden
- Vergleichende Analyse von Wörterbucheinträgen zu „starren“
- Indogermanische und germanische Verwandtschaftsbeziehungen
- Zusammenhang zwischen Phonologie und Semantik von „starren“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: eine umfassende lexikologische und lexikographische Einzelwortgeschichte des Verbs „starren“ zu erstellen. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung der Etymologie, der semantischen Entwicklung in verschiedenen Sprachstufen und den Vergleich verschiedener Wörterbucheinträge umfasst. Der Fokus liegt auf der Erhellung der Bedeutungsvielfalt und -entwicklung des Verbs im Laufe der Sprachgeschichte, unter Einbezug phonologischer Aspekte und der Analyse von Übereinstimmungen und Abweichungen in den Wörterbucheinträgen verschiedener Epochen.
Etymologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der etymologischen Herkunft des Verbs „starren“. Es werden zwei im Alt- und Mittelhochdeutschen getrennte, aber etymologisch verwandte Verben identifiziert: „storren“ (geminiert, Bedeutung „steif sein oder werden“) und „starēn/starōn“ (nicht geminiert, Bedeutung „unbeweglich, mit unbewegten Augen blicken“). Die indogermanische Wurzel *(s)ter(ə)-, *stre- wird als Ursprung benannt, und es werden Verbindungen zu anderen germanischen und außergermanischen Wörtern mit ähnlicher Bedeutung hergestellt. Die Zusammenführung dieser beiden Verben im Frühneuhochdeutschen zu dem heutigen „starren“ wird erklärt.
Bedeutungen und ihr Wandel: Dieses Kapitel analysiert den Bedeutungswandel des Verbs „starren“ von den althochdeutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Bedeutungen bis hin zur heutigen Bedeutung („steif sein, strotzen von etw., mit unbewegtem Auge blicken, unentwegt in eine Richtung blicken“). Der Vergleich der Bedeutungen über die verschiedenen Sprachstufen hinweg soll einen möglichen Bedeutungswandel aufzeigen und die Entwicklung der verschiedenen Bedeutungsnuancen beleuchten. Die Analyse bezieht sich auf die in verschiedenen Wörterbüchern dokumentierten Bedeutungen und deren eventuelle Unterschiede.
Schlüsselwörter
Starren, Etymologie, Bedeutungsgeschichte, Semantik, Phonologie, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Indogermanisch, Germanisch, Lexikologie, Lexikographie, Wörterbücher, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Lexikologische und Lexikographische Einzelwortgeschichte des Verbs „starren“
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die lexikologische und lexikographische Entwicklung des Verbs „starren“. Sie verfolgt die sprachhistorische Entwicklung des Wortes, seine Verbindungen zu anderen germanischen und indogermanischen Sprachen und die daraus resultierenden Bedeutungsänderungen.
Welche Sprachperioden werden betrachtet?
Die Analyse umfasst die phonologischen und semantischen Merkmale des Wortes in verschiedenen Sprachperioden: Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit nutzt einen methodischen Ansatz, der die Untersuchung der Etymologie, der semantischen Entwicklung in verschiedenen Sprachstufen und den Vergleich verschiedener Wörterbucheinträge umfasst. Der Fokus liegt auf der Erhellung der Bedeutungsvielfalt und -entwicklung des Verbs im Laufe der Sprachgeschichte, unter Einbezug phonologischer Aspekte und der Analyse von Übereinstimmungen und Abweichungen in den Wörterbucheinträgen verschiedener Epochen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die etymologische Entwicklung des Verbs „starren“, den Bedeutungswandel über verschiedene Sprachperioden, eine vergleichende Analyse von Wörterbucheinträgen, indogermanische und germanische Verwandtschaftsbeziehungen sowie den Zusammenhang zwischen Phonologie und Semantik von „starren“.
Wie wird der Bedeutungswandel von „starren“ untersucht?
Das Kapitel "Bedeutungen und ihr Wandel" analysiert den Bedeutungswandel von den althochdeutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Bedeutungen bis zur heutigen Bedeutung. Der Vergleich der Bedeutungen über die verschiedenen Sprachstufen hinweg soll einen möglichen Bedeutungswandel aufzeigen und die Entwicklung der verschiedenen Bedeutungsnuancen beleuchten. Die Analyse bezieht sich auf die in verschiedenen Wörterbüchern dokumentierten Bedeutungen und deren eventuelle Unterschiede.
Welche etymologischen Aspekte werden behandelt?
Das Kapitel "Etymologie" befasst sich mit der etymologischen Herkunft des Verbs „starren“. Es werden zwei im Alt- und Mittelhochdeutschen getrennte, aber etymologisch verwandte Verben identifiziert: „storren“ und „starēn/starōn“. Die indogermanische Wurzel *(s)ter(ə)-, *stre- wird als Ursprung benannt, und es werden Verbindungen zu anderen germanischen und außergermanischen Wörtern mit ähnlicher Bedeutung hergestellt. Die Zusammenführung dieser beiden Verben im Frühneuhochdeutschen zu dem heutigen „starren“ wird erklärt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse bezieht sich auf Eintragungen in zeitgenössischen Wörterbüchern und deren Übereinstimmungen bzw. Abweichungen. Die Arbeit verweist auf ein Literaturverzeichnis (im Originaltext vorhanden, aber nicht hier im Detail aufgeführt).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Starren, Etymologie, Bedeutungsgeschichte, Semantik, Phonologie, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Indogermanisch, Germanisch, Lexikologie, Lexikographie, Wörterbücher, Sprachwandel.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Einleitung, Etymologie, Bedeutungen und ihr Wandel, Gesamtbetrachtung (nicht im Detail ausgeführten Auszug) und Literaturverzeichnis gegliedert.
- Arbeit zitieren
- Hanka Loos (Autor:in), 2005, Die Einzelwortgeschichte des Wortes "starren", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54620