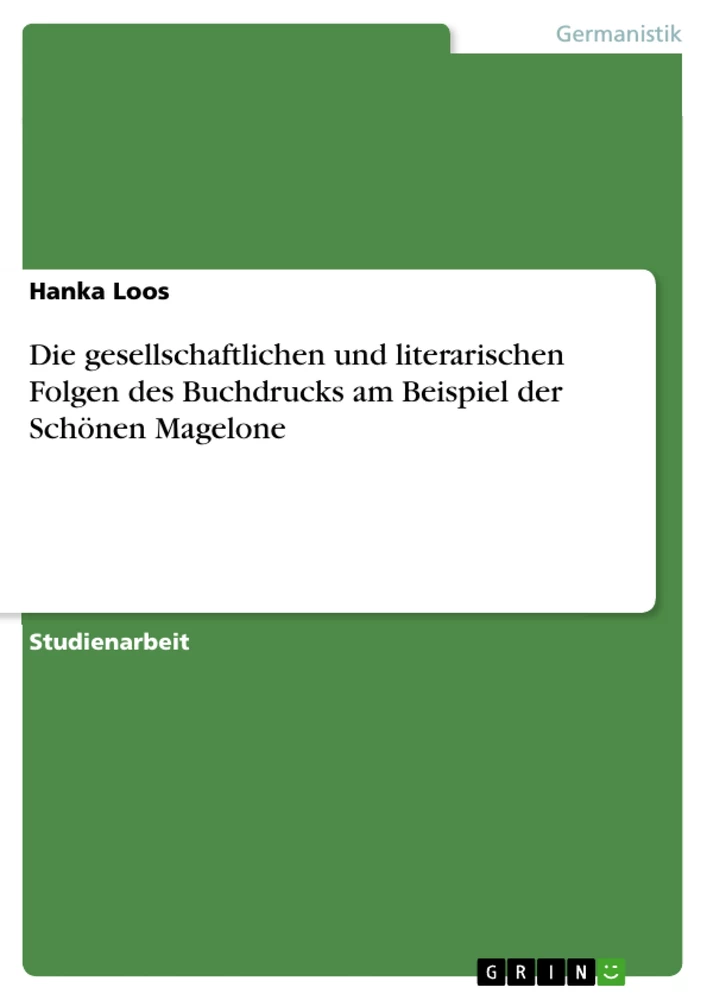Der Hausarbeit liegt der 1527 vom Französischen ins Deutsche übersetzte Roman der „Schönen Magelone“ von Veit Warbeck zugrunde, der 1535 von Georg Spalatin in Druck gegeben wurde. Anhand dessen soll untersucht werden, inwiefern sich der Text und das Publikum durch den Medienwechsel vom handgeschriebenen zum gedruckten Buch verändert. Dabei wird der durch den Druckauftraggeber Spalatin geschriebene „sendbrieff“ von besonderem Interesse sein. Zunächst erfolgt eine theoretische Darlegung der Verbreitung und Bedeutung des Buchdrucks. Dabei wird auch darauf eingegangen, was als Erstes gedruckt wurde und wer die Rezipienten waren.
Auf dieser theoretischen Grundlage basierend werde ich mir Warbecks Übersetzung speziell unter den Gesichtspunkten des Publikums und der Funktion anschauen. Im Anschluß daran soll der gedruckte Text und Spalatins Vorrede im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Auch hier werde ich mich sowohl mit dem Publikums- und dem damit einhergehenden Funktionswandel als auch mit Spalatins Umdeutung des Textes beschäftigen, um dann ein Ergebnis zu bekommen, inwiefern der Medienwechsel den Text bzw. dessen Rezeption verändert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Buchdruck
- 1.1 Druckerzeugnisse
- 1.2 Rezipienten
- 2. „Die schöne Magelone“
- 2.1 Warbecks Übersetzung
- 2.2 Warbecks Publikum
- 2.3. Funktion der Magelone-Übersetzung Warbecks
- 3. Druck der Magelone durch Spalatin
- 3.1 Druck
- 3.2 Vorrede Spalatins
- 3.3 Publikumswandel
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Übersetzung des Romans „Die schöne Magelone“ von Veit Warbeck, die 1527 vom Französischen ins Deutsche übertragen und 1535 von Georg Spalatin in Druck gegeben wurde. Das Ziel ist es, die Auswirkungen des Medienwechsels vom handgeschriebenen zum gedruckten Buch auf den Text und das Publikum zu untersuchen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem „sendbrieff“ Spalatins, der im Kontext des Druckauftrags entstand.
- Die Verbreitung und Bedeutung des Buchdrucks
- Die Auswirkungen des Buchdrucks auf die Rezeption literarischer Werke
- Die Rolle von Druckauftraggebern wie Spalatin
- Die Veränderungen im Publikum und deren Einfluss auf die Funktion von Texten
- Die Umdeutung von Texten durch den Druck
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Einführung in die Geschichte des Buchdrucks und dessen Bedeutung für die Entwicklung des spätmittelalterlichen Geisteslebens. Im ersten Kapitel wird die Entwicklung des Buchdrucks von Gutenberg bis zum 16. Jahrhundert erläutert, wobei der Fokus auf den Wandel vom handgeschriebenen zum gedruckten Buch liegt. Dabei werden auch die ersten Druckerzeugnisse und deren Rezipienten beleuchtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Warbecks Übersetzung der „Schönen Magelone“ und analysiert die Besonderheiten seiner Übersetzung sowie die Eigenschaften des Publikums. Die Funktion der Magelone-Übersetzung Warbecks im Kontext der Zeit wird ebenfalls untersucht.
Kapitel drei widmet sich dem Druck der Magelone durch Spalatin. Dabei wird der Druck selbst, die Vorrede Spalatins und der daraus resultierende Publikumswandel betrachtet. Die Analyse der Umdeutung des Textes durch Spalatin steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Buchdruck, „Die schöne Magelone“, Veit Warbeck, Georg Spalatin, Medienwechsel, Publikum, Funktion, Rezeption, sendbrieff, Reformation, Literaturgeschichte, Textanalyse, Übersetzung, Druckauftrag.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der Buchdruck die Rezeption der „Schönen Magelone“?
Der Wechsel vom handgeschriebenen zum gedruckten Buch veränderte das Publikum und die Funktion des Textes, was durch Spalatins Vorrede (sendbrieff) deutlich wird.
Wer war Veit Warbeck?
Warbeck übersetzte den Roman der „Schönen Magelone“ 1527 aus dem Französischen ins Deutsche.
Welche Rolle spielte Georg Spalatin für dieses Werk?
Spalatin gab die Übersetzung 1535 in Druck und verfasste eine Vorrede, die den Text für ein breiteres Publikum umdeutete.
Was war der „sendbrieff“?
Es handelt sich um die Vorrede Spalatins, die als Dokument des Medienwechsels von besonderem Interesse für die Funktionsänderung des Textes ist.
Wer waren die ersten Rezipienten von Druckerzeugnissen?
Die Arbeit untersucht den Wandel der Leserschaft von einer kleinen Elite hin zu einem breiteren, durch den Buchdruck erreichten Publikum.
- Quote paper
- Hanka Loos (Author), 2001, Die gesellschaftlichen und literarischen Folgen des Buchdrucks am Beispiel der Schönen Magelone, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54621