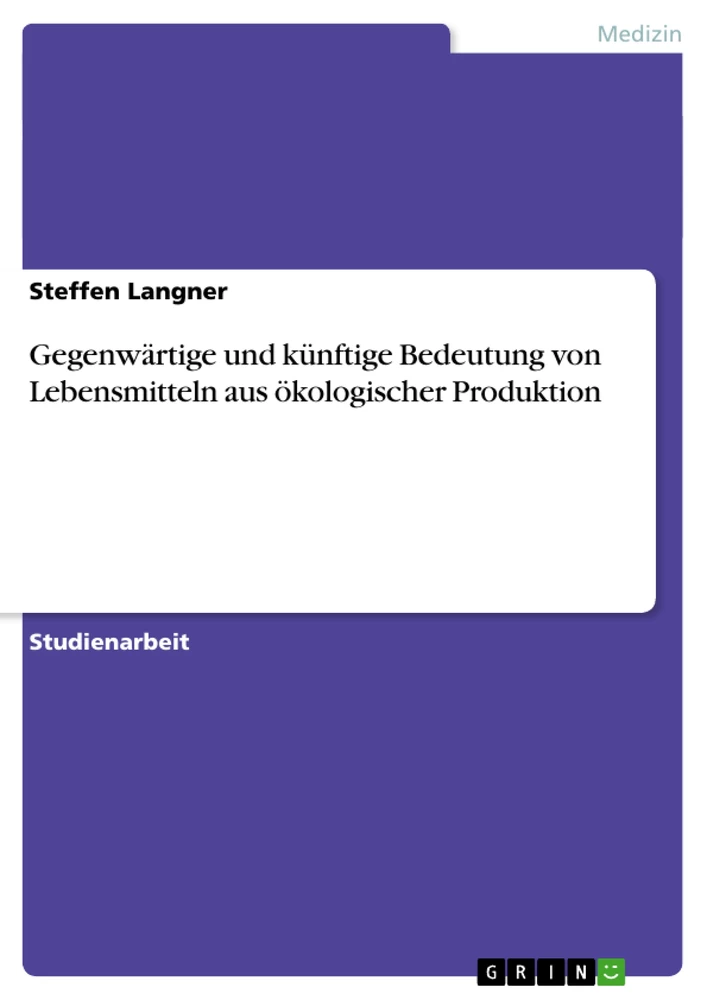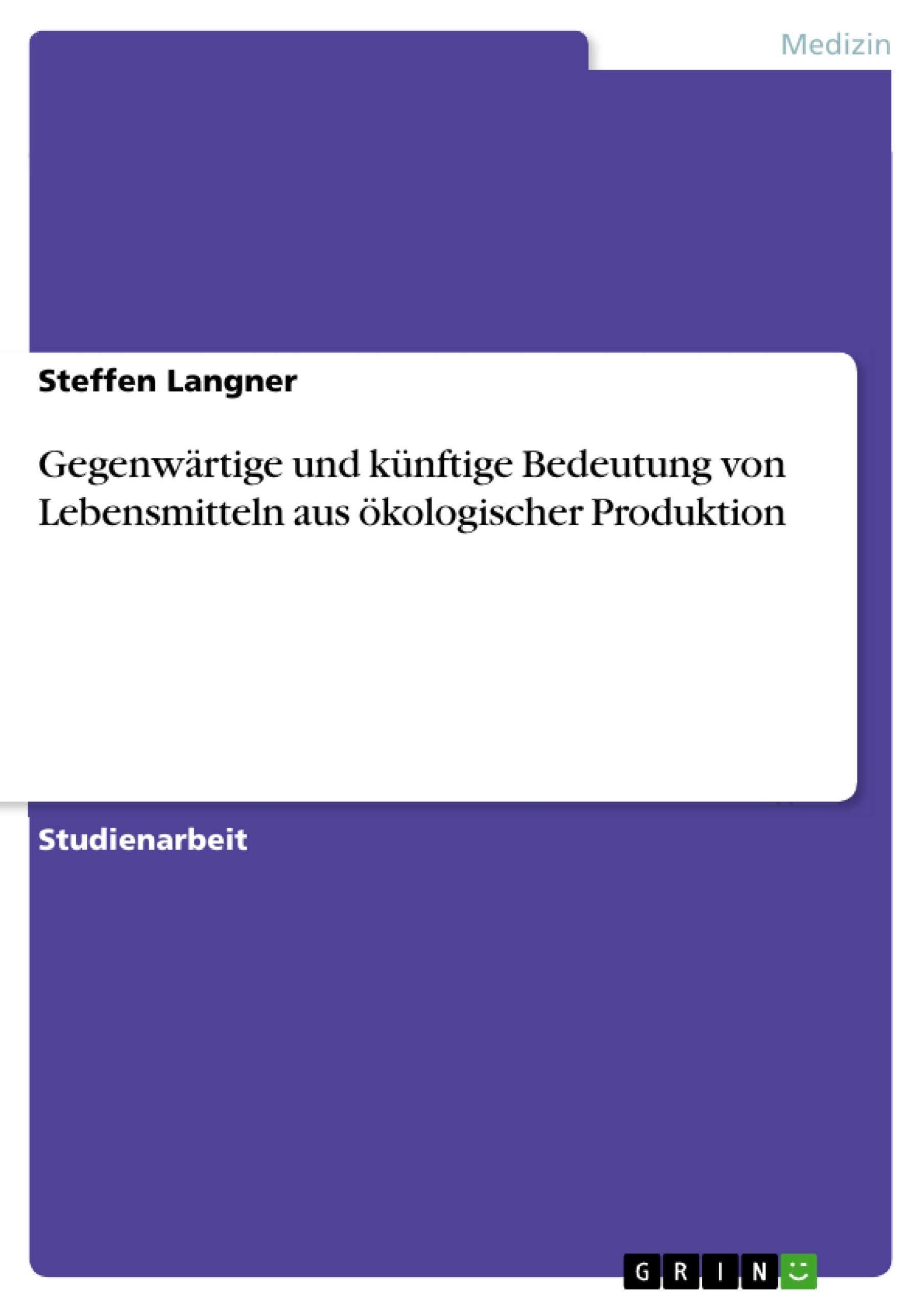Kurz vor Beginn des neuen Jahrtausends sind die Blicke nach vorn gerichtet. Neugierig, auch etwas angespannt blicken wir in die Zukunft. ,,Was wird sein?" heißt es, ,,Wie werden wir uns ernähren?", ,,Besser?", ,,Gesünder?". Wer heute etwas über die Zukunft zu sagen hat, hat Konjunktur.
Glaubt man vielen Trendforschern, so steht unsere Ernährung vor einer Zeit des dynamischen Umbruchs. Wo immer wir uns ,,Zwischen Öko-Kost und Designer Food" verorten mögen, eine gesündere, eine funktionalere Ernährung scheint greifbar nahe.
Wir möchten uns hier mit der ,,Öko-Kost" beschäftigen. Dieser Begriff steht für uns nicht allein für spezielle Produkte, mögen diese auch noch so hochwertig sein. ,,Öko-Kost" steht zudem für eine andere Art des Essens, für eine andere Lebensweise. ,,Öko-Kost" zu essen, bedeutet dann Essen als Teil eines umfassenderen Geschehens zu verstehen. Das aber hat wahrlich Geschichte und geht weit hinaus über Ökobilanzen und Ernährungsökologie.
Schon im 19. Jahrhundert fanden Lebensreformer Erfüllung nicht nur im Essen bestimmter Produkte, sondern vielmehr in ihrer bewussten Askese gegenüber mehrheitlich akzeptierten Lebensmitteln. Das andere Essen sollte zeigen, wie anders man selbst war, wie anders das Leben sein könnte. Der nicht notwendige Verzicht war (und ist) Stein des Anstoßes. Die irritierte und herausgeforderte Mehrheit reagiert regelmäßig mit Hohn und Spott.
Eine andere Lebensweise hat andere Bewertungskriterien, die sich nicht nur in alternativen Qualitätsdefinitionen manifestieren, sondern in alternativen Gesellschaftsentwürfen. Utopien dieser Art schaffen immer wieder immer neue Gestaltungsräume. Sie wollen verändern, wollen in gewisser Weise missionieren. Das geht über Wissen, das geht aber auch durch den Appell ans Gemüt und Mitgefühl. Die Lebensreform mag Außenseiter und Aussteiger hervorgerufen haben, doch ihre soziale Basis bildeten stets vorrangig bürgerliche und akademische Gruppen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
-
- ökologischer und integrierter Anbau
- Was sind ökologische Lebensmittel?
- Was darf sich „Öko“ nennen?
- Gibt es Kontrollen?
- Kennzeichnung
- Ökoverordnung
- ökologischer Pflanzenbau
- Verordnung zur artgerechten Tierhaltung
- Verbandsrichtlinien zur artgerechten Tierhaltung
- artgerechtes Futter für das Bio-Vieh
- integrierter Pflanzenbau
- Definition
- Durch neue Methoden zur gläsernen Produktion (Institut für Agrartechnik, Bornim)
- ökologischer und integrierter Anbau
- BSE und Co
- BSE und Reaktionen
- Was ist BSE?
- Erste Fälle und Reaktionen darauf
- Großbritannien und Europa
- Der erste positive Test
- BSE-Fälle nach Bundesländer
- MKS und Reaktionen
- Was ist MKS?
- Verbreitung auf der Erde
- Gegenmaßnahmen
- Erneuter Ausbruch
- Reaktionen
- Andere Lebensmittelskandale
- BSE und Reaktionen
- Wende als Folge der Skandale?
- Neues Ministerium
- Zehn Empfehlungen des Aktionsbündnis Ökolandbau:
- Programm für den ökologischen Landbau mit klaren Zielvorgaben auflegen
- den Dialog unter den Akteuren fördern
- Verbraucherinformation und Kennzeichnung verbessern
- Organisationen des ökologischen Landbaus unterstützen
- den ökologischen Landbau im Rahmen der neuen Politik zur Entwicklung der ländlichen Räume fördern
- Agrarumweltprogramme: Anreize schaffen für Ökolandbau
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung an die ökologische Wirtschaftsweise koppeln
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung an die ökologische Wirtschaftsweise koppeln
- Ausbildung, Beratung und Forschung verbessern
- Inspektion und Zertifizierung optimieren
- Gesetzesänderungen des BMVEL
- Marktchancen
- Handel
- Ökolandbau weltweit
- Handelsaufschwung
- Rentiert sich Ökolandbau für den Bauern?
(Studie: BML)
- Faktorenausstattung
- Produktionsstruktur
- Erträge, Leistungen, Preise
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Gewinn
- Änderung des Konsumverhaltens infolge von Lebensmittelskandalen
- Die Chancen des neuen Öko-Prüfzeichens
- Zusatzstoffe und Aromen
- Zusatzstoffe
- Vorgaben
- Keine Zusatzstoffe?
- Grundbedingungen
- Herstellung von Zusatzstoffen
- Rechtlich klar geregelt
- E-Nummern und ihre Bedeutung
- Zusatzstoffe: Sicher und notwendig, der „ADI-Wert“.
- Aromen
- Definition: Aromen
- Aromenverordnung
- Warum aromatisieren?
- Einschränkungen
- Dosierung
- Zusatzstoffe
- Produkte aus dem ökologischen Landbau im Vergleich
- Kriterien und Methoden
- Qualität
- Verkostung
- chemisch-analytische Untersuchungsmethoden
- die Biophotonen-Messungen (Institut für Biophysik)
- der elektrochemische Screening-Test (FH Weihenstephan/Triesdorf)
- Vergleichsstudien
- Vergleich von biologischen und konventionellen Produkten (Ludwig-Boltzmann-Institut für Biologischen Landbau)
- nicht besser, aber schmackhafter? (Studie: BGVV)
- Rückstandsproblematik
(Studie: Stiftung Warentest)
- Pestizide
- Schwermetalle
- Nitrat
- Öko-Äpfel schmecken besser (USA: 5jahres Studie)
- Kriterien und Methoden
- Ergebnis/Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Zukunft der „Öko-Kost“ und untersucht, wie sich die Lebensmittelskandale der 1990er Jahre auf den ökologischen Landbau und die Konsumgewohnheiten ausgewirkt haben. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu zeichnen und eine Prognose für die Entwicklung des Ökolandbaus in der näheren Zukunft zu erstellen.
- Vergleich von ökologischem und integriertem Anbau
- Die Auswirkungen von Lebensmittelskandalen auf den Konsum und die Lebensmittelproduktion
- Entwicklungen im Ökolandbau und in der Ökoverordnung
- Marktchancen und Rentabilität des ökologischen Landbaus
- Untersuchung von Zusatzstoffen und Aromen in Lebensmitteln
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Lebensreformbewegung und die Bedeutung von „Öko-Kost“ als Ausdruck einer veränderten Lebensweise. Sie stellt die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung des ökologischen Landbaus und seiner Zukunft in den Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen.
- Ökologischer und integrierter Anbau: Dieses Kapitel geht auf die Definition, Kennzeichnung und Kontrollen von ökologischen Lebensmitteln ein. Es beleuchtet die Ökoverordnung und deren Auswirkungen auf den ökologischen Pflanzenbau und die artgerechte Tierhaltung. Des Weiteren wird der integrierte Pflanzenbau mit seinen neuen Produktionsmethoden vorgestellt.
- BSE und Co: Dieses Kapitel befasst sich mit den Lebensmittelskandalen der 1990er Jahre, insbesondere mit den Folgen von BSE und MKS. Es beleuchtet die Reaktion der Politik und die Auswirkungen auf den Lebensmittelmarkt.
- Wende als Folge der Skandale?: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen in der Politik nach den Lebensmittelskandalen. Es stellt das neue Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vor und präsentiert die Empfehlungen des Aktionsbündnis Ökolandbau.
- Marktchancen: Dieses Kapitel untersucht die Marktchancen des ökologischen Landbaus, sowohl im Inland als auch im Ausland. Es analysiert die Rentabilität des ökologischen Landbaus für Landwirte und untersucht, wie sich das Konsumverhalten durch die Lebensmittelskandale verändert hat.
- Zusatzstoffe und Aromen: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Vorgaben und der Bedeutung von Zusatzstoffen und Aromen in Lebensmitteln. Es beleuchtet die Bedeutung der E-Nummern und die Sicherheitsstandards für Zusatzstoffe.
- Produkte aus dem ökologischen Landbau im Vergleich: Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen Produkten aus dem ökologischen Landbau und konventionellen Produkten anhand von Kriterien wie Qualität, Geschmack und Rückstandsproblematik. Es präsentiert Ergebnisse von Vergleichsstudien und beleuchtet die Bedeutung verschiedener Untersuchungsmethoden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieses Textes sind: Ökologischer Landbau, integrierter Anbau, Lebensmittelskandale, BSE, MKS, Ökoverordnung, artgerechte Tierhaltung, Marktchancen, Konsumverhalten, Zusatzstoffe, Aromen, Vergleichsstudien, Produktqualität, Rückstandsproblematik.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert Lebensmittel aus ökologischer Produktion?
Ökologische Lebensmittel stammen aus kontrolliertem Anbau, der auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger verzichtet und eine artgerechte Tierhaltung vorschreibt.
Wie beeinflussten Skandale wie BSE den Bio-Markt?
Lebensmittelskandale wie BSE und MKS führten zu einer tiefen Verunsicherung der Verbraucher und lösten einen massiven Nachfrageschub nach zertifizierten Bio-Produkten aus.
Was bedeutet das Öko-Prüfzeichen für den Verbraucher?
Es garantiert, dass die Produkte gemäß der EG-Öko-Verordnung hergestellt und regelmäßig von unabhängigen Stellen kontrolliert wurden.
Sind Bio-Lebensmittel gesünder als konventionelle?
Studien zeigen oft geringere Rückstände von Pestiziden und Nitraten sowie teilweise bessere geschmackliche Qualitäten, auch wenn der gesundheitliche Mehrwert wissenschaftlich noch diskutiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen ökologischem und integriertem Anbau?
Der integrierte Anbau nutzt eine Kombination aus biologischen und chemischen Methoden, um den Einsatz von Pestiziden zu minimieren, ist aber weniger streng als der rein ökologische Landbau.
- Quote paper
- Steffen Langner (Author), 2001, Gegenwärtige und künftige Bedeutung von Lebensmitteln aus ökologischer Produktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5465