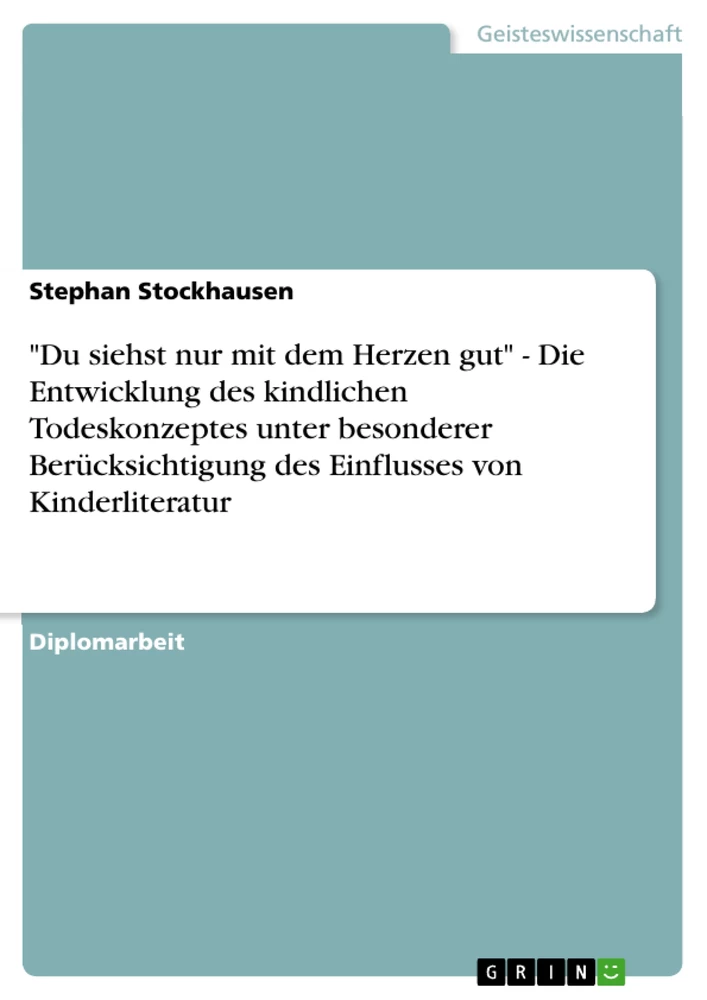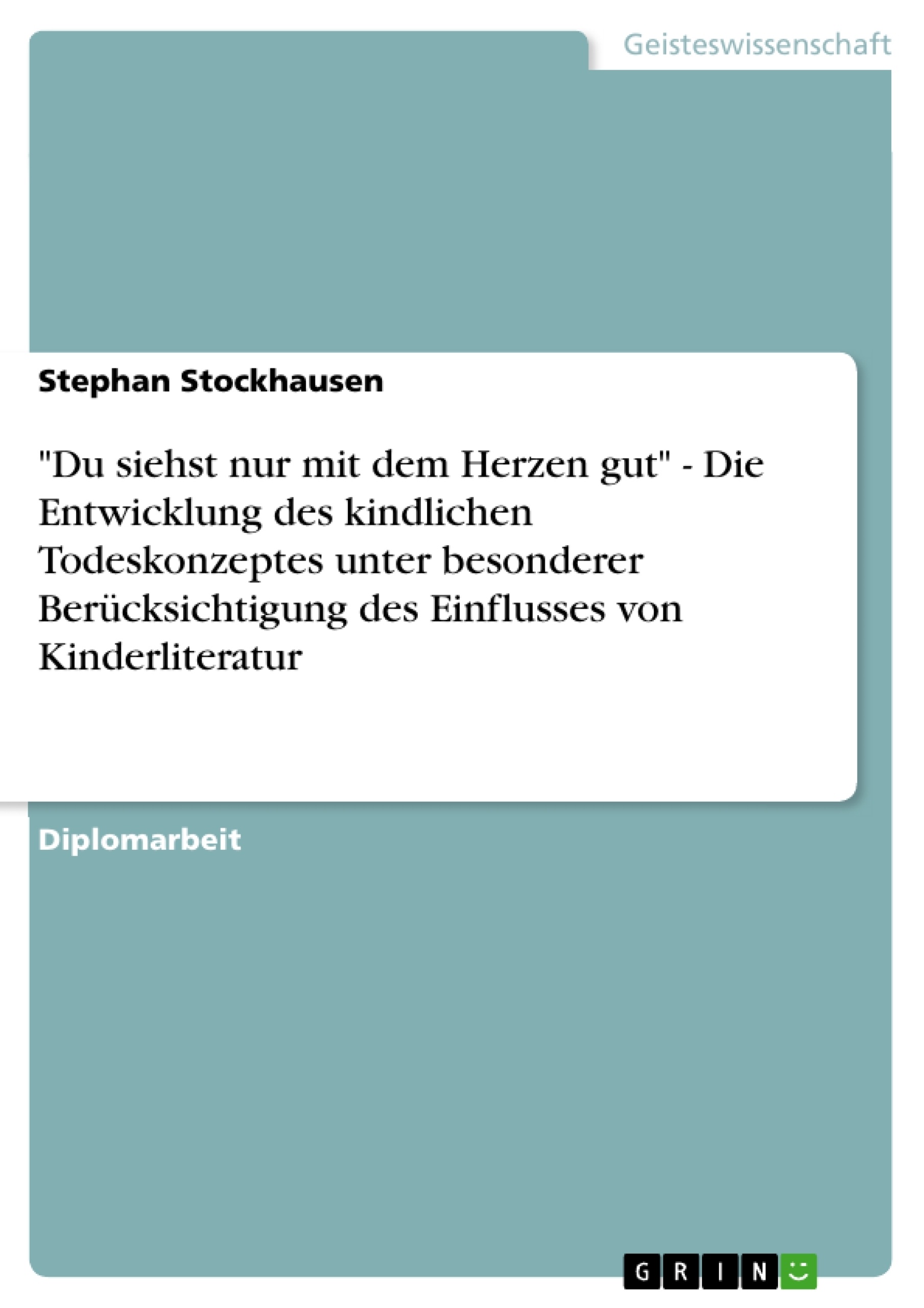Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit werde ich mich auseinandersetzen mit kindlichen Vorstellungen über Sterben und Tod und der Entwicklung dieser Vorstellungen in ihren Bezügen zu gesellschaftlichen, sozialen und entwicklungspsychologischen Einflüssen besondere Beachtung schenken. Die Ausführungen über kindliche Todeskonzepte beschränken sich im wesentlichen auf Aussagen über Kinder unseres Kulturkreises, die keinen Ausnahmesituationen wie Krankheit oder Krieg ausgesetzt sind. 2 Unter Tod und Sterben verstehe ich das Lebensende im biologisch - medizinischen Sinne. Die medizinischethische Frage, ab welchem Zeitpunkt ein Mensch als tot zu gelten hat, ist hierbei von keiner besonderen Bedeutung.
Das Interesse dieser Arbeit richtet sich somit nicht auf die kindlichen Vorstellungen über den tatsächlichen biologischen Ablauf des Sterbeprozesses, sondern auf ihre Vorstellungen und Empfindungen, mit denen sie den Begriff „Tod“ mit Inhalt füllen. Dies ist gleichzeitig die Definition der Begriffe „kindliches Todeskonzept“ bzw. „-verständnis“. Der Tod ist für ein Kind zunächst lediglich ein Begriff, der aufgrund fehlender Erfahrungen sehr unscharf ist. Da Erfahrungen ein wesentlicher Bestandteil der Begriffsbildung sind, werden sie im Geiste kategorisiert und zu einem Konzept, d. h. zu einem Plan oder Entwurf von der Erfahrungswelt und ihrer Zusammenhänge, zusammengefaßt. Abhängig von der gebildeten Hierarchie logischer und unscharfer Begriffe entwickelt sich das „Wissen von der Welt“. Unter den genannten Begriffen sind folglich die Entwürfe, die sich Kinder auf der Basis ihrer Erfahrungen von dem Phänomen Tod machen, zu verstehen. Diese Entwürfe bzw. Konzepte 3 sind, ebenso wie das aus ihnen resultierende Wissen, von der Erfahrungswelt des Kindes abhängig. Es gibt folglich kein universelles Todeskonzept bei Kindern, wie man aufgrund der Themenstellung meinen könnte, sondern höchst unterschiedliche Entwicklungslinien. Die vorliegende Arbeit wird ich die wichtigsten Gemeinsamkeiten dieser Entwicklungen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil 1: Interdisziplinäre Überlegungen zu Tod und Sterben
- 1.1. Historisch - Philosophische Aspekte des Todes
- 1.1.1. Historisch - Philosophische Erklärungen der griechischen Antike
- 1.1.2. Historisch-Philosophische Erklärungen der römischen Antike
- 1.1.3. Der Tod im Mittelalter und in der frühen Neuzeit
- 1.1.4. Moderne Gedanken zum Tod
- 1.2. Theologisch - Christliche Aspekte des Todes
- 1.2.1. Der Tod im Verständnis des Alten Testaments
- 1.2.2. Das Todesverständnis des Neuen Testaments
- 1.3. Psychologische Aspekte von Tod und Sterben
- 1.4. Soziologische Aspekte von Tod und Sterben
- 1.4.1. Die Frage nach einer Thanatosoziologie
- 1.4.2. Der gesellschaftliche Umgang mit Sterben und Tod
- 1.4.2.1. Der verbotene Tod
- 1.4.2.2. Der akzeptierte Tod
- 1.5. Tod und Sterben in der sozialarbeiterischen Praxis
- Teil 2: Entstehung und Entwicklung des Todeskonzepts bei Kindern
- 2.1. Die Kognitive Entwicklung des Kindlichen Sterblichkeitswissens
- 2.1.1. Das Kind bis zu fünf Jahren
- 2.1.2. Das Kind von sechs und sieben Jahren
- 2.1.3. Das Kind von acht und neun Jahren
- 2.1.4. Das Kind von zehn bis vierzehn Jahren
- 2.2. emotionale Faktoren des kindlichen Todesverständnisses
- 2.3. Das kindliche Trauerverhalten
- 2.4. Pädagogische Überlegungen zur Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes
- 2.4.1. Die Rolle der Eltern
- 2.4.2. Die Rolle des Kindergartens
- 2.4.3. Die Rolle der Schule
- 2.4.4. Die Bedeutung der Massenmedien
- Exkurs: Das schwerkranke Kind
- Teil 3: Praxis des kindlichen Todesverständnisses: Projektarbeit des Hospizvereins Wattenscheid e. V.
- Teil 4: Das Thema „Tod und Sterben“ in der Kinderliteratur
- 4.1. Die Bedeutung der Literatur für die Sterbeerziehung
- 4.2. Tod und Sterben in Kindermärchen
- 4.3. Ausgewählte Kinderlitearatur
- 4.3.1. Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz
- 4.3.2. Marit Kaldhol / Wenche Oyen: Abschied von Rune
- 4.3.3. Sigrid Zeevaert: Max, mein Bruder
- 4.3.4. Astrid Lindgren: Mio, mein Mio / Die Brüder Löwenherz
- 4.3.5. Peter Härtling: Alter John
- 4.3.6. Elfie Donnelly: Servus Opa, sagte ich leise
- Exkurs: die irische Sagenwelt
- Teil 5: Anhang
- 5.1. Resümee und Reflexion
- 5.2. Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 5.3. Bildverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes, insbesondere unter Berücksichtigung des Einflusses von Kinderliteratur. Die Arbeit analysiert die kognitiven, emotionalen und sozialen Aspekte des Todesverständnisses bei Kindern sowie die Rolle verschiedener Bildungseinrichtungen und Medien in diesem Prozess.
- Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes
- Einfluss von Kinderliteratur auf das Todesverständnis
- Kognitive, emotionale und soziale Aspekte des Sterbens
- Rolle von Eltern, Kindergarten, Schule und Medien in der Sterbeerziehung
- Praxisbeispiele aus der Arbeit des Hospizvereins Wattenscheid e. V.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer interdisziplinären Betrachtung des Todes aus historischen, philosophischen, theologischen, psychologischen und soziologischen Perspektiven. Anschließend werden die kognitiven Entwicklungsstufen des kindlichen Sterblichkeitswissens sowie die emotionalen und sozialen Aspekte des Todesverständnisses bei Kindern detailliert behandelt. Im Fokus steht die Rolle von Eltern, Kindergarten, Schule und Massenmedien in der Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes.
Die Arbeit setzt sich mit der Praxis des kindlichen Todesverständnisses auseinander und beleuchtet die Projektarbeit des Hospizvereins Wattenscheid e. V. als Beispiel. Anschließend wird die Bedeutung von Kinderliteratur für die Sterbeerziehung untersucht, wobei verschiedene Kinderbücher und deren Darstellung des Themas „Tod und Sterben“ analysiert werden.
Die Arbeit schließt mit einem Resümee und einer Reflexion auf die Ergebnisse der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Kindliches Todeskonzept, Sterbeerziehung, Kinderliteratur, Tod und Sterben, Kognitive Entwicklung, Emotionale Faktoren, Soziale Aspekte, Pädagogik, Hospizarbeit, Thanatosoziologie, Todesverständnis
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickeln Kinder eine Vorstellung vom Tod?
Das kindliche Todeskonzept entwickelt sich stufenweise abhängig von kognitiven Fähigkeiten, Erfahrungen und sozialen Einflüssen.
Welchen Einfluss hat Kinderliteratur auf das Todesverständnis?
Bücher wie "Der Kleine Prinz" oder "Die Brüder Löwenherz" bieten Kindern einen geschützten Raum, um sich emotional mit Sterben und Abschied auseinanderzusetzen.
Ab welchem Alter verstehen Kinder die biologische Endgültigkeit des Todes?
Meist entwickeln Kinder zwischen 8 und 9 Jahren ein Verständnis für die Irreversibilität und Universalität des Todes.
Was ist die Rolle der Eltern in der Sterbeerziehung?
Eltern sind zentrale Bezugspersonen, die durch ehrliche Antworten und Begleitung bei Trauerprozessen die Begriffsbildung des Kindes unterstützen.
Was versteht man unter Thanatosoziologie?
Ein Teilbereich der Soziologie, der untersucht, wie die Gesellschaft mit dem Thema Tod umgeht und wie Sterben sozial organisiert wird.
- Quote paper
- Dipl.-Soz.arb. Stephan Stockhausen (Author), 1996, "Du siehst nur mit dem Herzen gut" - Die Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Kinderliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54693