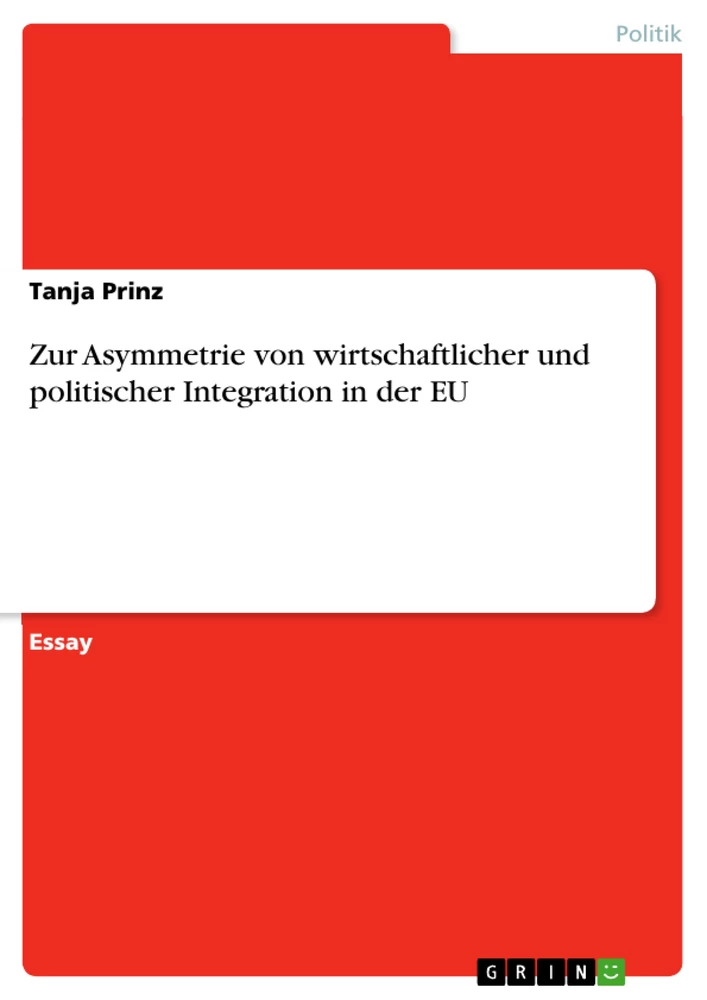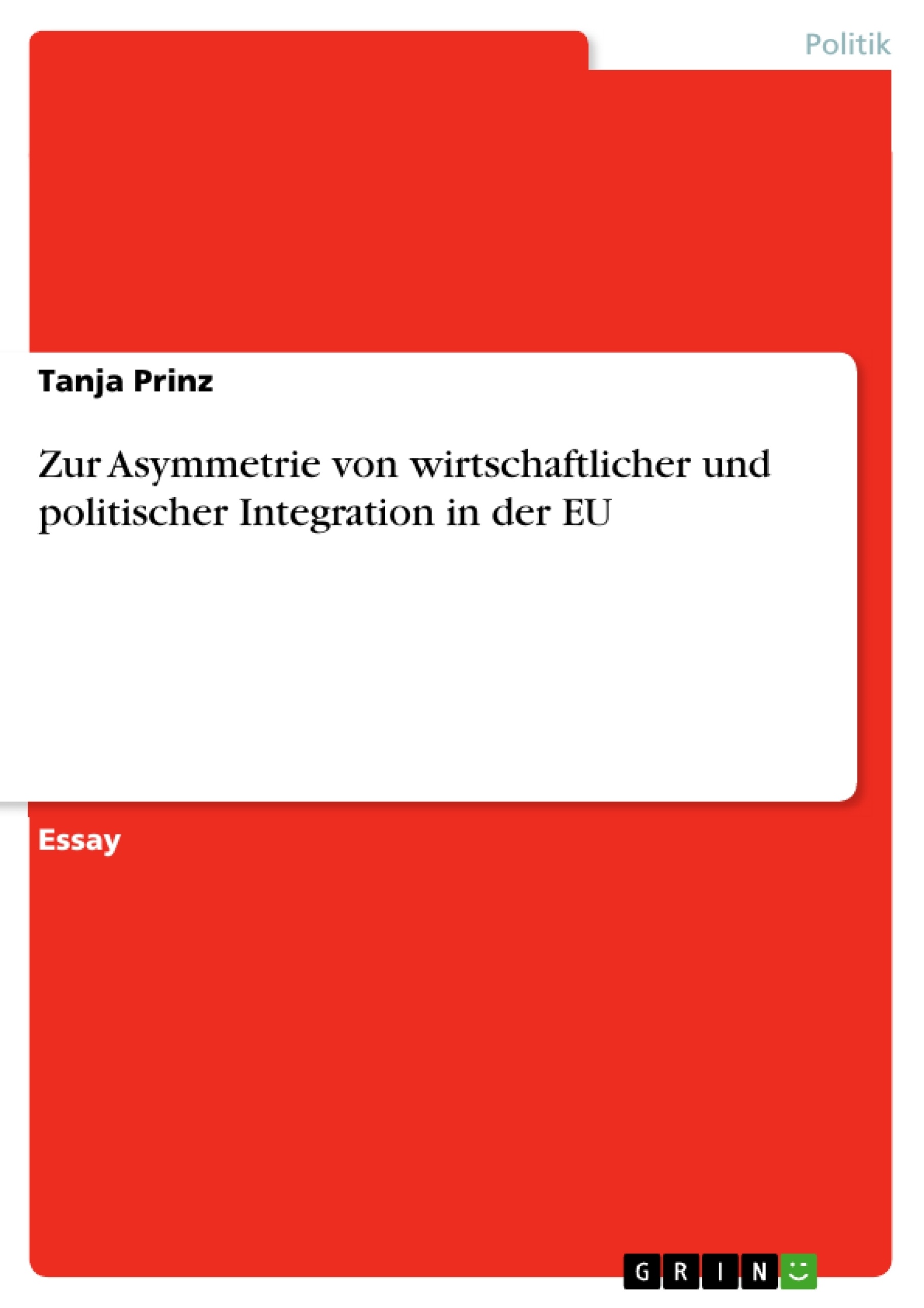I Nach Andrew Moravcsik ist es eindeutig: Das explizite Motiv für das Vorantreiben der europäischen Integration war stets ökonomischer Natur – oder genauer, „the anticipated benefits for consumers and producers that were thought to be associated with the creation of larger European markets for goods and services, and capital” (Moravcsik 1998: 13). Falls dem so ist, kann daraus geschlussfolgert werden, dass die Bemühungen um eine politische Integration immer erst an zweiter Stelle standen und diese der wirtschaftlichen stets hinterher hinkte? Wird derzeit zu Recht eine Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration postuliert oder hat letztere längst aufgeschlossen?
II Unbestritten ist, dass die EU seit ihrer Gründung als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit den Römischen Verträgen von 1957 bis hin zum Vertrag von Nizza die Bandbreite ihrer Aktivitäten und Kompetenzen ausdehnen konnte – laut Mark A. Pollack sogar „dramatically“ (Pollack 2000: 519). Er zeigt in seiner Studie unter dem Titel „The End of Creeping Competence?“, dass die Europäische Union mittlerweile „a policy presence in nearly every issue-area of European politics“ (Pollack 2000: 537) aufweist. Auch Ernst Haas hat mit seiner Theorie des Neofunktionalismus „the dynamic process of task expansion in the European Union“ (Pollack nach Haas 1994: 98) erläutert und mit seinem Erklärungsansatz des spill-overs eine Kompetenzerweiterung der EU vorhergesagt.
Um eine Asymmetrie zwischen politischer und wirtschaftlicher Integration zu postulieren, ist neben einer Analyse der Breite der Integration vor allem eine Analyse der Tiefe ausschlaggebend. So bedingt zwar eine in der Breite angelegte Politik eine Vertiefung, damit die EU überhaupt tätig werden kann. Doch nur die vertieften, supranationalen Politikbereiche haben für die Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht zur Folge, dessen Umsetzung die EU-Kommission und dessen Verstoß der EuGH überprüfen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung
- I Nach Andrew Moravcsik ist es eindeutig: Das explizite Motiv für das Vorantreiben der europäischen Integration war stets ökonomischer Natur - oder genauer, „the anticipated benefits for consumers and producers that were thought to be associated with the creation of larger European markets for goods and services, and capital” (Moravcsik 1998: 13). Falls dem so ist, kann daraus geschlussfolgert werden, dass die Bemühungen um eine politische Integration immer erst an zweiter Stelle standen und diese der wirtschaftlichen stets hinterher hinkte? Wird derzeit zu Recht eine Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration postuliert oder hat letztere längst aufgeschlossen?
- II Unbestritten ist, dass die EU seit ihrer Gründung als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit den Römischen Verträgen von 1957 bis hin zum Vertrag von Nizza die Bandbreite ihrer Aktivitäten und Kompetenzen ausdehnen konnte - laut Mark A. Pollack sogar „dramatically\" (Pollack 2000: 519). Er zeigt in seiner Studie unter dem Titel „The End of Creeping Competence?“, dass die Europäische Union mittlerweile „a policy presence in nearly every issue-area of European politics“ (Pollack 2000: 537) aufweist. Auch Ernst Haas hat mit seiner Theorie des Neofunktionalismus „the dynamic process of task expansion in the European Union\" (Pollack nach Haas 1994: 98) erläutert und mit seinem Erklärungsansatz des spill-overs eine Kompetenzerweiterung der EU vorhergesagt. Um eine Asymmetrie zwischen politischer und wirtschaftlicher Integration zu postulieren, ist neben einer Analyse der Breite der Integration vor allem eine Analyse der Tiefe ausschlaggebend. So bedingt zwar eine in der Breite angelegte Politik eine Vertiefung, damit die EU überhaupt tätig werden kann. Doch nur die vertieften, supranationalen Politikbereiche haben für die3 Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht zur Folge, dessen Umsetzung die EU-Kommission und dessen Verstoß der EuGH überprüfen kann.
- III Der vorliegende Essay zeigt auf, dass in den Verträgen von Rom die wirtschaftliche Integration expliziter angelegt ist als die politische. Seitdem ist fast ein halbes Jahrhundert vergangen und der acquis communitaire umfasst mittlerweile „a unique degree of political integration beyond the nation state\" (Börzel 2005: 2). Die Beispiele der Umwelt-, Sozial- und Rechtspolitik belegen, dass der Integrationsstand von Themenbereich zu Themenbereich variiert. Während die Umweltpolitik nun zu großen Teilen auf supranationaler Ebene angesiedelt ist, deren Motoren EU-Kommission und EuGH sind, ist die Sozialpolitik weiterhin eine Domäne der Nationalstaaten. Die Innen- und Rechtspolitik befindet sich auf ihrem Weg zu einem ausdifferenzierten Kompetenzfeld der EU, wobei eine verstärkte supranationale Koordination und Zusammenarbeit erst in den vergangenen zehn Jahren an Tempo und Intensität zugenommen hat. So muss jedes Politikfeld mit der in Breite und Tiefe weit integrierten Wirtschaftspolitik einzeln verglichen werden. Inwieweit dann eine erhebliche oder eher zu vernachlässigende Asymmetrie im Integrationsstand festgestellt werden kann, muss differenziert erörtert werden. Von einer pauschal gültigen Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration kann daher keine Rede sein.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, ob die wirtschaftliche Integration in der Europäischen Union (EU) stärker fortgeschritten ist als die politische Integration. Er analysiert die Argumente, die für eine Asymmetrie zwischen diesen beiden Integrationsebenen sprechen, und beleuchtet die Problematik anhand aktueller Beispiele auf europäischer Ebene.
- Analyse der unterschiedlichen Integrationsgrade von Wirtschafts- und Politikfeldern in der EU
- Untersuchung der historischen Entwicklung der EU-Integration und der Rolle von ökonomischen und politischen Motiven
- Bewertung des Einflusses von Supranationalität und Nationalstaatlichkeit auf die EU-Integration
- Beurteilung der aktuellen Situation und der zukünftigen Perspektiven der EU-Integration
- Auswertung von Beispielen aus verschiedenen Politikbereichen, wie z. B. Umwelt-, Sozial- und Rechtspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die These von Andrew Moravcsik, dass die wirtschaftliche Integration die Hauptmotivation für die Gründung und Entwicklung der EU war. Es werden Argumente für und gegen diese These diskutiert und die Frage aufgeworfen, ob die politische Integration der wirtschaftlichen Integration tatsächlich hinterherhinkt.
Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung der EU-Integration von den Römischen Verträgen bis zum Vertrag von Nizza analysiert. Es wird die zunehmende Breite und Tiefe der EU-Kompetenzen beleuchtet und die Rolle des Neofunktionalismus und des spill-over-Effekts erläutert.
Das dritte Kapitel untersucht die unterschiedlichen Integrationsgrade verschiedener Politikfelder. Die Studie von Tanja A. Börzel, die die Breite und Tiefe der EU-Kompetenzen in verschiedenen Politikbereichen analysiert, wird als Grundlage für die Untersuchung genutzt. Es werden Beispiele aus der Umwelt-, Sozial- und Rechtspolitik herangezogen, um die These der Asymmetrie zu belegen.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Asymmetrie, Wirtschaftliche Integration, Politische Integration, Supranationalität, Nationalstaatlichkeit, Umweltpolitik, Sozialpolitik, Rechtspolitik, Neofunktionalismus, Spill-over, Kompetenzerweiterung, EU-Kommission, EuGH.
Häufig gestellte Fragen
Besteht eine Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration in der EU?
Der Essay zeigt, dass die wirtschaftliche Integration oft expliziter angelegt war, die politische Integration jedoch in Bereichen wie der Umwelt- oder Rechtspolitik stark aufgeholt hat.
Was besagt die Theorie des Neofunktionalismus?
Nach Ernst Haas führt die Integration in einem Sektor (z.B. Wirtschaft) automatisch zu einem "Spill-over" in andere Bereiche, wodurch die Kompetenzen der EU stetig wachsen.
Warum ist die Sozialpolitik weniger integriert als die Wirtschaftspolitik?
Während die Wirtschaftspolitik supranational geregelt ist, bleibt die Sozialpolitik weitgehend eine Domäne der Nationalstaaten, was eine deutliche Asymmetrie im Integrationsstand belegt.
Welche Rolle spielen EU-Kommission und EuGH bei der Integration?
In vertieften, supranationalen Politikbereichen fungieren sie als Motoren, die die Umsetzung von EU-Recht überwachen und Verstöße sanktionieren können.
Ist die wirtschaftliche Motivation laut Moravcsik der Haupttreiber der EU?
Andrew Moravcsik argumentiert, dass die erwarteten ökonomischen Vorteile für Produzenten und Konsumenten stets das primäre Motiv für die europäische Einigung waren.
- Arbeit zitieren
- Tanja Prinz (Autor:in), 2005, Zur Asymmetrie von wirtschaftlicher und politischer Integration in der EU, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54764