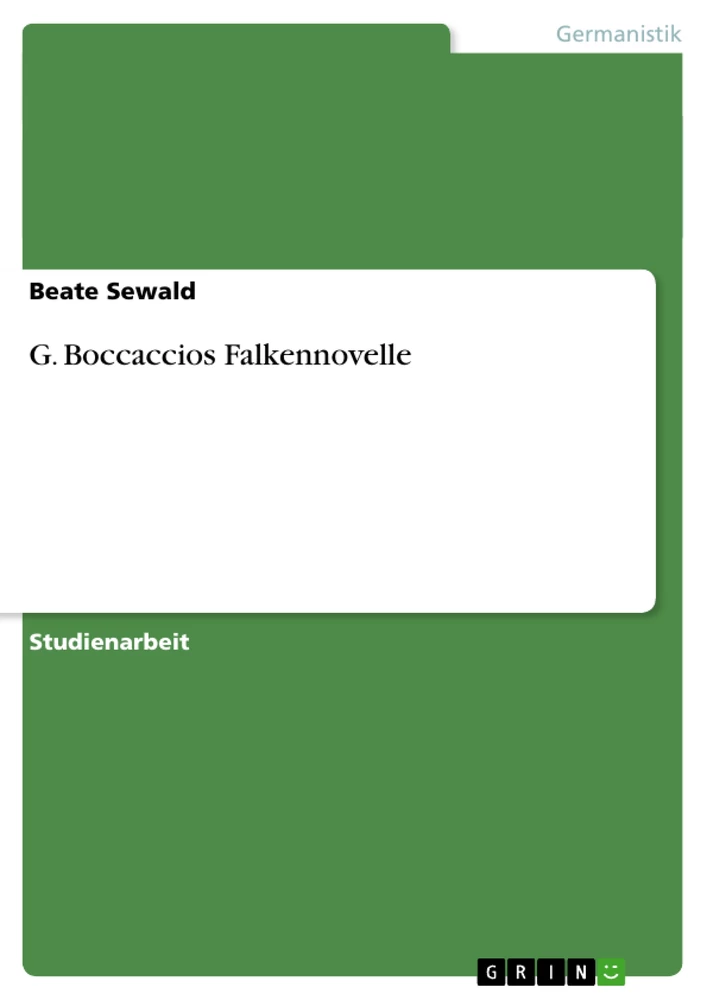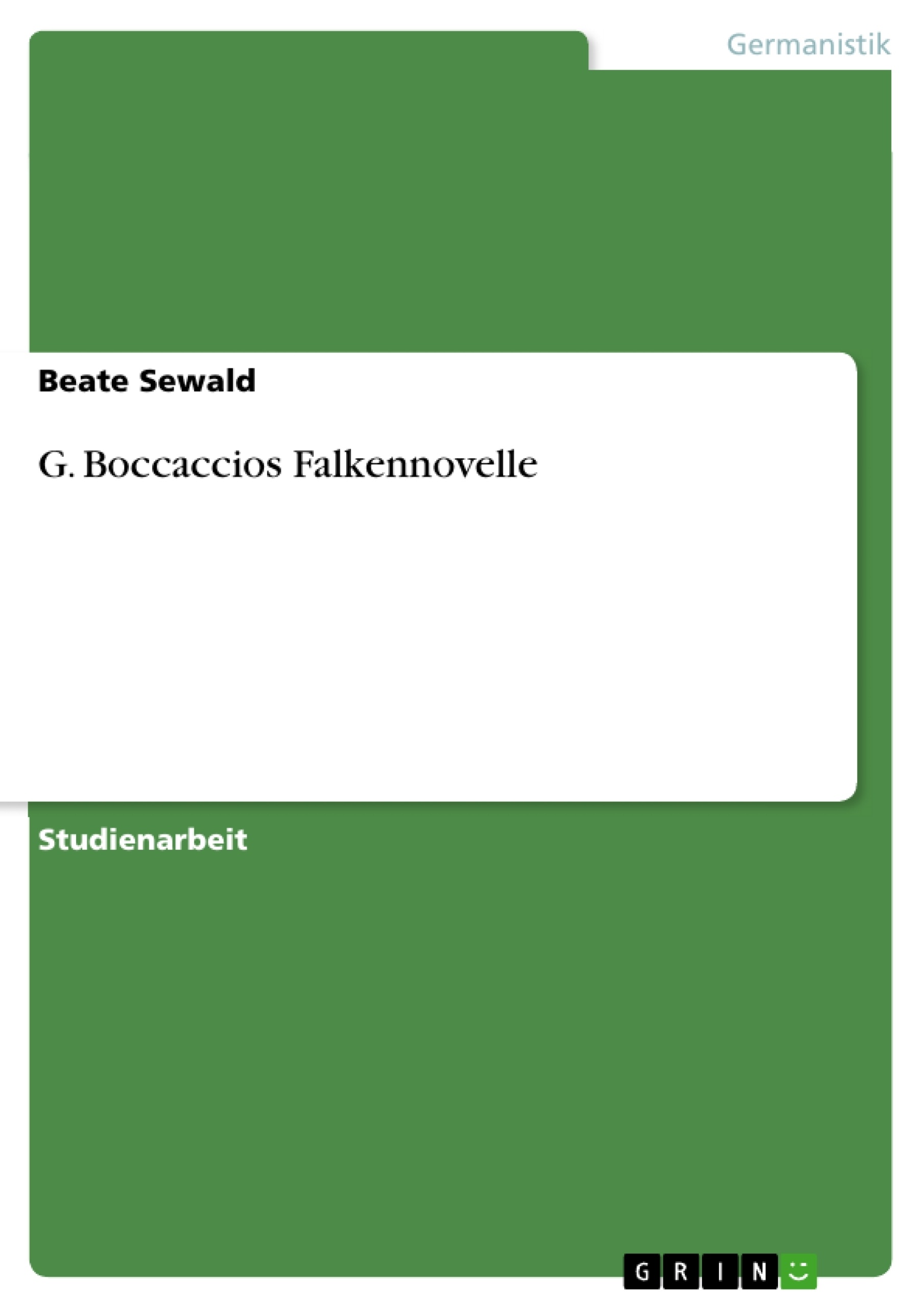Der Begriff ,,Novelle" stammt ursprünglich vom italienischen ,,novella" ab, was soviel bedeutet wie ,,Neuigkeit". Dieses Wort kann wiederum vom lateinischen ,,novellus" abgeleitet werde, was ,,neu" heißt und die Verkleinerungsform von ,,novus" ist. Somit ist eine Novelle eine kleine Neuigkeit, die auf eine Doppeldiminutivform zurückzuführen ist.
Bevor die Bezeichnung jedoch im 13.Jahrhundert einer literarischen Gattung zugeteilt wurde, war die Novelle vor allem im Bereich der Rechtswissenschaften zu finden. So gibt es auch heute noch den Terminus ,,Gesetzesnovelle".1
,,Es ist nicht leicht zu sagen, was eigentlich die Novelle sei, und wie sie sich von den verwandten Gattungen, Roman und Erzählung, unterscheide... Man gibt mit dem Namen bald zu viel, bald zu wenig. Es ist zu viel, wenn man geradezu sagt, die Novelle müsse eine ausgesprochene Tendenz haben, aber doch erwartet man in ihr etwas Hervorspringendes, eine Spitze... Man wird die scharfe, epigrammatische Pointe auch nicht zu sehr herausheben dürfen... Es ist schwer, hier einen allgemeinen Begriff zu finden, auf den sich alle Erscheinungen dieser Art zurückbringen ließen." 2
[...]
_____
1 Thomas Degering, Kurze Geschichte der Novelle: von Boccaccio bis zur Gegenwart. Fink, München,1994, S.7
2 Ebd.
Inhaltsverzeichnis
- Herkunft des Begriffs „Novelle“ und Definitionsproblem der Gattung
- Novellentheorien
- Goethes „unerhörte Begebenheit“
- „Die Schwester des Dramas“
- Die „Falkentheorie“
- Zusammenfassung und Erweiterung der Kennzeichen einer Novelle
- Interpretation der „Falkennovelle“
- Überleitung von der Rahmenhandlung zur eigentlichen Erzählung
- Exposition
- Steigerung zum Höhepunkt
- Höhepunkt bzw. Wendepunkt
- Abfall und Schluss der Novelle
- Das Falkenmotiv
- Der fünfte Tag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Novelle und der Definitionsprobleme dieser Gattung. Es wird untersucht, wie verschiedene Novellentheorien die Novelle charakterisieren und welche Merkmale sie ausmachen. Im Mittelpunkt steht dabei die „Falkennovelle“ von Giovanni Boccaccio, die als Paradebeispiel novellistischen Erzählens gilt. Die Arbeit analysiert die Elemente der „Falkennovelle“ im Kontext der vorgestellten Novellentheorien und untersucht die Bedeutung des „Falkenmotivs“ im Kontext der Erzählung.
- Definition und Merkmale der Novelle
- Novellentheorien von Goethe, Storm und Heyse
- Die „Falkentheorie“ und ihre Relevanz für die „Falkennovelle“
- Die „Falkennovelle“ als Beispiel für novellistischen Erzählens
- Das „Falkenmotiv“ als Leitmotiv und Symbol
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Herkunft des Begriffs „Novelle“ und geht auf die Schwierigkeiten ein, die Gattung eindeutig zu definieren. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze zur Charakterisierung der Novelle vorgestellt.
- Im zweiten Kapitel werden verschiedene Novellentheorien vorgestellt, unter anderem Goethes „unerhörte Begebenheit“, Storms „Schwester des Dramas“ und Heyses „Falkentheorie“. Diese Theorien bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Gattung und ihre Merkmale.
- Das dritte Kapitel widmet sich der „Falkennovelle“ von Giovanni Boccaccio. Es werden die einzelnen Elemente der Erzählung analysiert, wie die Exposition, die Steigerung zum Höhepunkt, der Wendepunkt und der Schluss. Es wird außerdem die Bedeutung des „Falkenmotivs“ im Kontext der Erzählung untersucht.
Schlüsselwörter
Novelle, Gattung, Novellentheorie, „unerhörte Begebenheit“, „Schwester des Dramas“, „Falkentheorie“, Giovanni Boccaccio, „Falkennovelle“, „Falkenmotiv“, Erzählstruktur, Handlungsverlauf, Wendepunkt, Symbol, Leitmotiv.
Häufig gestellte Fragen
Woher stammt der Begriff "Novelle"?
Der Begriff leitet sich vom italienischen "novella" (Neuigkeit) bzw. lateinischen "novellus" (neu) ab und bezeichnete ursprünglich juristische Gesetzesnovellen.
Was besagt Goethes Definition der Novelle?
Goethe definierte die Novelle als eine „sich ereignete unerhörte Begebenheit“.
Was versteht man unter der "Falkentheorie"?
Die Falkentheorie von Paul Heyse besagt, dass eine gute Novelle ein zentrales Symbol oder Motiv (wie den Falken bei Boccaccio) benötigt, das die Handlung zusammenhält.
Welche Strukturmerkmale der Falkennovelle werden analysiert?
Die Arbeit untersucht Exposition, Steigerung, Höhe- bzw. Wendepunkt sowie den Abfall und Schluss der Erzählung.
Warum gilt Boccaccios Werk als Paradebeispiel?
Weil es die klassischen Merkmale der Gattung, wie die Konzentration auf einen Konflikt und eine pointierte Wendung, idealtypisch umsetzt.
- Arbeit zitieren
- Beate Sewald (Autor:in), 2001, G. Boccaccios Falkennovelle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5499