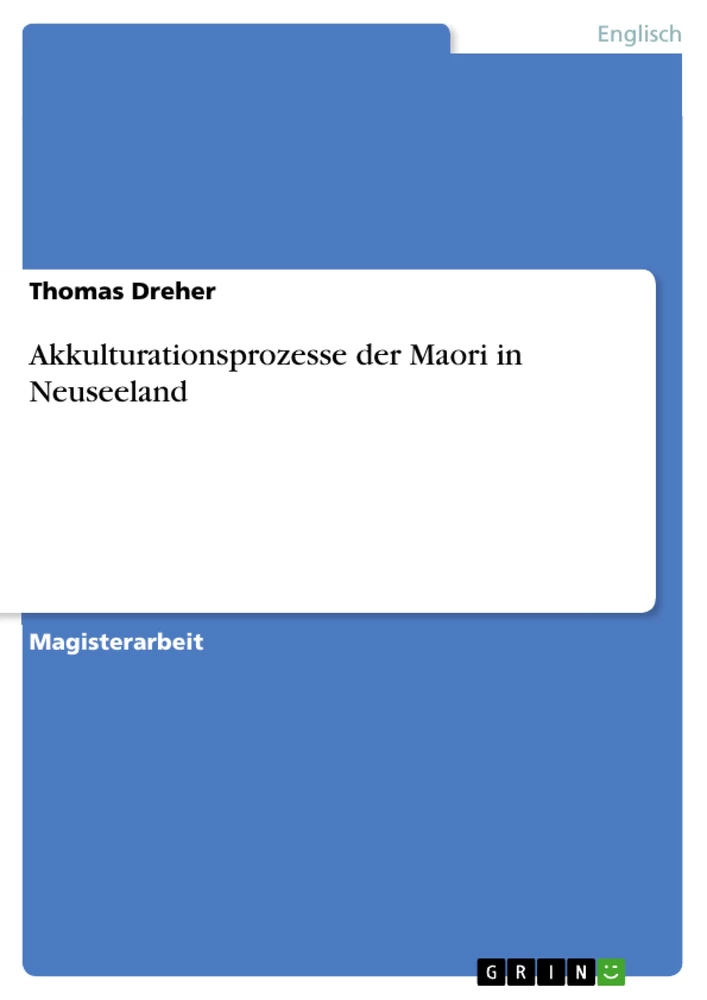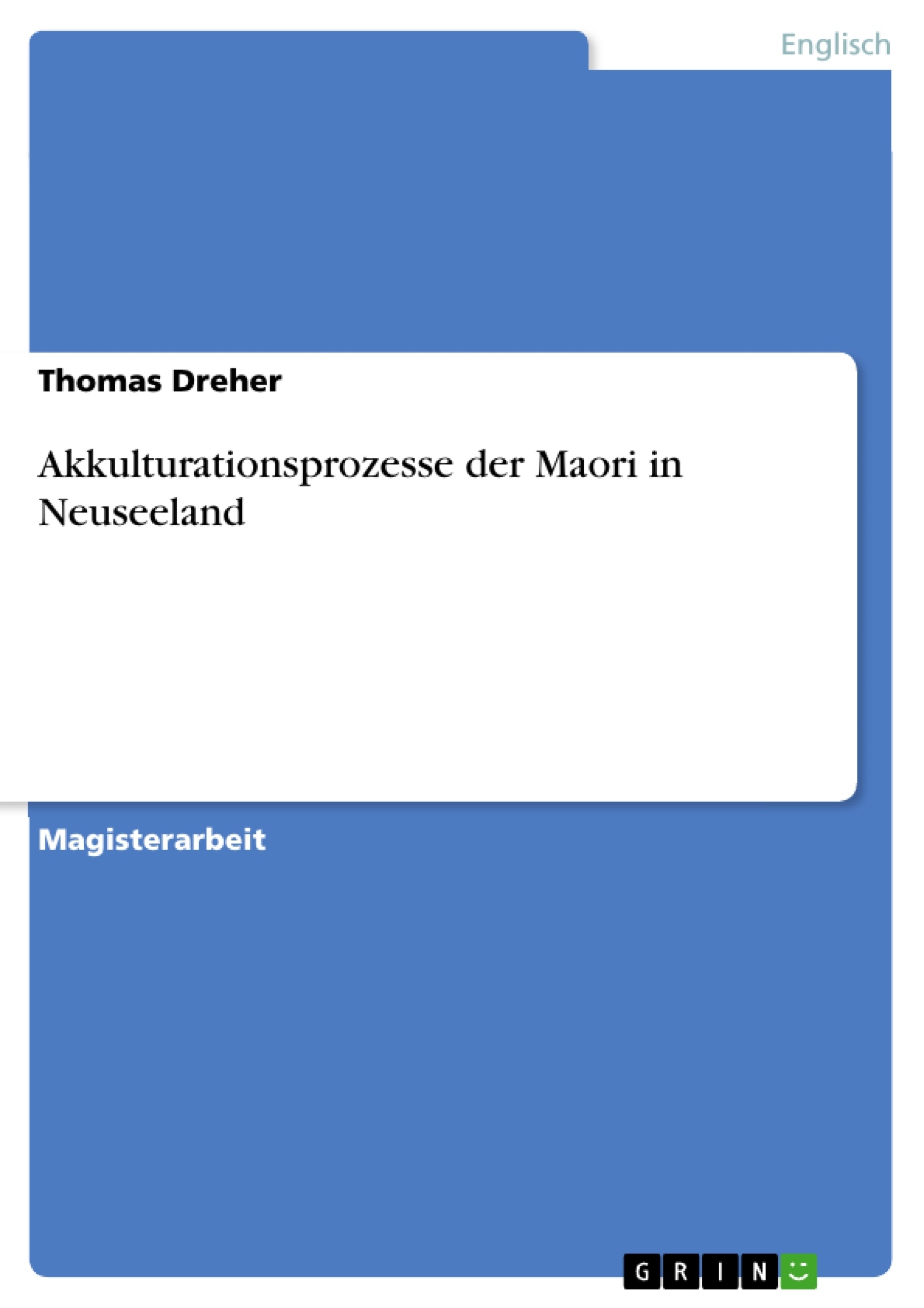Das British Empire galt als das größte seiner Art, das je auf der Welt etabliert
wurde. Auf der Suche nach Einfluss und Herrschaft trafen die Briten, erst als Entdecker,
später als Kolonisatoren, immer wieder auf Kulturen, die zuvor von der europäischen
Zivilisation unberührt geblieben waren. Je nach Zeitgeist wurden die Menschen
dieser Kulturen als Barbaren oder edle Wilde ("noble savage") bezeichnet. Für die Briten
auf ihrer "civilizing mission" (Joseph Chamberlain, 1897) war etwas anderes als die
Missionierung und Zivilisierung, also die rasche Anpassung an die britische oder europäische
Kultur der neu entdeckten Völker, undenkbar. Die Evolutionstheorie von
Charles Darwin, die sich Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend Akzeptanz verschafft
hatte, fügt sich mit dem Postulat des "survival of the fittest" recht nahtlos in diese
Denkweise ein. In abgewandelter Form des Sozialdarwinismus wurde die ursprüngliche
These soweit verfremdet, dass das Recht zu Überleben und sich Durchzusetzen beim
Stärkeren liege, nicht etwa beim am besten an die Umstände Angepassten. Das Anrecht
auf Dominanz einer Kultur war demnach in der technischen Fortschrittlichkeit und militärischen
Macht der Briten begründet, unabhängig von regionalen oder lokalen Besonderheiten.
Diese Ausgangssituation lag auch in Neuseeland vor: wenige Jahrzehnte
nach Ankunft der ersten Missionare und Siedler begannen die Pakeha die Maori in
eine Gesellschaftsform, die im Sinn der europäischen Tradition geformt worden war,
auch durch Druck, einzugliedern.
Wesentliche Elemente der Zivilisierung der "rückständigen" Völker waren der
christliche Glaube und die englische Sprache, da beide eine Schlüsselposition in der
Vermittlung der britisch-europäischen Werte und Kultur insgesamt innehaben. Diese
beiden Faktoren, Religion und Sprache, bilden die zentralen Punkte der vorliegenden
Arbeit. Die nachfolgende These orientiert sich an dieser Vorgabe. Seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts verfolgten die Pakeha eine Politik der
Akkulturation und später der Assimilation, um die Maori in die europäische Kultur einzubinden.
Eine vollständige Assimilation konnte nicht erreicht werden. Heute ist Neuseeland
ein Staat, der zwei Sprachen und zwei Kulturen beherbergt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1. Identität
- 2.2. Kultur
- 2.3. Bikulturalismus
- 2.4. Akkulturation
- 2.5. Assimilation
- 2.6. Sprache
- 2.7. Bilingualismus
- 3. Geschichtlicher Überblick
- 4. Religion
- 4.1. Traditionelle Religion
- 4.1.1. Mana
- 4.1.2. Tapu
- 4.1.3. Noa
- 4.1.4. Atua
- 4.1.5. Weitere Zeremonien
- 4.2. Missionierung und Christianisierung
- 4.3. Gegenbewegungen
- 4.3.1. Die Io Doktrin
- 4.3.2. Pai Marire - Hauhau
- 4.3.3. Ringatu
- 4.3.4. Ratana
- 4.4. Von der Verschmelzung zur Emanzipation
- 4.5. Der Marae-Kirchen-Friedhofskomplex in Maorisiedlungen an der Ostküste
- 4.6. Die Migration der Maori vom Land in die Städte
- 4.7. Auswertung statistischer Daten bezüglich der Religiosität der Maori
- 4.8. Zusammenfassung - Religion
- 4.9. Ausblick - Religion
- 4.1. Traditionelle Religion
- 5. Die Sprache Maori
- 5.1. Linguistische Aspekte
- 5.2. Churchills Sechs-Stufen-Modell
- 5.3. Entwicklung im gesellschaftlichen Kontext
- 5.4. Ansätze zum Erhalt der Sprache
- 5.4.1. Bilinguale Schulausbildung
- 5.4.2. Taha Maori
- 5.4.3. Te Kohanga Reo
- 5.4.4. Te Kura Kaupapa Maori
- 5.4.5. Te Wharekura
- 5.4.6. Te Whare Wananga
- 5.5. Te Reo Maori Claim
- 5.6. Te Reo Maori in der Literatur
- 5.7. Te Reo Maori in den Medien
- 5.7.1. Te Reo Maori im Radio
- 5.7.2. Te Reo Maori im Fernsehen
- 5.8. Auswertung statistischer Daten bezüglich der Sprache Maori
- 5.9. Zusammenfassung - Sprache
- 5.10. Ausblick - Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Akkulturationsprozesse der Maori in Neuseeland, fokussiert auf die Aspekte Religion und Sprache. Ziel ist es, die Veränderungen und Anpassungen der maorischen Kultur in Bezug auf diese beiden zentralen Bereiche zu analysieren und zu beschreiben. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Kolonialisierung und die Reaktionen der Maori darauf.
- Der Einfluss der Missionierung und Christianisierung auf die traditionelle maorische Religion.
- Die Entwicklung und der gegenwärtige Status der maorischen Sprache.
- Strategien zum Erhalt und zur Förderung der maorischen Sprache und Kultur.
- Die Interaktion zwischen traditioneller maorischer Kultur und der eingeführten europäischen Kultur.
- Der Prozess der Anpassung und Identitätsstiftung der Maori im Kontext der Kolonialisierung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Kolonialisierung Neuseelands und die "civilizing mission" der Briten. Sie legt die zentralen Themen der Arbeit – Religion und Sprache der Maori – fest und formuliert die These, dass diese beiden Aspekte Schlüsselrollen im Akkulturationsprozess spielten. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der europäischen Kultur auf die maorische Identität.
2. Definitionen: Dieses Kapitel liefert wichtige Definitionen von Begriffen wie Identität, Kultur, Bikulturalismus, Akkulturation, Assimilation, Sprache und Bilingualismus. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die spätere Analyse der Akkulturationsprozesse der Maori und schaffen ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie. Die klare Abgrenzung der Begriffe ist essentiell für die wissenschaftliche Genauigkeit der Arbeit.
3. Geschichtlicher Überblick: Der geschichtliche Überblick skizziert die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Neuseelands, die für das Verständnis der Akkulturationsprozesse der Maori relevant sind. Dies beinhaltet die Ankunft der europäischen Siedler, die Kolonisierung und die daraus resultierenden Konflikte und Veränderungen in der maorischen Gesellschaft. Dieser Abschnitt liefert den notwendigen historischen Kontext für die folgenden Kapitel.
4. Religion: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Religion der Maori, beginnend mit der traditionellen Religion (Mana, Tapu, Noa, Atua) und den damit verbundenen Zeremonien. Es analysiert im Detail die Auswirkungen der Missionierung und Christianisierung und beschreibt die Entstehung von Gegenbewegungen wie der Io Doktrin, Pai Marire-Hauhau, Ringatu und Ratana als Reaktion auf die europäischen Einflüsse. Die Verschmelzung und spätere Emanzipation der religiösen Praktiken werden untersucht, ebenso wie der Marae-Kirchen-Friedhofskomplex und die Migration in die Städte. Statistische Daten über die Religiosität der Maori werden ausgewertet.
5. Die Sprache Maori: Dieses Kapitel widmet sich der maorischen Sprache, ihren linguistischen Aspekten und Churchills Sechs-Stufen-Modell der Sprachentwicklung. Es analysiert die Entwicklung der Sprache im gesellschaftlichen Kontext und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Erhaltung der Sprache (bilinguale Schulausbildung, Taha Maori, Te Kohanga Reo, Te Kura Kaupapa Maori, Te Wharekura, Te Whare Wananga). Die Bedeutung des "Te Reo Maori Claim", die Rolle der Sprache in Literatur und Medien (Radio und Fernsehen) sowie statistische Daten zur Sprachverwendung werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Akkulturation, Maori, Neuseeland, Religion, Sprache, Kolonialisierung, Identität, Bikulturalismus, Assimilation, Missionierung, Christianisierung, Gegenbewegungen, Sprachbewahrung, Te Reo Maori.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Akkulturationsprozesse der Maori in Neuseeland
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Akkulturationsprozesse der Maori in Neuseeland, mit besonderem Fokus auf die Aspekte Religion und Sprache. Sie analysiert die Veränderungen und Anpassungen der maorischen Kultur in diesen beiden zentralen Bereichen im Kontext der Kolonialisierung und der Reaktionen der Maori darauf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss der Missionierung und Christianisierung auf die traditionelle maorische Religion, die Entwicklung und den gegenwärtigen Status der maorischen Sprache, Strategien zum Erhalt und zur Förderung der maorischen Sprache und Kultur, die Interaktion zwischen traditioneller maorischer Kultur und der eingeführten europäischen Kultur sowie den Prozess der Anpassung und Identitätsstiftung der Maori im Kontext der Kolonialisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Definitionen, 3. Geschichtlicher Überblick, 4. Religion und 5. Die Sprache Maori. Kapitel 2 liefert wichtige Definitionen relevanter Begriffe. Kapitel 3 bietet einen historischen Überblick über die Kolonialisierung Neuseelands. Kapitel 4 analysiert die maorische Religion, von traditionellen Praktiken bis zu modernen Entwicklungen. Kapitel 5 befasst sich umfassend mit der maorischen Sprache, ihren linguistischen Aspekten, ihrer Entwicklung und Strategien zu ihrem Erhalt.
Welche Definitionen werden im zweiten Kapitel behandelt?
Das zweite Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Identität, Kultur, Bikulturalismus, Akkulturation, Assimilation, Sprache und Bilingualismus. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die Analyse der Akkulturationsprozesse der Maori.
Wie wird die Religion der Maori in der Arbeit behandelt?
Kapitel 4 untersucht die traditionelle maorische Religion (Mana, Tapu, Noa, Atua) und deren Zeremonien. Es analysiert die Auswirkungen der Missionierung und Christianisierung, die Entstehung von Gegenbewegungen (Io Doktrin, Pai Marire-Hauhau, Ringatu, Ratana) und die Entwicklung von der Verschmelzung zur Emanzipation religiöser Praktiken. Die Migration der Maori in die Städte und statistische Daten zur Religiosität werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird die maorische Sprache in der Arbeit behandelt?
Kapitel 5 analysiert die maorische Sprache (Te Reo Maori), ihre linguistischen Aspekte und Churchills Sechs-Stufen-Modell der Sprachentwicklung. Es beleuchtet die Entwicklung der Sprache im gesellschaftlichen Kontext und verschiedene Ansätze zur Sprachbewahrung (bilinguale Schulausbildung, Taha Maori, Te Kohanga Reo, Te Kura Kaupapa Maori, Te Wharekura, Te Whare Wananga). Die Rolle der Sprache in Literatur und Medien sowie statistische Daten zur Sprachverwendung werden ebenfalls behandelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Akkulturation, Maori, Neuseeland, Religion, Sprache, Kolonialisierung, Identität, Bikulturalismus, Assimilation, Missionierung, Christianisierung, Gegenbewegungen, Sprachbewahrung, Te Reo Maori.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Veränderungen und Anpassungen der maorischen Kultur in Bezug auf Religion und Sprache. Ziel ist es, die Auswirkungen der Kolonialisierung und die Reaktionen der Maori darauf zu analysieren und zu beschreiben, um den Akkulturationsprozess zu verstehen.
Welche These wird in der Arbeit aufgestellt?
Die Arbeit geht davon aus, dass Religion und Sprache Schlüsselrollen im Akkulturationsprozess der Maori spielten und maßgeblich von der europäischen Kultur beeinflusst wurden, wobei die Auswirkungen auf die maorische Identität im Mittelpunkt stehen.
- Quote paper
- Thomas Dreher (Author), 2005, Akkulturationsprozesse der Maori in Neuseeland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55013