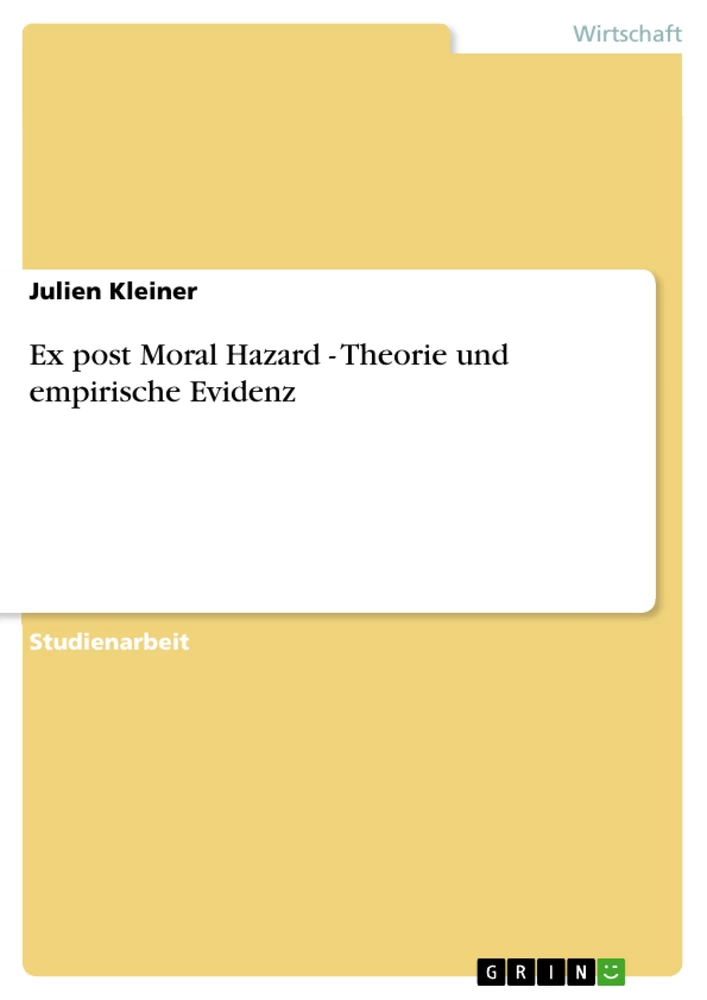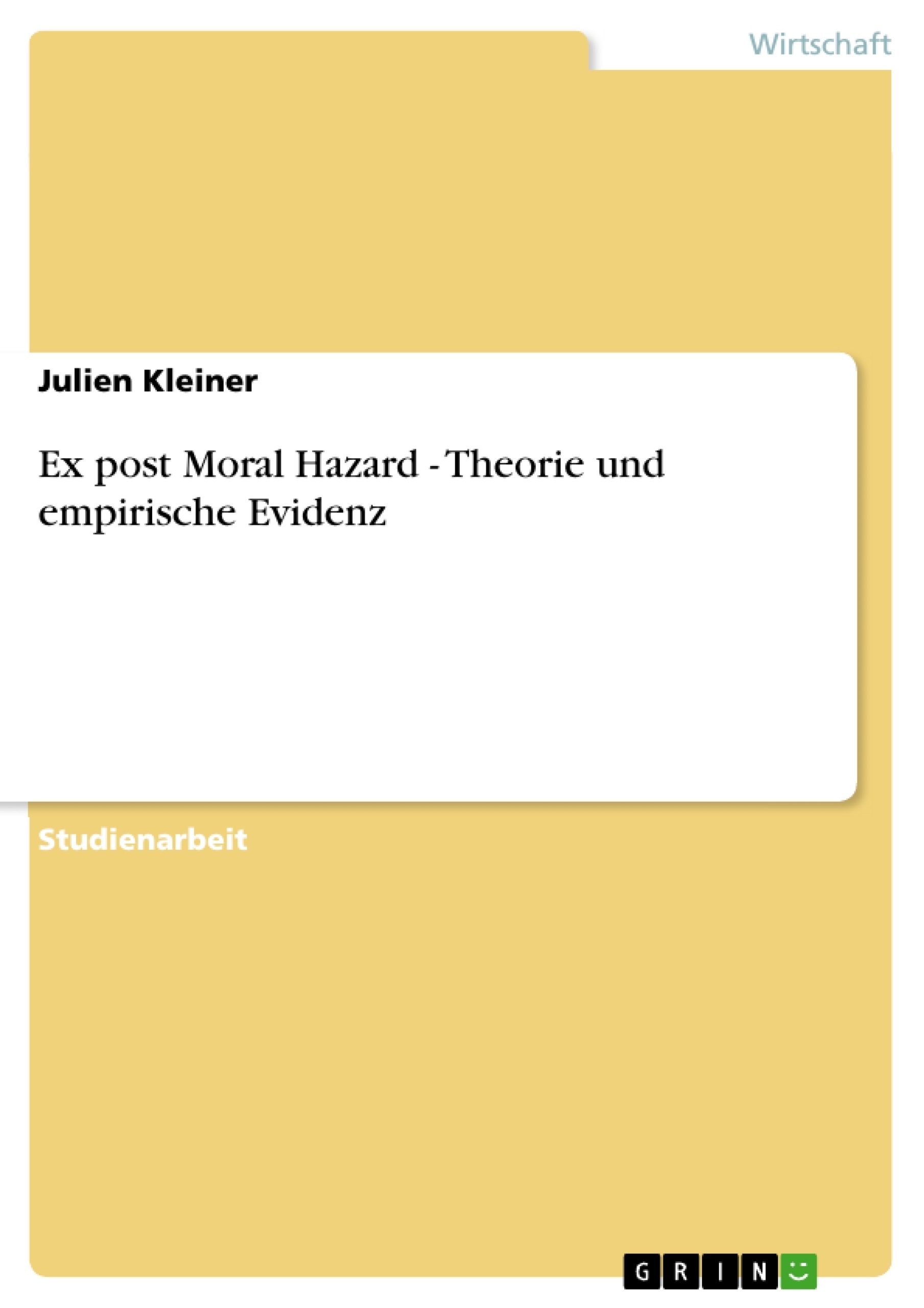Asymmetrische Information zwischen Versicherungsunternehmen (VU) und Versicherungsnehmern
(VN) ist in weiten Teilen der Versicherungswirtschaft ein bedeutendes
Thema, da hierdurch problematische Verhaltensanreize für VN entstehen können.
Asymmetrische Information kann dabei als Spielfeld eines potentiellen Spannungsverhältnisses
zwischen den beteiligten Vertragspartnern bezeichnet werden. Innerhalb dieses
Spannungsverhältnisses werden die VU auch durch ex post moralisches Risiko immer
wieder mit Forderungen nach Versicherungsleistungen konfrontiert, denen eigentlich
kein entsprechend versicherter Schaden gegenübersteht. In einer Untersuchung
zum Thema Versicherungsbetrug in einem amerikanischen Kfz-Versicherungsmarkt
wird das Ausmaß des generellen Problems betrügerischer Ansprüche deutlich:
Es wurde herausgefunden, dass 10 % der Schadenmeldungen betrügerische Ansprüche
zu Grunde liegen und fast 40 % der Reparaturrechnungen von 18-34 jährigen um rund
50 % überhöht sind.
Im Folgenden soll daher ex post moralisches Risiko grundsätzlich erläutert und die Anreizwirkung
hierdurch aufgezeigt werden. Eine empirische Untersuchung soll zudem
darstellen, inwiefern ex post moralisches Risiko zu betrügerischen Ansprüchen tatsächlich
beiträgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung und Motivation
- 2. Ex post moralisches Risiko in theoretischer Betrachtung
- 2.1 Einordnung und Bestimmung des ex post moralischen Risikos
- 2.2 Ursachen und Wirkungen ex post moralischen Risikos
- 2.3 Optimale Versicherungsverträge bei ex post moralischem Risiko
- 2.3.1 Versicherer kann exogenes Risiko beobachten
- 2.3.2 Versicherer kann exogenes Risiko nicht beobachten
- 3. Praktische Relevanz
- 3.1 Betroffene Versicherungsbereiche
- 3.2 Empirische Untersuchung von Dionne und St-Michel
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das ex post moralische Risiko im Versicherungswesen. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen und die praktische Relevanz dieses Phänomens. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Anreizwirkungen, die durch die asymmetrische Informationsverteilung zwischen Versicherungsnehmern und -unternehmen entstehen.
- Theoretische Einordnung und Bestimmung des ex post moralischen Risikos
- Ursachen und Folgen ex post moralischen Risikos
- Optimale Versicherungsverträge unter Berücksichtigung des ex post moralischen Risikos
- Praktische Relevanz in verschiedenen Versicherungsbereichen
- Auswertung empirischer Studien zum Thema Versicherungsbetrug
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Motivation: Das Kapitel führt in die Thematik des ex post moralischen Risikos ein und betont die Bedeutung asymmetrischer Information im Versicherungswesen. Es wird deutlich gemacht, dass diese Informationsasymmetrie zu problematischen Verhaltensanreizen bei Versicherungsnehmern führt, was zu betrügerischen Ansprüchen führen kann. Ein Beispiel aus dem amerikanischen Kfz-Versicherungsmarkt wird angeführt, welches das Ausmaß von Versicherungsbetrug verdeutlicht (10% betrügerische Schadenmeldungen, 40% überhöhte Reparaturrechnungen bei 18-34 Jährigen). Das Kapitel legt den Fokus auf die Notwendigkeit, ex post moralisches Risiko zu verstehen und dessen Auswirkungen zu analysieren.
2. Ex post moralisches Risiko in theoretischer Betrachtung: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung des ex post moralischen Risikos. Es wird als Unterpunkt asymmetrischer Information in Prinzipal-Agenten-Situationen eingeordnet. Die zentrale Problematik ist die Nicht-Beobachtbarkeit des Verhaltens des Versicherungsnehmers nach Vertragsabschluss, was zu Anreizen für opportunistisches Verhalten führt. Das Kapitel erklärt, wie Versicherungsnehmer die Schadenhöhe beeinflussen können, ohne dass der Versicherer dieses Verhalten beobachten kann. Der Fokus liegt darauf, wie diese Informationsasymmetrie zu einem geringeren Sorgfaltsniveau beim Versicherungsnehmer und einem erhöhten Erwartungsschaden für den Versicherer führt. Der Begriff des moralischen Risikos im Sinne von Arrow wird hier im Kontext erläutert, wobei sich das ex post moralische Risiko speziell auf den Handlungsspielraum nach Eintritt des Schadens bezieht.
3. Praktische Relevanz: Dieses Kapitel beleuchtet die praktische Relevanz des ex post moralischen Risikos. Es werden verschiedene Versicherungsbereiche genannt, die von dieser Problematik betroffen sind. Ein wichtiger Teil dieses Kapitels besteht aus der Darstellung und Diskussion einer empirischen Untersuchung von Dionne und St-Michel. Diese Untersuchung analysiert vermutlich die Auswirkungen des ex post moralischen Risikos auf die Höhe der Versicherungsansprüche und liefert somit empirische Evidenz für die theoretischen Überlegungen aus den vorangegangenen Kapiteln. Der Fokus liegt auf der konkreten Anwendung der theoretischen Konzepte in realen Versicherungssituationen und der Interpretation empirischer Befunde.
Schlüsselwörter
Ex post moralisches Risiko, Asymmetrische Information, Versicherungsvertrag, Versicherungsnehmer, Versicherungsbetrug, Anreizwirkungen, Optimale Verträge, Empirische Evidenz, Informationsasymmetrie, Sorgfaltsniveau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ex post moralisches Risiko im Versicherungswesen"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem ex post moralischen Risiko im Versicherungswesen. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen und die praktische Relevanz dieses Phänomens, mit besonderem Fokus auf die Anreizwirkungen asymmetrischer Informationsverteilung zwischen Versicherungsnehmern und -unternehmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretische Einordnung und Bestimmung des ex post moralischen Risikos, die Ursachen und Folgen, optimale Versicherungsverträge unter Berücksichtigung dieses Risikos, die praktische Relevanz in verschiedenen Versicherungsbereichen und die Auswertung empirischer Studien zum Thema Versicherungsbetrug. Ein Beispiel aus dem amerikanischen Kfz-Versicherungsmarkt (10% betrügerische Schadenmeldungen, 40% überhöhte Reparaturrechnungen bei 18-34 Jährigen) veranschaulicht das Ausmaß des Problems.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit der Untersuchung. Kapitel 2 behandelt die theoretische Fundierung des ex post moralischen Risikos im Kontext asymmetrischer Information und Prinzipal-Agenten-Situationen. Kapitel 3 beleuchtet die praktische Relevanz anhand verschiedener Versicherungsbereiche und einer empirischen Untersuchung von Dionne und St-Michel. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Was ist ex post moralisches Risiko?
Ex post moralisches Risiko ist ein Unterpunkt asymmetrischer Information in Prinzipal-Agenten-Situationen im Versicherungswesen. Es beschreibt die Situation, in der der Versicherungsnehmer nach Eintritt des Schadens die Schadenhöhe beeinflussen kann, ohne dass der Versicherer dieses Verhalten beobachten kann. Dies führt zu Anreizen für opportunistisches Verhalten, geringeres Sorgfaltsniveau beim Versicherungsnehmer und erhöhten Erwartungsschäden für den Versicherer. Es bezieht sich speziell auf den Handlungsspielraum *nach* Eintritt des Schadens.
Welche Rolle spielt asymmetrische Information?
Asymmetrische Information ist die zentrale Problematik. Die Nicht-Beobachtbarkeit des Verhaltens des Versicherungsnehmers nach Vertragsabschluss (ex post) führt zu Anreizen für opportunistisches Verhalten. Die Arbeit analysiert, wie diese Informationsasymmetrie zu einem geringeren Sorgfaltsniveau beim Versicherungsnehmer und einem erhöhten Erwartungsschaden für den Versicherer führt.
Welche Versicherungsbereiche sind betroffen?
Die Arbeit nennt verschiedene Versicherungsbereiche, die vom ex post moralischen Risiko betroffen sind, jedoch ohne konkrete Beispiele zu nennen. Die empirische Studie von Dionne und St-Michel liefert jedoch wahrscheinlich konkrete Einblicke in betroffene Bereiche.
Welche empirische Studie wird diskutiert?
Die Arbeit diskutiert eine empirische Untersuchung von Dionne und St-Michel, die vermutlich die Auswirkungen des ex post moralischen Risikos auf die Höhe der Versicherungsansprüche analysiert und empirische Evidenz für die theoretischen Überlegungen liefert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Ex post moralisches Risiko, Asymmetrische Information, Versicherungsvertrag, Versicherungsnehmer, Versicherungsbetrug, Anreizwirkungen, Optimale Verträge, Empirische Evidenz, Informationsasymmetrie, Sorgfaltsniveau.
- Arbeit zitieren
- Julien Kleiner (Autor:in), 2005, Ex post Moral Hazard - Theorie und empirische Evidenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55085