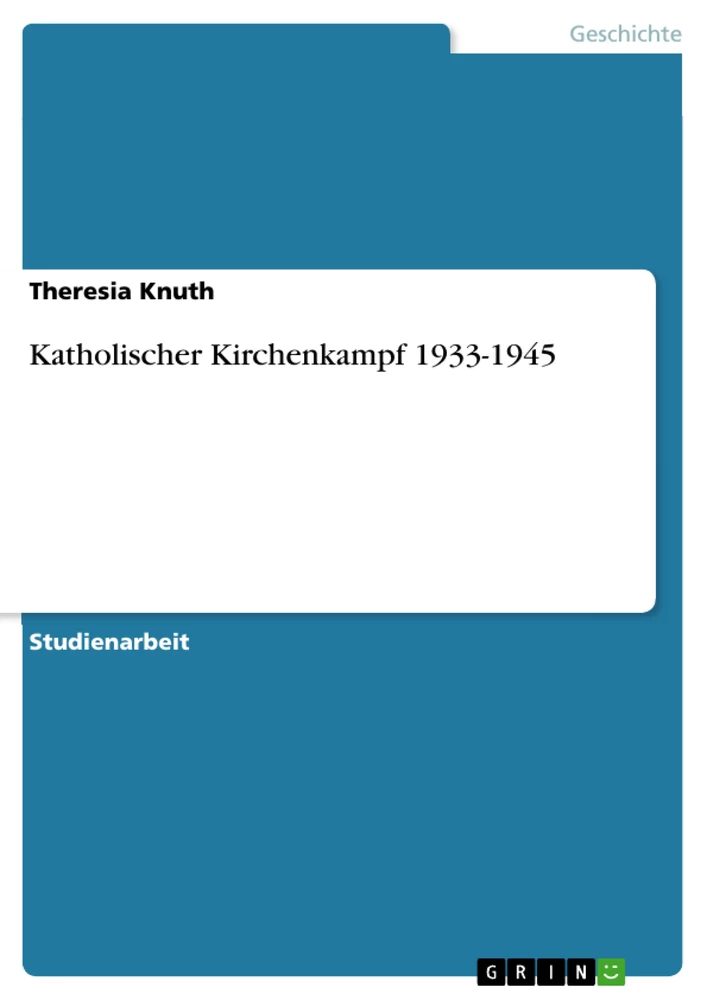[...] Zur Untersuchung des Verhaltens der katholischen Kirche im Dritten Reich
bietet sich eine chronologische Betrachtung an. Entsprechend beginne ich mit
einer kurzen Darstellung der Position der Kirche vor 1933, denn schon in der
Weimarer Republik setzte sie sich mit dem Nationalsozialismus auseinander,
wobei wegweisende Positionen begründet wurden. Im Hauptteil wird zunächst das
Jahr 1933 ausführlicher betrachtet, da entscheidende Grundlagen für den Umgang
mit dem Regime herausgebildet wurden und eine Verhaltensänderung stattfand.
Anschließend rücken die Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in den
Mittelpunkt, sie waren geprägt vom totalitären Verfügungsanspruch und konkreten
Unterdrückungs- und Verdrängungsversuchen durch das Hitler-Regime. Die
Darstellung des Verhaltens der Kirche im Zweiten Weltkrieg schließt sich an.
Abschließend wird der Widerstand von einzelnen Katholiken und katholischen
Gruppen thematisiert, bevor in einer Schlussbetrachtung die Ergebnisse
zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Position vor 1933
- Katholische Kirche im Nationalsozialismus
- Positionierung und Reichskonkordat 1933
- Verdrängung und Reaktion
- Die Kirche im Zweiten Weltkrieg
- Widerstand von Gruppen und Einzelnen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Strukturpapier bietet einen Überblick über das Verhalten der katholischen Kirche während der nationalsozialistischen Herrschaft von 1933 bis 1945. Der Fokus liegt auf der Herausforderungen, denen die Kirche im Umgang mit dem totalitären Regime gegenüberstand und auf der Frage, wie sie die NS-Herrschaft als gesellschaftliche Großgruppe¹ überstanden hat.
- Die Positionierung der katholischen Kirche vor 1933 und die ersten Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus
- Die Bedeutung des Reichskonkordats von 1933 und die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Kirche und Staat
- Die Verdrängungs- und Unterdrückungsversuche des NS-Regimes gegenüber der katholischen Kirche
- Die Rolle der katholischen Kirche während des Zweiten Weltkriegs und die unterschiedlichen Formen des Widerstands
- Die Debatte über die Rolle der katholischen Kirche während des Dritten Reiches und die Kontroversen um ihre Positionierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine Einführung in die Thematik und stellt die Forschungsfrage nach dem Verhalten der katholischen Kirche im Dritten Reich dar.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Position der Kirche vor 1933, insbesondere die ersten Begegnungen mit dem Nationalsozialismus und die Herausforderungen, die sich aus der NS-Ideologie für die katholische Kirche ergaben.
Das dritte Kapitel widmet sich der katholischen Kirche im Nationalsozialismus. Es untersucht die Positionierung der Kirche im Jahr 1933, die Bedeutung des Reichskonkordats und die sich daraus entwickelnden Beziehungen zum Regime. Weiterhin werden die Verdrängungs- und Unterdrückungsversuche des NS-Regimes gegenüber der Kirche beleuchtet sowie die Rolle der Kirche im Zweiten Weltkrieg dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieses Strukturpapiers sind: katholische Kirche, Nationalsozialismus, Reichskonkordat, Verdrängung, Unterdrückung, Widerstand, Kirchenkampf, totalitäres Regime, gesellschaftliche Großgruppe, Kontroversen, Historiographie.
Häufig gestellte Fragen
Wie verhielt sich die katholische Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus?
Die Arbeit untersucht die chronologische Entwicklung vom Widerstand in der Weimarer Republik bis hin zur Verhaltensänderung und dem Reichskonkordat 1933.
Was war die Bedeutung des Reichskonkordats von 1933?
Es legte die rechtlichen Grundlagen für das Verhältnis zwischen der Kirche und dem NS-Staat fest und wird als entscheidender Wendepunkt analysiert.
Gab es aktiven Widerstand aus katholischen Kreisen?
Ja, das Strukturpapier thematisiert den Widerstand sowohl von einzelnen Katholiken als auch von organisierten katholischen Gruppen.
Wie änderte sich die Situation während des Zweiten Weltkriegs?
Die Jahre des Krieges waren geprägt von totalitären Unterdrückungsversuchen durch das Regime und einer schwierigen Positionierung der Kirche.
Was ist das Ziel dieses Strukturpapiers?
Es soll einen Überblick über die Herausforderungen geben, denen die Kirche als gesellschaftliche Großgruppe im totalitären System gegenüberstand.
- Quote paper
- Theresia Knuth (Author), 2006, Katholischer Kirchenkampf 1933-1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55100