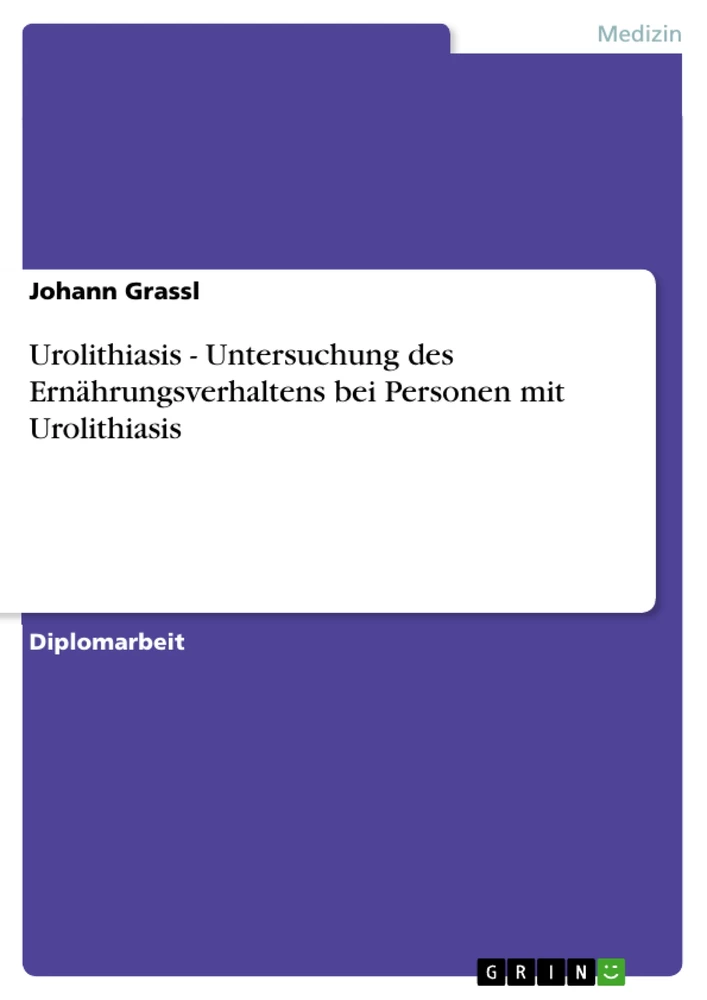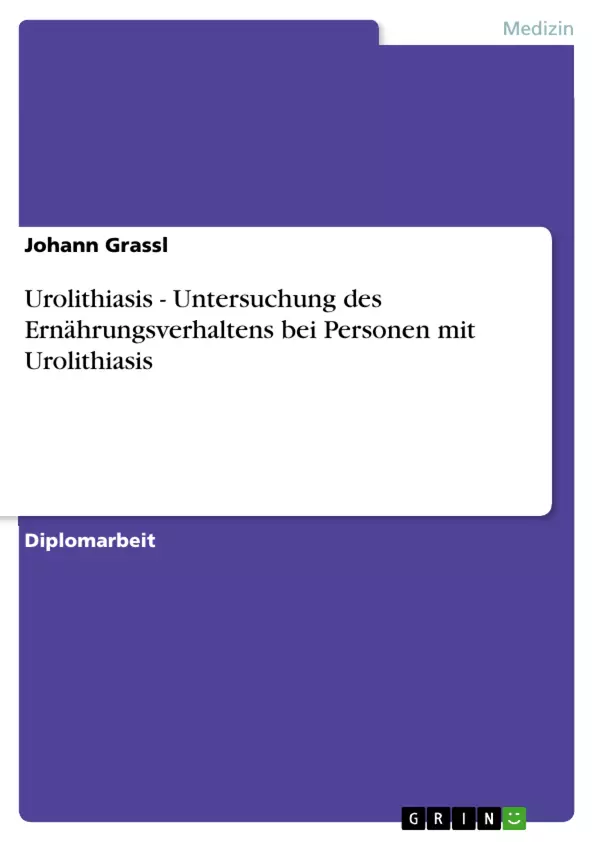UROLITHIASIS
Untersuchung des Ernährungsverhaltens bei Personen mit Urolithiasis am Beispiel von Patienten des Allgemein Öffentlichen Krankenhauses der Landeshauptstadt St. Pölten.
Urolithiasis ist eine Erkrankung, die bereits seit dem Altertum bekannt ist. Schon in ägyptischen Mumien konnten Nieren- und Blasensteine nachgewiesen werden. Seit den letzten 25 Jahren tritt das Harnsteinleiden immer öfter auf. Am häufigsten sind Erwachsene im Alter zwischen dem 30sten und 50sten Lebensjahr betroffen. 50% aller Steinpatienten sind Rezidivbildner. Die alleinige Therapie durch Harnsteinzertrümmerung, Auflösung, Extraktion oder operative Entfernung ist daher nicht genug.
Um Urolithiasis wirksam behandeln zu können, muss mehr Wert auf Steinverhütung bzw. Steinprophylaxe gelegt werden. Eine Heilung des Steinleidens durch Diät ist nicht möglich. Mittels Steinanalyse und Kenntnis der Steinpathogenese ist es durch gezielte diätetische Maßnahmen möglich, eine erneute Steinbildung zu verzögern oder zu verhindern. Durch konsequente Anwendung prophylaktischer Maßnahmen lässt sich die Rezidivrate von 50% auf 10% senken.
Im ersten Teil der Arbeit werden Entstehung und Behandlung von Harnsteinen sowie die Prophylaxemöglichkeiten beschrieben. Im zweiten Teil wird mittels Fragebogen und anhand von Laborparametern das Ernährungsverhalten, Schlafgewohnheiten, Freizeitverhalten und das Ernährungswissen von Harnsteinpatienten, des A. Ö. Krankenhauses St. Pölten, überprüft.
In der Arbeit werden folgende Fragen analysiert und diskutiert:
Sind Harnsteinpatienten übergewichtig?
Essen Harnsteinpatienten, deren Harn-pH zu sauer ist, zu viel tierisches Eiweiß?
Trinken Harnsteinpatienten zu wenig?
Gibt es Zusammenhänge zwischen der Lokalisation von Harnsteinen und der bevorzugten Schlafposition?
Wie gut ist der Wissensstand von Harnsteinpatienten im Bezug auf notwendige Ernährungsmaßnahmen?
Das Datenmaterial wurde computerunterstützt ausgewertet. Hypothesen wurden mittels Konfidenzintervall oder Chi-Quadrat Test überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Harntrakt - Lage und Anatomie
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Die Niere
- 2.2.1. Nierenrinde
- 2.2.2. Nierenmark und Nierenbecken
- 2.2.3. Das Nephron
- 2.3. Ableitende Harnwege
- 3. Der Harn
- 3.1. Entstehung des Harns
- 3.2. Zusammensetzung des gesunden Harns
- 4. Harnsteine
- 4.1. Einteilung
- 4.1.1. Einteilung aufgrund der Zusammensetzung, Morphologie und Häufigkeit verschiedener Steintypen
- 4.1.2. Einteilung aufgrund der Lokalisation
- 4.2. Ursachen der Harnsteinentstehung
- 4.2.1. Theorien der Harnsteinbildung
- 4.2.2. Fördernde und hemmende Steinbildungsfaktoren
- 4.3. Einflussfaktoren, Ernährungstherapie und Prophylaxe für verschiedene Steintypen
- 4.3.1. Allgemeines
- 4.3.2. Verschiedene Steinarten
- 4.4. Diagnoseverfahren
- 4.5. Therapie
- 4.1. Einteilung
- 5. Empirische Arbeit
- 5.1. Fragestellung der Arbeit
- 5.2. Studiendesign
- 5.2.1. Auswahl der Probanden
- 5.2.2. Erhebungsmethode
- 5.2.3. Stichprobengröße und Altersverteilung
- 5.2.4. Datenauswertung
- 5.3. Hypothesen und ihre Ergebnisse
- 5.3.1. Hypothese A, Harnsteinpatienten sind übergewichtig
- 5.3.2. Hypothese B, Ernährungsverhalten von Steinpatienten
- 5.3.3. Hypothese C, Flüssigkeitszufuhr
- 5.3.4. Hypothese D, Harnsteinlokalisation
- 5.4. Weitere Ergebnisse
- 5.4.1. Familienbelastung
- 5.4.2. Rezidivsteinbildner
- 5.4.3. Informationsgrad der Probanden
- 5.4.4. Trinkverhalten
- 5.4.5. Nahrungsmittelverzehr und Diät
- 5.4.6. Sport
- 5.4.7. Harnwerte
- 5.4.8. Serumwerte
- 5.5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 5.6. Empfehlungen
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Ernährungsverhalten von Personen mit Urolithiasis. Die Arbeit analysiert die Ernährungsgewohnheiten und die Flüssigkeitszufuhr von Patienten, die im Allgemeinen Öffentlichen Krankenhaus der Landeshauptstadt St. Pölten behandelt werden. Die Studie zielt darauf ab, die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme und der Entstehung von Nierensteinen aufzuzeigen.
- Ernährungsgewohnheiten von Personen mit Urolithiasis
- Zusammenhang zwischen Ernährung und der Entstehung von Nierensteinen
- Flüssigkeitsaufnahme bei Harnsteinpatienten
- Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Nierensteinen
- Prophylaxe und Therapie von Urolithiasis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Urolithiasis vor und skizziert die Relevanz der Arbeit. Sie liefert einen kurzen Überblick über die Häufigkeit, die Ursachen und die Folgen von Nierensteinen.
- Kapitel 2: Harntrakt - Lage und Anatomie: Dieses Kapitel beschreibt die Anatomie und Physiologie des Harntrakts, insbesondere der Nieren. Es erklärt die Entstehung des Urins und die Funktion der verschiedenen Organe.
- Kapitel 3: Der Harn: Dieses Kapitel befasst sich mit der Zusammensetzung des Harns und erklärt, wie er entsteht.
- Kapitel 4: Harnsteine: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Arten von Harnsteinen, ihre Entstehung, Ursachen und Risikofaktoren. Es beleuchtet auch die verschiedenen Möglichkeiten der Diagnose und Therapie von Nierensteinen.
- Kapitel 5: Empirische Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik der Arbeit. Es erläutert die Auswahl der Probanden, die Erhebungsmethoden, die Datenauswertung und die Hypothesen, die in der Studie untersucht werden.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Urolithiasis und konzentriert sich auf das Ernährungsverhalten von Patienten mit Nierensteinen. Die Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme und der Entstehung von Nierensteinen. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Urolithiasis, Nierensteine, Ernährung, Ernährungsverhalten, Flüssigkeitszufuhr, Harnsäure, Oxalat, Calcium, Prophylaxe, Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Urolithiasis?
Urolithiasis bezeichnet die Bildung von Harnsteinen (Nieren- oder Blasensteine) im Harntrakt, eine Erkrankung, die seit dem Altertum bekannt ist und heute immer häufiger auftritt.
Kann man Nierensteine durch die Ernährung verhindern?
Ja, durch gezielte diätetische Maßnahmen und eine konsequente Steinprophylaxe lässt sich die Rezidivrate (Rückfallquote) von 50 % auf etwa 10 % senken.
Welchen Einfluss hat die Flüssigkeitszufuhr auf Harnsteine?
Eine ausreichende Trinkmenge ist der wichtigste Faktor der Prophylaxe, da sie den Urin verdünnt und die Konzentration steinbildender Substanzen senkt.
Sind Harnsteinpatienten häufig übergewichtig?
Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen BMI und Steinbildung. Übergewicht gilt als Risikofaktor, da es oft mit einer Ernährung einhergeht, die die Steinbildung fördert.
Spielt die Schlafposition eine Rolle bei Nierensteinen?
Die Arbeit analysiert die interessante Hypothese, ob es einen Zusammenhang zwischen der bevorzugten Schlafseite und der Lokalisation der Steine im Harntrakt gibt.
- Citation du texte
- Johann Grassl (Auteur), 2002, Urolithiasis - Untersuchung des Ernährungsverhaltens bei Personen mit Urolithiasis , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55102