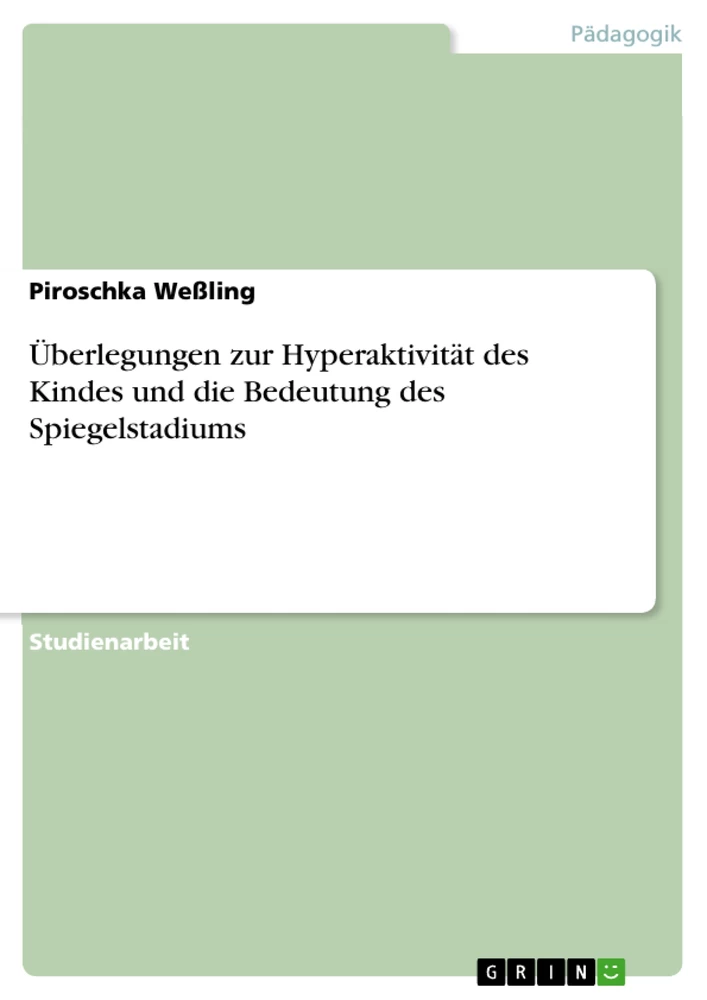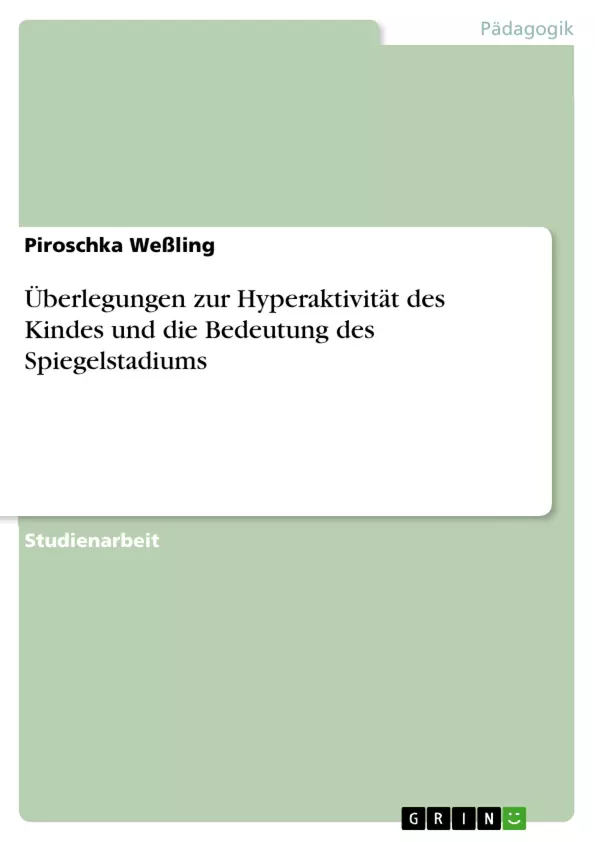„Spieglein,Spieglein an der Wand,wer ist die Schönste im ganzen Land?“Dann antwortet der Spiegel:„Frau Königin,ihr seid die schönste hier,aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr!“
Nicht nur in Märchen kommt Spiegeln eine große Faszination zu;daran hat sich seit Jahrtausenden nichts geändert.Bei Schneewittchen erscheint der Spiegel als Ort der Wahrheit.Er gibt Auskunft darüber,wer die Schönste im Lande sei. Ein eigenartiges Paradox zeigt sich:Der Spiegel verrät die Wahrheit nicht durch das Bild,sondern er verkündet sie durch die Stimme.Betrachten wir den gewöhnlichen Spiegel;auch er zeigt Merkwürdigkeiten.Da ist die Vertauschung von links nach rechts.Das weckt immer wieder Zweifel daran,ob das Spiegelbild die Gestalt des Betrachters wirklich so zeigt,wie er ist–ein Zweifel,der dazu führen kann,das Spiegelbild nochmals zu spiegeln und damit die Vertauschung aufzuheben.Gewöhnlich sagt man,man sehe sich im Spiegel.Sieht man sich wirklich?Oder nur die Vorderseite der eigenen Gestalt?Hinzu kommen weitere Ursachen der Verwirrung: Nicht jeder Spiegel ist gleich wie der andere.Die eigene Gestalt erscheint auf Wasseroberflächen,in ebenen und gekrümmten Spiegel oder im Auge des Gegen-über in unterschiedlicher Form,so dass der Zusammenhang von Spiegelbild und Objektivität nicht ohne weiteres evident ist.Schließlich erstaunt der Reiz von Idealität,Makellosigkeit, der vom Spiegelbild ausstrahlt!Auch in der Psychoanalyse,deren Aufmerksamkeit dem gilt,was man Seelisches nennt,sind diese Erfahrungen aufgenommen worden: Schon das Wort „Seele“ weckt Assoziationen zu See,damit auch zu Spiegel,Oberfläche und Tiefe.Schon S. Freud,hat in ein überlieferten Mythos,in dem sich der Held in sein Spiegelbild im Wasser verliebt: Narzißmus,gesprochen. Liest man Freuds Werke,stößt man nicht nur in der Arbeit,die er mit „Zur Einführung des Narzißmus“ betitelt hat, auf Spiegelmetaphern. Dennoch hat Freud nicht von einen Spiegelstadium gesprochen und seine Beobachtungen und Gedanken dazu nicht systematisiert.Anders verhält es sich bei Lacan,der in bezug auf diese Thematik Freuds Werke in direkter Linie fortgesetzt hat.Das Konzept des Spiegelstadiums beansprucht in der Lehre Lacans einen privilegierten Platz.Dies aus zwei Gründen:Es wurde zuerst ausgearbeitet,vor den Konzepten des Symbolischen und des Realen.In inhaltlicher Hinsicht ist das Spiegelstadium geeignet,Vorgänge in der psychoanalytischen Kur zu erhellen, aber auch Einsichten über Liebe und Sexualität zu vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Was heißt Spiegelstadium?
- 2. Der Blick des Dritten
- 3. Das Begehren nach Einssein und sein Scheitern
- 4. Die Verschränkung von Bild und Sprache
- 5. Die Bedeutung des Spiegelstadiums am Beispiel der Hyperaktivität
- 5.1 Überlegungen zur Hyperaktivität des Kindes
- 5.2 Einführung
- 5.3 Ein klinisches Beispiel
- 5.4 Eine psychoanalytische Annäherung
- 6. Schlussgedanke
- 7. Bibelzitat
- 8. Literaturverzeichnis
- 9. Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Konzept des Spiegelstadiums, einer zentralen Theorie in der psychoanalytischen Lehre Jacques Lacans. Ziel ist es, das Spiegelstadium als bedeutendes Moment der Ich-Entwicklung zu analysieren und seine Bedeutung in Bezug auf das menschliche Begehren und die Entstehung von Identität zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen dem Kind und seinem Spiegelbild sowie die Rolle des Dritten bei der Konstitution des Ich.
- Das Spiegelstadium als Moment der Identitätsbildung
- Die Rolle des Anderen bei der Konstitution des Ich
- Die Beziehung zwischen Spiegelbild und Sprache
- Das Begehren nach Einssein und seine Unmöglichkeit
- Das Spiegelstadium im Kontext der Hyperaktivität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Spiegelstadiums als ein Schlüsselmoment der Ich-Entwicklung, während das zweite Kapitel die Rolle des Dritten als entscheidend für die Konstitution des Ichs darstellt. Das dritte Kapitel analysiert das Begehren nach Einssein und sein Scheitern in der frühen Kindheit. Im vierten Kapitel wird die Verschränkung von Bild und Sprache im Spiegelstadium untersucht. Das fünfte Kapitel diskutiert die Bedeutung des Spiegelstadiums im Kontext der Hyperaktivität.
Schlüsselwörter
Spiegelstadium, Jacques Lacan, Identitätsbildung, Ich-Entwicklung, Anderer, Begehren, Sprache, Hyperaktivität, Psychoanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Spiegelstadium nach Jacques Lacan?
Das Spiegelstadium ist ein zentrales Konzept der psychoanalytischen Theorie Jacques Lacans, das einen entscheidenden Moment in der Ich-Entwicklung eines Kindes beschreibt. Es markiert den Zeitpunkt, an dem sich ein Kind erstmals in einem Spiegel erkennt und ein Bewusstsein für seine eigene Identität entwickelt.
Welche Rolle spielt der „Andere“ bei der Konstitution des Ichs?
Der „Andere“ bzw. der Blick des Dritten ist laut Lacan essenziell für die Ich-Bildung. Das Kind identifiziert sich mit dem Bild, das es im Spiegel sieht, benötigt aber oft die Bestätigung durch eine Bezugsperson, um dieses Bild als sein „Ich“ anzunehmen.
Wie hängen Spiegelbild und Sprache im Spiegelstadium zusammen?
Das Spiegelstadium beschreibt die Verschränkung von Bild (Imaginärem) und Sprache (Symbolischem). Die Identität wird nicht nur durch das visuelle Bild, sondern auch durch die sprachliche Einordnung und Benennung innerhalb der sozialen Struktur geformt.
Was bedeutet das „Begehren nach Einssein“?
Es beschreibt den Wunsch des Kindes nach einer vollkommenen Einheit mit sich selbst und der Umwelt. Lacan argumentiert jedoch, dass dieses Begehren zwangsläufig scheitern muss, da die Identität immer auf einer Entfremdung durch das äußere Bild basiert.
Welchen Bezug hat das Spiegelstadium zur Hyperaktivität bei Kindern?
In der psychoanalytischen Betrachtung kann Hyperaktivität als eine Störung in der Ich-Konstitution und der Verarbeitung von Identitätsprozessen interpretiert werden, die ihre Wurzeln in den Erfahrungen des Spiegelstadiums haben kann.
- Quote paper
- Piroschka Weßling (Author), 2003, Überlegungen zur Hyperaktivität des Kindes und die Bedeutung des Spiegelstadiums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55254