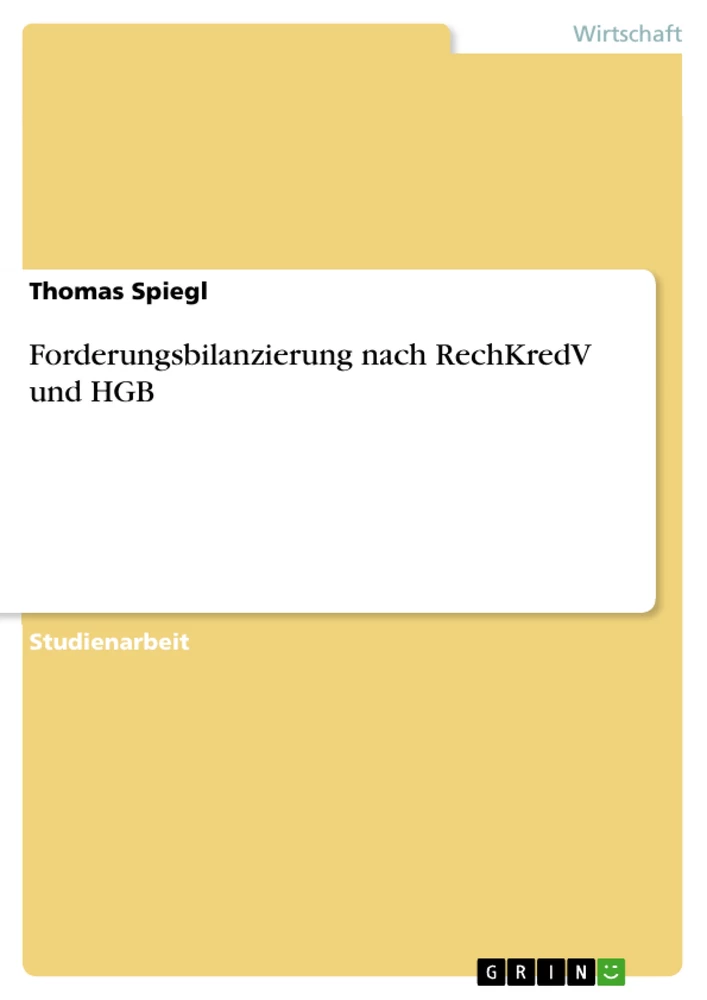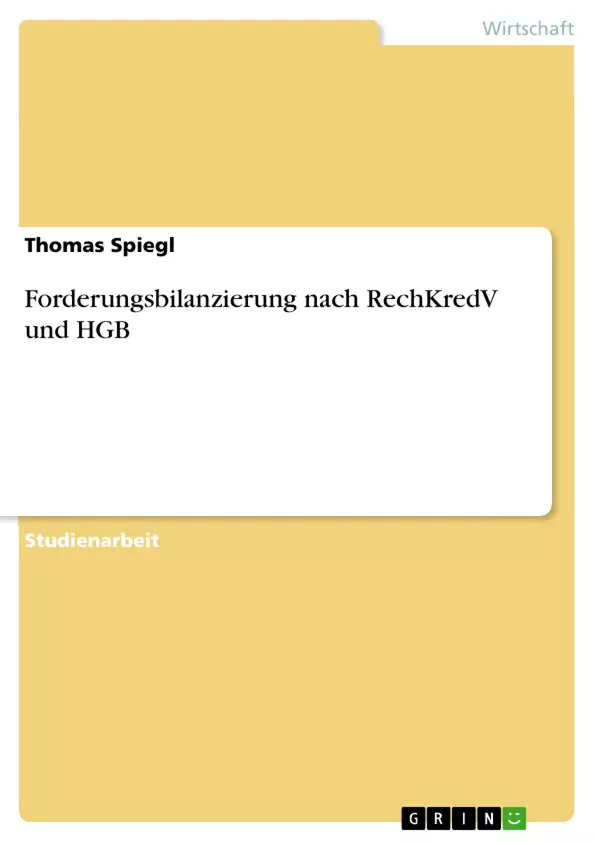Kreditinstitute nehmen aufgrund ihrer großen volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Art der Geschäftstätigkeit eine besondere Stellung ein und haben deshalb spezielle, zum Teil von anderen Branchen unterschiedliche, handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften zu beachten. Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit der Forderungsbilanzierung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten nach dem deutschen Handelsrecht. Durchschnittlich ca. 74 % der Aktiva deutscher Kreditinstitute besteht aus Forderungen. Dementsprechend kommt der Forderungsbilanzierung von Kreditinstituten ein hohes Gewicht zu.
Das Verständnis des Zustandekommens der Art und Höhe des Forderungsausweises von Kreditinstituten ist nicht nur für das rechnungslegende Kreditinstitut wichtig, sondern auch für jeden externen Leser von Bankbilanzen unumgänglich.
Zur Erschließung des Themas werden in Kapitel 2 zunächst die Forderungen von Kreditinstituten charakterisiert, gegenüber Wertpapieren abgegrenzt und der Bilanzausweis angeführt. In Kapitel 3, das den Hauptteil dieser Arbeit darstellt, wird die Erst- und Folgebewertung von Forderungen detailliert abgebildet. Dabei werden auch zwei ausgewählte Sonderfragen der Forderungsbilanzierung erläutert. In Kapitel 4 werden schließlich noch bilanzpolitische Gestaltungsspielräume im Bereich der Forderungsbewertung aufgezeigt.
Durch die 6. KWG-Novelle hat das KWG auch für Finanzdienstleistungsinstitute Gültigkeit erlangt (§ 1 Abs. 1a KWG). Neben dem KWG mussten in diesem Zusammenhang auch eine Reihe anderer gesetzlicher Bestimmungen geändert werden, so auch der Abschnitt „Ergänzende Vorschriften für Kreditinstitute“ des HGB und die „Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (kurz: RechKredV)“. In der folgenden Arbeit wird von Kreditinstituten oder einfach nur von Instituten die Rede sein; gemeint sind damit allerdings auch immer Finanzdienstleistungsinstitute.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit
- 2 Ausweis von Forderungen im Jahresabschluss
- 2.1 Charakterisierung von Forderungen
- 2.2 Abgrenzung des Forderungsbegriffs
- 2.3 Grundsätzliches
- 3 Bewertung von Forderungen
- 3.1 Erstbewertung
- 3.2 Folgebewertung
- 3.2.1 Direktabschreibung
- 3.2.2 Einzelwertberichtigung
- 3.2.3 Pauschalierte Einzelwertberichtigung
- 3.2.4 Pauschalwertberichtigung
- 3.2.5 Stille Risikovorsorge
- 3.2.6 Wertaufholung
- 3.3 Ausgewählte Sonderfragen der Forderungsbewertung
- 3.3.1 Zinsforderungen
- 3.3.2 Fremdwährungsforderungen
- 4 Bilanzpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Forderungsbilanzierung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten nach deutschem Handelsrecht. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Forderungsbewertung für die Darstellung der Vermögenslage dieser Institute, da Forderungen einen erheblichen Anteil ihrer Bilanzsumme ausmachen. Die Arbeit beleuchtet die Vorschriften und Methoden der Bewertung.
- Charakterisierung und Abgrenzung von Forderungen
- Erst- und Folgebewertung von Forderungen (inkl. verschiedener Methoden)
- Sonderfragen der Forderungsbewertung (z.B. Fremdwährungsforderungen)
- Bilanzpolitische Gestaltungsspielräume bei der Forderungsbewertung
- Relevanz der Rechnungslegungsvorschriften für Kreditinstitute
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit: Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Forderungsbilanzierung für Kreditinstitute, deren Bilanzsumme zu einem Großteil aus Forderungen besteht. Sie erläutert die Notwendigkeit eines korrekten Verständnisses der Forderungsbewertung sowohl für die Institute selbst als auch für externe Analysten. Die Arbeit strukturiert sich in die Charakterisierung von Forderungen, deren Bewertung (Erst- und Folgebewertung) und die Darstellung bilanzpolitischer Aspekte. Die hohe Relevanz des Themas wird durch die herausragende Stellung von Kreditinstituten in der Volkswirtschaft begründet und durch den hohen Anteil von Forderungen an deren Aktiva untermauert. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen der Forderungsbilanzierung.
2 Ausweis von Forderungen im Jahresabschluss: Dieses Kapitel charakterisiert die Forderungen von Kreditinstituten, grenzt sie von Wertpapieren ab und beschreibt deren Ausweis in der Bilanz. Es legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Bewertungsmethoden, indem es die spezifischen Eigenschaften von Forderungen im Kontext von Kreditinstituten herausarbeitet. Die Abgrenzung gegenüber Wertpapieren ist entscheidend für die korrekte Anwendung der jeweiligen Bewertungsmethoden. Der Fokus liegt auf der korrekten Darstellung der Forderungen im Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
3 Bewertung von Forderungen: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der detaillierten Darstellung der Erst- und Folgebewertung von Forderungen. Es werden verschiedene Methoden wie die Direktabschreibung, Einzelwertberichtigung, pauschalierte Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung sowie die stille Risikovorsorge und die Wertaufholung erklärt. Es wird tiefgehend auf die methodischen Unterschiede und die jeweiligen Implikationen für die Bilanz eingegangen. Die Berücksichtigung von Sonderfällen wie Zins- und Fremdwährungsforderungen rundet das Verständnis der komplexen Materie ab. Die Auswahl der Bewertungsmethoden hat erhebliche Auswirkungen auf den ausgewiesenen Wert der Forderungen und damit auf die Darstellung der Vermögenslage des Kreditinstituts.
4 Bilanzpolitik: Dieses Kapitel behandelt die Gestaltungsspielräume, die Kreditinstitute bei der Forderungsbewertung haben. Es analysiert die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Bilanz durch die Wahl der Bewertungsmethoden und deren Auswirkungen auf die Darstellung des Risikos und der Rentabilität. Der Abschnitt beleuchtet kritische Aspekte der Bilanzpolitik und die Notwendigkeit einer transparenten und nachvollziehbaren Bewertung. Es wird die Bedeutung der Wahl der Bewertungsmethoden für die Bilanzgestaltung und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung von Investoren und anderen Stakeholdern erläutert.
Schlüsselwörter
Forderungsbilanzierung, Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Handelsgesetzbuch (HGB), Rechnungslegung, Bewertung von Forderungen, Erstbewertung, Folgebewertung, Direktabschreibung, Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung, Risikovorsorge, Bilanzpolitik, KWG, RechKredV.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forderungsbilanzierung von Kreditinstituten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Forderungsbilanzierung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten nach deutschem Handelsrecht. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Forderungen und deren Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögenslage dieser Institute, da Forderungen einen erheblichen Anteil ihrer Bilanzsumme ausmachen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakterisierung und Abgrenzung von Forderungen, die Erst- und Folgebewertung (inklusive verschiedener Methoden wie Direktabschreibung, Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung und stille Risikovorsorge), Sonderfragen der Forderungsbewertung (z.B. Fremdwährungsforderungen), bilanzpolitische Gestaltungsspielräume und die Relevanz der Rechnungslegungsvorschriften für Kreditinstitute.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt den Ausweis von Forderungen im Jahresabschluss. Kapitel 3 widmet sich detailliert der Bewertung von Forderungen (Erst- und Folgebewertung, inklusive verschiedener Methoden und Sonderfälle). Kapitel 4 analysiert die bilanzpolitischen Aspekte der Forderungsbewertung.
Welche Bewertungsmethoden werden erläutert?
Die Arbeit erläutert verschiedene Methoden der Forderungsbewertung, darunter die Direktabschreibung, die Einzelwertberichtigung, die pauschalierte Einzelwertberichtigung, die Pauschalwertberichtigung, die stille Risikovorsorge und die Wertaufholung. Die jeweiligen methodischen Unterschiede und Implikationen für die Bilanz werden detailliert dargestellt.
Welche Bedeutung hat die Forderungsbewertung für Kreditinstitute?
Die korrekte Bewertung von Forderungen ist für Kreditinstitute von entscheidender Bedeutung, da sie einen erheblichen Einfluss auf die Darstellung der Vermögenslage und des Risikos hat. Die Wahl der Bewertungsmethoden bietet bilanzpolitische Gestaltungsspielräume, die transparent und nachvollziehbar sein müssen.
Welche Rechtsvorschriften sind relevant?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Rechtsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB), des Kreditwesengesetzes (KWG) und der Rechnungslegungsverordnung für Kreditinstitute (RechKredV).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Forderungsbilanzierung, Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Handelsgesetzbuch (HGB), Rechnungslegung, Bewertung von Forderungen, Erstbewertung, Folgebewertung, Direktabschreibung, Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung, Risikovorsorge, Bilanzpolitik, KWG, RechKredV.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich mit der Forderungsbilanzierung von Kreditinstituten auseinandersetzen, insbesondere Studenten, Wissenschaftler, Praktiker im Finanzwesen und externe Analysten.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Thomas Spiegl (Author), 2004, Forderungsbilanzierung nach RechKredV und HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55325