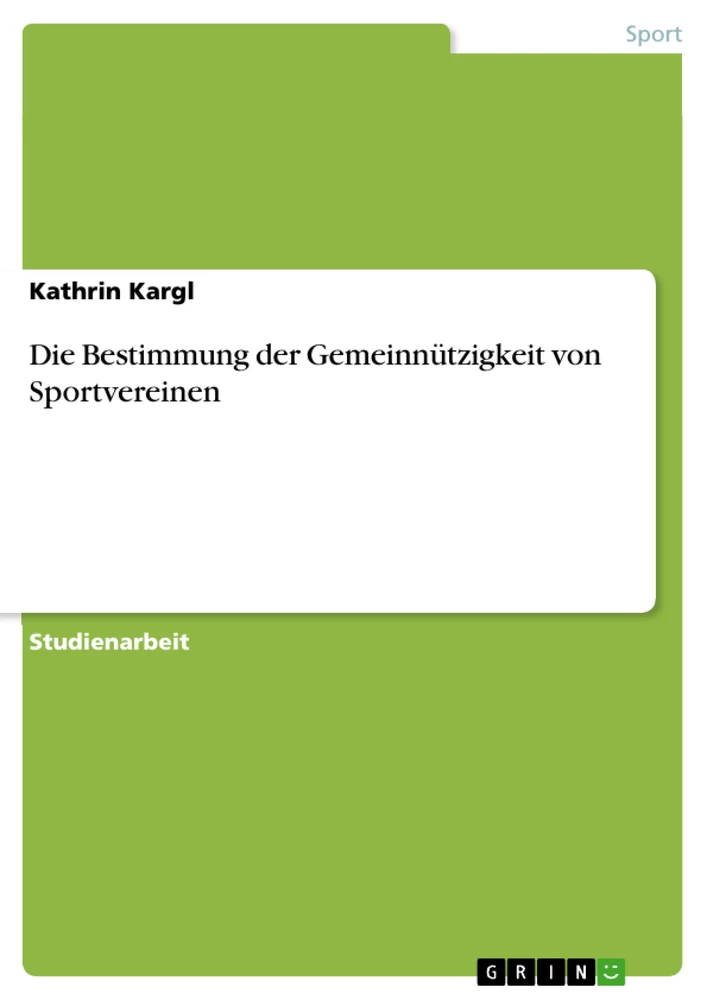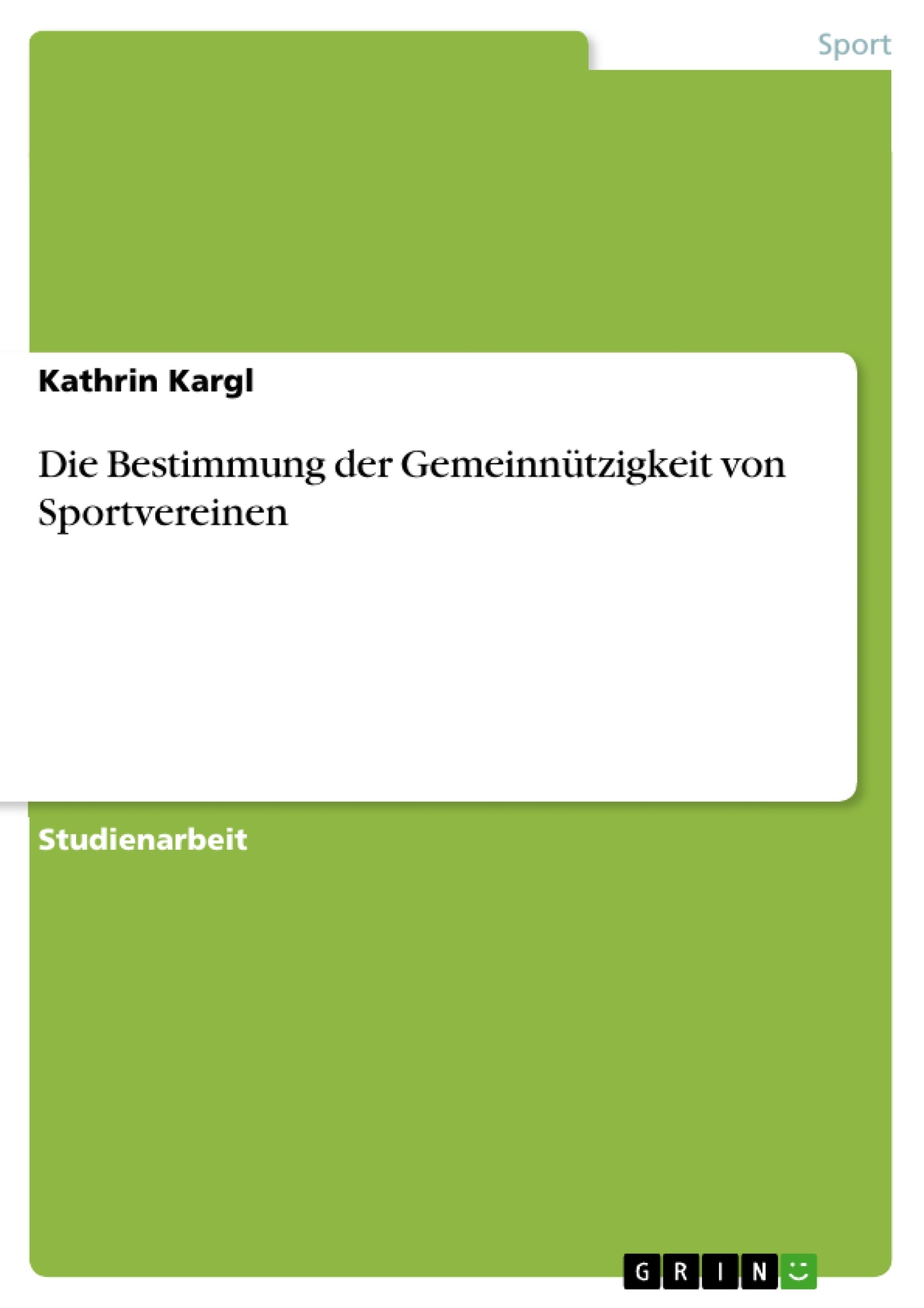„Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ schrieb bereits Mitte des 18. Jahrhunderts der französische Schriftsteller und Denker Charles Montesquieu. Von dem Begriff Gemeinnutz ist die Gemeinnützigkeit abgeleitet. Gemeint ist damit eine Tätigkeit, die der Allgemeinheit und nicht nur dem Wohle eines Einzelnen dient. Auch Sportvereine leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines lebendigen Gemeinwesens und streben nach der Gemeinnützigkeit. Ein Verein, der die Gemeinnützigkeit erlangen will, ist eine so genannte „Non profit Organisation“, d.h. das Ziel des Vereins dient nicht der Erwirtschaftung eines Gewinns, sondern die erwirtschafteten Mittel dienen lediglich dem Vereinszweck.
Zum Aufbau der Studienarbeit sei gesagt, dass in Kapitel 2 zunächst einmal der „Verein“ an sich näher erläutert wird, ehe in Kapitel 3 der Hauptteil in Anbetracht der „Gemeinnützigkeit“ beginnt. Mit den Fragen „Warum es Vereine für notwendig betrachten die Gemeinnützigkeit zu beantragen“ und „welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen“, beschäftigt sich dieses Kapitel ausführlich. Besondere Aufmerksamkeit müssen Vereine dabei auf ihre Satzung und tatsächliche Geschäftsführung legen. Im 4. Kapitel wird ein Überblick über die steuerliche Sonderstellung von gemeinnützigen Vereinen gegeben. In diesem Zusammenhang werden die verschiedenen Tätigkeitsbereiche eines Vereines und deren steuerlichen Folgen in verkürzter Form dargestellt. Das fünfte und zugleich letzte Kapitel der Arbeit befasst sich letztendlich damit, wie die Anerkennung bzw. die Aberkennung durch das Finanzamt von statten geht und welche Vorteile bzw. Nachteile sich für die Sportvereine daraus ergeben können. Abschließend folgt in Kapitel 6 die Schlussbetrachtung.
Alle angegeben §§ aus den verschiedenen Gesetzestexten sind im Anhang in den Anlagen 3 – 5 nachzulesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Sportverein
- Definition „Verein“
- Abgrenzung: Idealverein und wirtschaftlicher Verein
- Rechtsfähiger und nichtrechtsfähiger Verein
- Gemeinnützigkeit
- Definition „Gemeinnützigkeit“
- Gemeinnützige Zwecke
- Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit
- Selbstlosigkeit
- Ausschließlichkeit
- Unmittelbarkeit
- Steuerlich unschädliche Betätigungen
- Satzung
- Tatsächliche Geschäftsführung
- Steuerliche Sonderstellung gemeinnütziger Vereine
- Ideeller Bereich
- Vermögensverwaltung
- Zweckbetrieb
- Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
- Anerkennung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit
- Die Anerkennung und ihre Folgen
- Die Aberkennung und ihre Folgen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Gemeinnützigkeit von Sportvereinen. Sie beleuchtet die Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die damit verbundenen steuerlichen Folgen. Die Arbeit analysiert den Begriff der Gemeinnützigkeit im Kontext von Sportvereinen und deren spezifischen Aktivitäten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Verein“
- Kriterien der Gemeinnützigkeit (Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit)
- Steuerliche Auswirkungen der Gemeinnützigkeit
- Prozess der Anerkennung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit
- Bedeutung der Satzung und der tatsächlichen Geschäftsführung für die Gemeinnützigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gemeinnützigkeit von Sportvereinen ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung der Gemeinnützigkeit für Sportvereine und die Notwendigkeit, die dafür notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen. Die Arbeit wird in die Kapitel 2 bis 5 gegliedert, die jeweils einen Aspekt der Gemeinnützigkeit von Sportvereinen näher beleuchten.
Der Sportverein: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Verein“ und grenzt Idealvereine von wirtschaftlichen Vereinen ab. Es unterscheidet zwischen rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Vereinen und legt die Grundlagen für das Verständnis der Organisationsstruktur von Sportvereinen, die im weiteren Verlauf der Arbeit im Kontext der Gemeinnützigkeit betrachtet werden.
Gemeinnützigkeit: Das Kapitel erklärt umfassend den Begriff der Gemeinnützigkeit und beschreibt die gemeinnützigen Zwecke. Es analysiert detailliert die drei zentralen Kriterien für die Gemeinnützigkeit: Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit. Die Bedeutung der Satzung und der tatsächlichen Geschäftsführung für den Erhalt der Gemeinnützigkeit wird ebenfalls erörtert. Die Kapitel-abschnitte befassen sich intensiv mit der Notwendigkeit, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, um die Gemeinnützigkeit zu erlangen und zu bewahren.
Steuerliche Sonderstellung gemeinnütziger Vereine: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die steuerlichen Vorteile gemeinnütziger Vereine. Es unterscheidet zwischen ideellem Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und erklärt die jeweiligen steuerlichen Konsequenzen. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Einhaltung der Gemeinnützigkeitsbestimmungen zu erheblichen Steuervergünstigungen führt.
Schlüsselwörter
Gemeinnützigkeit, Sportverein, Verein, Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit, Satzung, Steuerliche Sonderstellung, Anerkennung, Aberkennung, Finanzamt, Non-profit-Organisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Gemeinnützigkeit von Sportvereinen
Was ist der Inhalt dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich umfassend mit der Gemeinnützigkeit von Sportvereinen. Sie untersucht die Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, die damit verbundenen steuerlichen Folgen und analysiert den Begriff der Gemeinnützigkeit im Kontext der spezifischen Aktivitäten von Sportvereinen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Vereinen, Gemeinnützigkeit, der steuerlichen Sonderstellung gemeinnütziger Vereine, Anerkennung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit sowie eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was wird unter dem Begriff „Verein“ verstanden und wie wird er abgegrenzt?
Die Arbeit definiert den Begriff „Verein“ und differenziert zwischen Idealvereinen und wirtschaftlichen Vereinen. Sie unterscheidet zudem zwischen rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Vereinen und beleuchtet die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Organisationsstruktur von Sportvereinen im Kontext der Gemeinnützigkeit.
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Sportverein als gemeinnützig anerkannt wird?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Kriterien der Gemeinnützigkeit, insbesondere Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit. Sie erklärt, wie diese Kriterien im Kontext von Sportvereinen angewendet werden und welche Bedeutung die Satzung und die tatsächliche Geschäftsführung für die Anerkennung und den Erhalt der Gemeinnützigkeit haben. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen wird als essentiell hervorgehoben.
Welche steuerlichen Vorteile haben gemeinnützige Sportvereine?
Die Arbeit erläutert die steuerlichen Vorteile gemeinnütziger Vereine. Sie unterscheidet zwischen ideellem Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und erklärt die jeweiligen steuerlichen Konsequenzen. Es wird deutlich gemacht, wie die Einhaltung der Gemeinnützigkeitsbestimmungen zu erheblichen Steuervergünstigungen führt.
Wie läuft der Prozess der Anerkennung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit ab?
Die Arbeit beschreibt den Prozess der Anerkennung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit und erläutert die Folgen beider Szenarien für den Sportverein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Erhalt der Gemeinnützigkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Gemeinnützigkeit, Sportverein, Verein, Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit, Satzung, Steuerliche Sonderstellung, Anerkennung, Aberkennung, Finanzamt, Non-profit-Organisation.
- Citar trabajo
- Kathrin Kargl (Autor), 2006, Die Bestimmung der Gemeinnützigkeit von Sportvereinen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55332