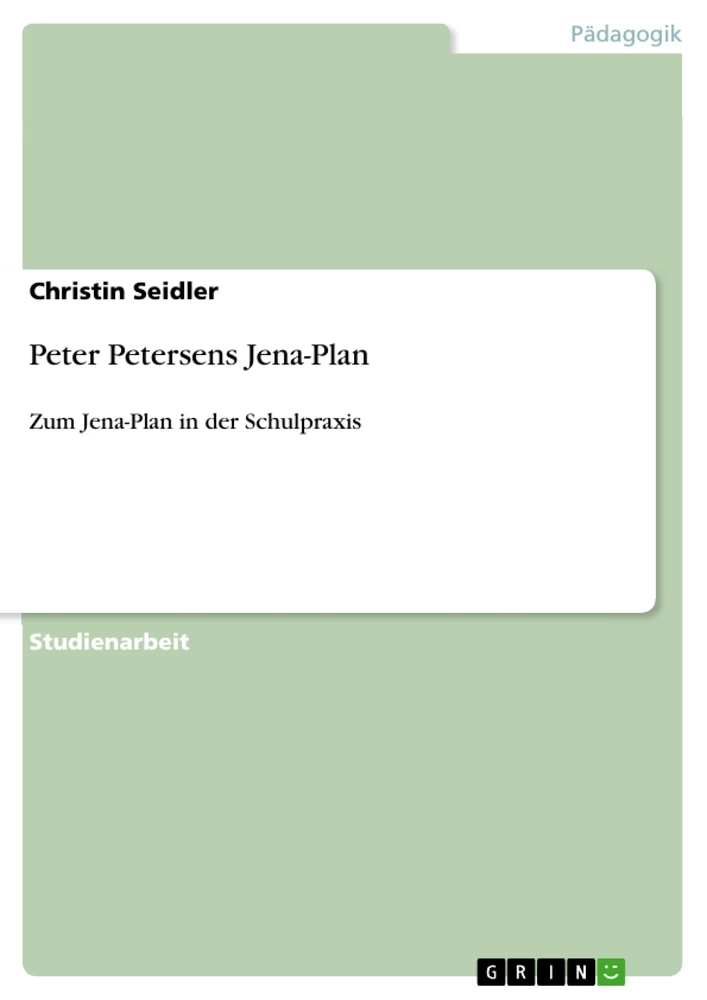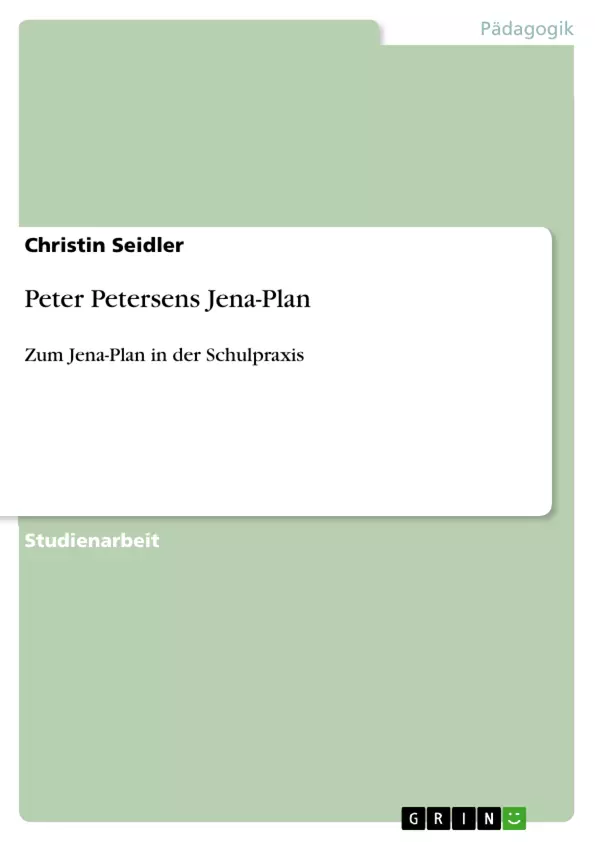Es stellt sich für mich die Frage, ob sich die Kinder, die auf eine Jena- Plan-Schule, oder eine andere reformpädagogische Schule gegangen sind, sich anders entwickelt haben als jene, die die überwiegende Unterrichtsform erfahren haben. Eine mögliche Argumentation möchte ich im Kapitel 4 beginnen. Zuvor möchte ich kurz Leben und Werk von Peter Petersen beleuchten und anschließend einen Einblick des Jena-Plan in der Schulpraxis geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Peter Petersen – Leben und Werk im Umriss
- Der Jena-Plan in der Schulpraxis
- Stammgruppen statt Jahresklassen
- Wochenarbeitsplan statt Fetzenstundenplan
- Kurse zur Sicherung des Mindestwissens
- Arbeits- und Leistungsberichte statt Zensuren
- Schulwohnstube als Raum für soziale und stille Erziehung
- Pädagogische Haltung
- Jena-Plan im Diskurs
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Jena-Plan, einem pädagogischen Konzept von Peter Petersen, und analysiert seine Bedeutung für die Schulpraxis. Die Arbeit beleuchtet das Leben und Werk von Peter Petersen, untersucht die verschiedenen Elemente des Jena-Plans und stellt den Ansatz im Kontext der Schulreformdiskussion dar.
- Die Bedeutung von Peter Petersens pädagogischem Konzept
- Die zentralen Elemente des Jena-Plans
- Die Relevanz des Jena-Plans für die heutige Schuldiskussion
- Die Umsetzung des Jena-Plans in der Schulpraxis
- Die Kritik am Jena-Plan und dessen Auswirkungen auf die Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Jena-Plans ein und erläutert den Kontext der aktuellen Schulreformdiskussion.
Das Kapitel "Peter Petersen – Leben und Werk im Umriss" skizziert den Lebensweg und die wichtigsten Stationen der pädagogischen Entwicklung von Peter Petersen.
Das Kapitel "Der Jena-Plan in der Schulpraxis" beleuchtet die wichtigsten Elemente des Jena-Plans, wie z.B. die Stammgruppen, den Wochenarbeitsplan und die Schulwohnstube, und diskutiert deren praktische Umsetzung.
Schlüsselwörter
Jena-Plan, Peter Petersen, Reformpädagogik, Stammgruppen, Wochenarbeitsplan, Schulwohnstube, Schulreform, Bildung, Erziehung, Lernen, Gemeinschaft, Individualität.
- Arbeit zitieren
- Christin Seidler (Autor:in), 2005, Peter Petersens Jena-Plan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55335